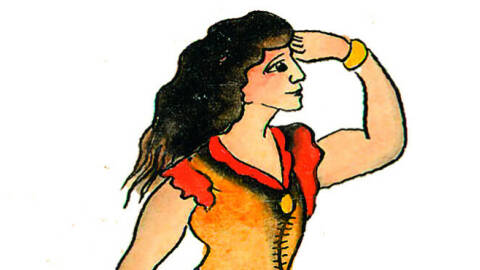Titelthema
Das Beste der Stadt

Das „Kirchenmanifest“ ruft Kirchen, Staat und Zivilgesellschaft dazu auf, Kirchengebäude zu erhalten und sie in eine gemeinwohlorientierte Nutzung zu überführen
„Suchet der Stadt Bestes“, heißt es beim Propheten Jeremia: eine Aufforderung, der sich Kirchen und Städte, Stadtteile und Dörfer gerade im Wiederaufbau nach dem Zweiten Weltkrieg vielerorts im Westen Deutschlands verschrieben hatten. Gemeinsam übernahmen Kirchen, Kommunen sowie Einwohnerinnen und Einwohner Verantwortung, um Kirchengebäude nach den Verheerungen des Zweiten Weltkriegs als wertebasierte Räume des Gemeinwesens und als Rückversicherung in weit zurückreichenden europäischen Verbindungen wieder und neu zu errichten. Im Osten Deutschlands gab es dieses politische Bekenntnis nicht, doch auch hier wurden Kirchengebäude mit hohem Engagement zahlreicher Beteiligter aus beiden deutschen Staaten über die Zeit gebracht und waren später vielerorts Treffpunkte des demokratischen Aufbruchs.

Hören Sie hier den Artikel als Audio!
Einfach anklicken, auswählen und anhören!
Die gesellschaftliche Verwobenheit ist am Beginn des 21. Jahrhunderts neu zu verhandeln: Kirchenmitgliedschaften gehen zurück, in vielen Regionen stellen die Mitglieder der beiden großen Kirchen nicht mehr – in den sogenannten neuen Bundesländern schon lange nicht mehr – die Mehrheit der Bevölkerung. Doch werden deshalb – wie immer häufiger zu hören ist – die Kirchengebäude nicht mehr gebraucht?
Sind sie gar überflüssige „Immobilien“, die es nun zu „verwerten“ gilt, um „Kernaufgaben“ für eine schrumpfende Zahl von Mitgliedern zu erfüllen? Das im Mai 2024 veröffentlichte „Kirchenmanifest“ stößt eine öffentliche Debatte zu diesen Fragen an. Initiiert von einem Kreis unterschiedlicher Akteurinnen und Akteure werden ein Innehalten und eine Neuperspektivierung sowie eine gemeinschaftliche Verantwortungsübernahme – auch finanziell! – von Kirchen, öffentlicher Hand und Zivilgesellschaft für Erhalt und gemeinwohlorientierte Nutzung der Kirchenbauten gefordert. Getragen wird diese Initiative von Personen und Institutionen mit langjähriger Expertise in Denkmalpflege, beiden Theologien, Kunstgeschichte und kultureller Bildung, Baukultur sowie bürgerschaftlichem Engagement. Wohl erstmals werden diese Felder hier zusammengeführt und wird damit die Diskussion um die Zukunft der Kirchengebäude in der notwendigen Komplexität vorangebracht.
Es ist ein Thema, das alle angeht, weil es um das Beste der Städte, Stadtquartiere und Dörfer geht. Adressiert ist das „Kirchenmanifest“ gleichermaßen an die beiden großen Kirchen, an die Politik und an die Zivilgesellschaft. Hier wurden im Vorfeld der Veröffentlichung 75 teils prominente Erstunterzeichnerinnen und Erstunterzeichner gewonnen; bis zum Sommer 2025 haben mehr als 22.000 Personen unterschrieben.
Die beiden großen Kirchen haben auf das Manifest im Frühsommer 2024 mit einer gemeinsamen Erklärung reagiert, die den Impuls für eine breite gesellschaftliche Auseinandersetzung mit dem Thema begrüßt. Es war dies offenbar die erste gemeinsame Stellungnahme der beiden Kirchen zu einem Thema, mit dem sie landauf, landab in denselben Städten, Stadtteilen und Dörfern befasst sind. Dringend notwendig scheint daher, dass dieses gemeinsame Gespräch zu einer Selbstverständlichkeit wird.
Bisher zurückhaltender sind Reaktionen aus Politik und kommunaler Verwaltung, die doch vom Manifest in gleicher Weise wie die Kirchen angesprochen sind. Immerhin geht es um die Zukunft von Innenstädten, von gemeinwohlorientierten Räumen in Stadtquartieren und um dringend benötigte Begegnungsorte der Demokratie. Es geht um Perspektiven für Räume, die bereits da sind. Um Räume, die in Hitzeschutzkonzepte integriert werden können und sollten. Sie sind, wie der aktuelle Baukulturbericht der Bundesstiftung Baukultur herausstellt, Infrastruktur. Und ja, es geht auch um kulturelles Erbe, um Bauten, Kunstwerke, Orgeln und Glocken, um Paramente, Bücher und Archivgut. Die Kirchen bewahren mehr Kunstwerke als die Museen der Metropolen, immer wieder von herausragendem Wert, gerade auch in ländlichen Regionen, wie die Deutsche Stiftung Denkmalschutz nicht müde wird zu betonen. Diese Überlieferung lässt sich als Potenzial der grundgesetzlich geforderten Gleichwertigkeit von Lebensverhältnissen und des menschenrechtlich verankerten Rechts auf kulturelle Teilhabe aufschließen, wie das vom Bund geförderte Programm „Kirchturmdenken“ (kirchturmdenken.org) eindrucksvoll zeigen konnte. Das gilt ausdrücklich auch für Kirchenbauten der weithin ungeliebten Nachkriegsmoderne, mithin jene Bauten und ihre Ausstattungen, die in der jungen Bundesrepublik das Beste für die Städte der neuen Demokratie suchten und den Zukunftsvorstellungen jener Zeit Gestalt gaben. Heute befinden sich nicht wenige dieser Bauten in „problematischen“ Stadtvierteln – also dort, wo Begegnungsorte ganz besonders dringend benötigt werden. Soeben hat – um dieses eine Beispiel zu nennen – der Rat der Stadt Dortmund beschlossen, die beiden großen Kirchen einzuladen, gemeinsam mit Politik, Verwaltung und noch zu benennenden Experten eine „Zukunftskommission Kirchenbauten“ zu gründen, damit diese „wenn möglich Gemeingut und Chancenräume für unsere Stadt“ bleiben.
Das „Kirchenmanifest“ greift das Konzept „Vierte Orte“ von „Baukultur NRW“ auf. Ausgehend von dem Konzept der „Dritten Orte“, das soziale Orte als notwendige gemeinwohlorientierte Begegnungsorte beschreibt, meinen „Vierte Orte“ gewissermaßen „Dritte Orte plus“: plus Spiritualität, die nicht konfessionell gebunden ist. Es geht um nichts Geringeres als die Frage, in welchen Städten, Stadtteilen und Dörfern wir leben wollen – und ob zu unserer Welt Räume gehören, die eine spirituelle Dimension bergen und eröffnen, mehr noch: wo Menschen verschiedener Religionen und Weltanschauungen gemeinsam zu Hause sein können.
Es wird sicherlich weiterhin Kirchenbauten geben, die die beiden großen Kirchen jeweils für sich mit Leben füllen. Das Manifest ruft dazu auf, auch geteilte (und dann auch gemeinsam finanzierte) Nutzungen anzustreben, mithin Nutzungserweiterungen als Chance zu sehen. Vor allem aber fordert es, dass Kirchengebäude, die von den Kirchen außer Gebrauch gestellt werden, nicht als „Immobilien“ verwertet werden, sondern dem Gemeinwesen erhalten bleiben. Getragen ist diese Forderung von der hoffnungsvollen Vorstellung, dass Kirchen, Politik und Zivilgesellschaft gemeinsam das Beste der Stadt suchen.