Titelthema
Gütesiegel deutscher Politik

Die neue Koalition muss nun unter Beweis stellen, dass eine auf Kompromiss gegründete Regierung entscheidungsfähig und entscheidungsfreudig ist.
Der Kompromiss ist das Gütesiegel deutscher Politik. In die Koalitions ver hand lun gen zur Bildung einer neuen Bundesregierung gingen die Verhandlungsparteien mit der gemeinsamen Grundüberzeugung, dass das Ergebnis ihrer Verhandlungen auf einen Kompromiss zulaufen werde. In unserem wichtigsten europäischen Partnerland, Frankreich, gewöhnt sich die politische Klasse allmählich an die Vorstellung, dass bei unklaren Mehrheitsverhältnissen im Parlament eine parteienübergreifende Kooperation zwischen den in „droite“ und „gauche“ geschiedenen Lagern geboten sei und auf diese Weise ein „compromis“ nach deutschem Vorbild zustande komme. Auch wenn Deutschland hinsichtlich seiner wirtschaftlichen Innovationsfähigkeit derzeit nicht zum Vorbild taugt, hat es doch einen Exportartikel zu bieten, der sich einer langen, seit der Mitte des 19. Jahrhunderts gewachsenen Tradition des Regierens verdankt: den Kompromiss. Ein wissenschaftlich scharfer Begriff von „Kompromiss“ hat davon auszugehen, dass er in der Politik zweierlei bedeutet: Zum einen bezeichnet er ein bestimmtes Verfahren, das zweitens in eine politische Entscheidung mündet. Kompromisse – und dies ist die erste wichtige Prämisse – gedeihen nur in politischen Systemen, die als Verhandlungssysteme konzipiert sind. Dies bedeutet, dass sie über eine komplexe Anordnung von entscheidungsbefugten Institutionen verfügen müssen und dass dem Parlament dabei eine wichtige Rolle zufällt. Nur wenn in politischen Systemen nicht von oben durchregiert wird, entstehen komplexe Aushandlungsprozesse, in die die entscheidungsbefugten Akteure einzubinden sind. Ein Kompromiss ist mithin stets das Ergebnis geordneter Verfahren. Sein legitimatorischer Vorzug ist, dass die auf diesem Wege erzielte Lösung alle Beteiligten bindet und damit eine hohe Bindungskraft erzeugt.
Kulturtechnik des Verhandelns
Das Gegenmodell des Kompromisses ist das des Dezisionismus, bei dem von einer politischen Spitze aus reine, gewissermaßen unverfälschte Entscheidungen getroffen werden. Die derzeitige Konjunktur solcher hierarchischen Politikmodelle (USA, Russland) speist sich auch aus der berechtigten Annahme, dass kompromisshafte Entscheidungsverfahren strukturell nicht zu harten und unerbittlichen Entscheidungen führen, sondern stets zu ausbalancierten Lösungen. Ein Blick nicht nur in die deutsche Geschichte lehrt, dass solche dezisionistischen Erwartungen an die Politik stets mit einem Freund-Feind-Denken einhergehen, das die politische Kultur vergiftet und auch semantisch keine Brückenschläge mehr erlaubt. Die Machtübertragung an Hitler konnte im Januar 1933 nur erfolgen, weil zuvor solche dezisionistischen Erwartungsüberschüsse auf die Person und das Amt des Reichspräsidenten Hindenburg projiziert worden waren. Eine geschichtlich gewachsene Skepsis gegenüber kompromissunfähigen Führersystemen allein reicht aber nicht aus, um den Kompromiss zum bevorzugten Modell der Regierungsführung zu deklarieren. Denn auch auf Kompromiss gebaute Systeme müssen ihre Handlungsfähigkeit gerade in stürmischen Zeiten unter Beweis stellen. Damit sind vor allem politische Parteien und Parlamentarier als Hauptakteure in die Pflicht genommen. Sie müssen Formen des Verhandelns entwickeln, die die Garantie dafür bieten, dass die gemeinsam getroffenen politischen Vereinbarungen Geltungskraft besitzen und von den Beteiligten nicht infrage gestellt werden.
Dies verweist auf die Bedeutung einer Kulturtechnik, die gar nicht selbstverständlich ist: die des Verhandelns. Denn Verhandeln setzt Symmetrie unter den Beteiligten voraus und damit zugleich Respekt vor den Institutionen, die aus ihrer Mitte Akteure mit einem Verhandlungsmandat ausstatten. In Deutschland hat sich spätestens seit der Errichtung des Nationalstaats 1871 ein komplexes Miteinander von Regierung, Parlament, Parteien und den Organen des Föderalismus herauskristallisiert, in dem die Kulturtechnik symmetrischen Verhandelns in den Verfassungsorganen erprobt wurde. Daran konnte die Bundesrepublik beim politischen Neustart der Demokratie nach 1945 nahtlos anknüpfen; und genau in dieser kulturellen Verankerung liegt ihr Stabilitätsanker.
Zwei Voraussetzungen
Mustert man insbesondere die Geschichte der Bundesrepublik unter diesem Aspekt, dann springt ins Auge, dass auf Kompromiss gebaute Regierungen immer dann entscheidungsfreudig waren, wenn sie von einer alle Beteiligten umwölbenden politischen Leitvorstellung getragen wurden. Die Adenauer-Regierungen waren auf den Kompass der Westintegration ausgerichtet, die unpopuläre Entscheidungen erforderte, die wiederum auch durch die Führungsstärke von Bundeskanzler Adenauer zustande kamen. Die erste sozialliberale Koalition unter Bundeskanzler Willy Brandt wurde durch das politische Projekt einer neuen Ost- und Deutschlandpolitik zu einer Handlungseinheit zusammengeschweißt, die trotz überaus knapper und am Ende sogar abhandengekommener Parlamentsmehrheit tiefgreifende Weichenstellungen vollzog. Die Regierung Kohl/Genscher vollzog gegen eine in dieser Dimension einmalige zivilgesellschaftliche Protestbewegung die Entscheidung für eine Modernisierung der Atomwaffen. Die Entscheidungsfreude all dieser auf Kompromiss gebauten Bundesregierungen beruhte auf zwei Voraussetzungen. Zum einen war die Zahl der an der Regierungsbildung beteiligten Fraktionen überschaubar, im Falle der Regierungen Brandt und Kohl mussten nur zwei Fraktionen eingebunden werden. Zum anderen schälte sich – und dies ist der besonders erkenntnisträchtige Punkt – zwischen den Entscheidungsträgern ein bestimmter Modus des Verhandelns heraus – nämlich ein verständigungsorientiertes Verhandeln.
Warum die Ampel zerfiel
In einer solchen Regierung kann auch der stärkere Regierungspartner dem kleineren Partner Zugeständnisse machen, ohne dass er direkte Gegenleistungen einfordert – und zwar weil zwischen den Entscheidern ein persönliches Vertrauensverhältnis besteht. Dem Partner Erfolge zu gönnen, stellt sich aber nur dann ein, wenn die Regierung durch eine übergreifende politische Leitidee zusammengehalten wird. Dazu bedarf es keines Koalitionsvertrags, der einen in der politischen Praxis gar nicht einlösbaren Regelungsanspruch erhebt. Die Regierung Brandt/Scheel kam ohne jede Koalitionsvereinbarung zwischen den Regierungsparteien aus, weil sich die beiden Spitzen in bürgerlicher Respektabilität vertrauten und ihre verbindenden Ideen in der Regierungserklärung des Bundeskanzlers zum Ausdruck brachten.
Eine auf Sand gebaute Kompromissregierung befleißigt sich eines grundlegend anderen Verhandlungsstils – nämlich eines rein positionsbezogenen Verhandelns. Hier werden in ausufernden Koalitionsverträgen politische Koppelungsgeschäfte verankert. Der Webfehler eines solchen Verhandlungssystems besteht darin, dass auf die kompro miss sta bi li sie ren de Wirkung eines die Regierungspartner verbindenden Projekts verzichtet wird. Die scheidende Ampel-Regierung ist genau aus diesem Grunde gescheitert: Sie bestand aus drei Regierungsparteien, die nur deswegen zusammenkamen, weil sie partikulare Interessen in einem Koalitionsvertrag addierten. Sie brach auseinander, als die für die Finanzierung der politischen Koppelungsgeschäfte erforderlichen Haushaltsmittel durch das Urteil des Bundesverfassungsgerichts nicht mehr auf kompromisshaftem Wege aufzubringen waren.
Der große Praxistest beginnt
Es wird sich zeigen, ob die neue Bundesregierung aus diesem strukturellen Defizit der Vorgängerregierung die richtigen verhandlungskulturellen Folgen gezogen hat. Denn die Geschichte der Bundesrepublik zeigt, dass der Kompromiss nur gelingen kann, wenn er mehr ist als die Summe von Einzelteilen. Es wird daher von entscheidender Bedeutung sein, wie die neue Bundesregierung die Koordination innerhalb der Regierung und der sie tragenden Parteien und Fraktionen organisiert und welchen Verhandlungsstil sie präferiert. Die neue Bundesregierung steht dabei unter er heb li chem Legitimationsdruck. Denn sie muss unter Beweis stellen, dass eine auf Kompromiss gegründete Regierung entscheidungsfähig und entscheidungsfreudig ist. Denn nur so kann sie die Widersacher des Kompromisses widerlegen, welche auch in Deutschland deswegen mit autoritären Lösungen liebäugeln und sie mit immer größerem Erfolg beim Elektorat anpreisen, weil sie auf Kompromiss gegründetes Regieren als halbherzig und zeitverschwenderisch kommunizieren.
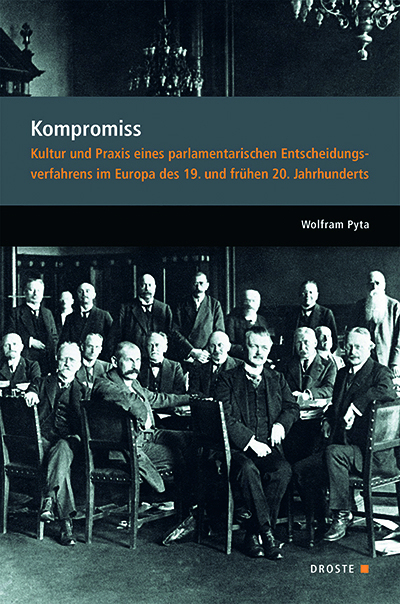
Wolfram Pyta
Kompromiss: Kultur und Praxis eines parlamentarischen Entscheidungsverfahrens im Europa des 19. und frühen 20. Jahrhunderts
Droste Verlag 2025,
292 Seiten, 49,80 Euro

Wolfram Pyta, RC Stuttgart-Weinsteige, leitet die Abteilung für Neuere Geschichte an der Universität Stuttgart. Im Februar 2025 veröffentlichte er eine Publikation über Kultur und Praxis des Kompromisses, welche eine Vorstufe für eine 2026 erscheinende Monografie zum Stellenwert des Kompromisses in der deutschen Politik bildet.







