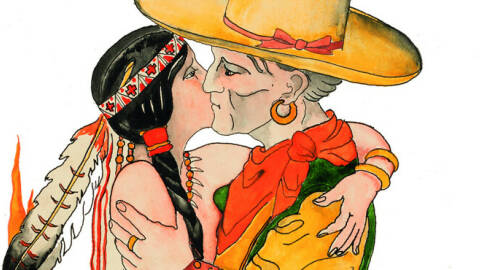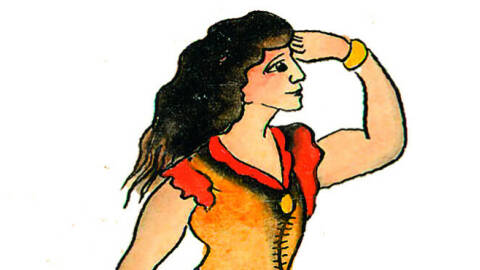Titelthema
Warm und trocken
Der Reiz der Gemeinschaft ist groß. Aber sie kann auch gefährliche Ausmaße annehmen.
Das Wort Gemeinschaft lässt die Sehnsucht nach tiefer Geborgenheit, nach Gemütlichkeit aufkommen. Sie ist das Dach, unter dem man bei starkem Regen Schutz sucht, der Feuerplatz, an dem man sich in frostigen Tagen die Hände wärmt. Mit der Idee der Gemeinschaft werden vielfältigste Hoffnungen verbunden. In ihr würden Menschen nicht mehr nebeneinanderher leben, sondern sich verbunden fühlen und sich gegenseitig unterstützen. Anstatt verhärteter Konflikte im Inneren käme es in Gemeinschaften zu Konfliktlösungsmechanismen, die auf Vertrauen basieren und das Leben für alle leichter machen würden. Die Menschen seien zwar auch in der Gemeinschaft nicht alle gleich, aber die Zugehörigkeit zu ihr würde die Statusunterschiede nivellieren und so den Menschen eine gemeinsame Heimat bieten. Die karikierende Vorstellung findet man in den Asterix-und-Obelix-Comics, ersonnen von René Goscinny und Albert Uderzo. Man streitet sich, man prügelt sich, aber am Ende ist man eine enge Gemeinschaft, die füreinander durch dick und dünn geht. Kurz: Es fühlt sich gut an, Teil einer Gemeinschaft zu sein.
Sehnsucht nach Gemeinschaft
Der Gedanke der Gemeinschaft bedient sich der Faszination des Zusammenlebens in kleinen sozialen Gebilden. Familien, Verwandtschaften, Freundschaften, Nachbarschaften und Vereine basieren auf einer genauen Kenntnis der anderen Personen. Man kennt seinen Liebespartner, seine beste Freundin, seine Kinder, seinen Sportkameraden, seinen Vereinsbruder als „Person“ mit all ihren Eigenheiten und stellt sich mehr oder minder gut auf diese ein. Im Hintergrund mögen immer wieder breit geteilte Vorstellungen durchschimmern, wie man sich als Liebespartner, Freundin, Elternteil, Kind, Sportpartner oder Vereinsmitglied zu verhalten hat. Aber das regelmäßige „Wiedersehen“ ermöglicht es, sehr spezifische, personenbezogene Erwartungen aufzubauen.
Es spricht viel dafür, dass Menschen Orte für Gemeinschaft brauchen. Die Renaissance der Vereine ist nur ein Beispiel dafür. Gerade weil sich in der modernen Gesellschaft mit der Wirtschaft, Erziehung, Politik und Gesundheit soziale Felder ausgebildet haben, in denen der Mensch nur als Rollenträger – als Käufer, Lernender, Wähler oder Patient – interessiert, besteht Bedarf nach sozialen Räumen, in denen er noch (ganzer) Mensch sein kann. Die ungebremste Sehnsucht nach Gemeinschaft in Liebesbeziehungen, Kleinfamilien, Freundeskreisen, Sportvereinen oder in einem Club ist Ausdruck dieses menschlichen Bedürfnisses.
Problematisch wird es, wenn das Gefühl der Gemeinschaft nicht alleine in diesen kleinen Kreisen erfüllt werden soll, sondern die Erfahrungen in größeren sozialen Gebilden gesucht werden. Die Verlockung ist groß, die Idee der Gemeinschaft als Leitbild auf größere Systeme zu übertragen. Die Idee der Gemeinschaft wird dann nicht mehr nur in Vorstellungen von Liebesbeziehungen, Kleinfamilien, Freundesgruppen, Verein oder Club gesucht, sondern findet sich als Zielvorstellung in Protestbewegungen, religiösen Zusammenschlüssen, ethnisch homogenen Nationen, patriarchal geführten Unternehmen, selbstverwalteten Betrieben, sozialistischen Parteien oder faschistischen Staaten. Man braucht sich, so die Vorstellung, gar nicht persönlich zu kennen, um ein Gefühl von Gemeinschaft zu empfinden.
Gefahr der „ganz großen Sache“
Bei solchen Versprechungen großer Gemeinschaften ist Vorsicht geboten. Das „Wir-Gefühl“, das evangelikale, islamische, völkische, nationalistische, sozialistische oder feministische Bewegungen bieten, ist verlockend. Sie liefern ein Gefühl der Zugehörigkeit, das sonst Liebesbeziehungen, Kleinfamilien, Freundeskreise, Vereine oder Clubs im Angebot haben. Die Identifikation mit einem übergeordneten Sinn – einem „Purpose“ – hat seinen Reiz, aber er ist auch das Einfallstor für eine Gemeinschaftsbildung über die Identifikation mit einer „großen Sache“. In letzter Konsequenz wird auch von Partnern, Kindern und Freunden verlangt, dass sie sich dieser „großen Sache“ unterordnen, wenn sie Partner, Kind oder Freund bleiben wollen.
Besonders problematisch wird es immer dann, wenn Gemeinschaften den Zugriff auf die Personen in all ihren Lebenslagen anstreben. Nähe und Geborgenheit wird in ihnen dadurch produziert, dass man außerhalb keine Rollen mehr einnehmen sollte. Man kann diese Effekte der Gemeinschaftsbildung bei marxistischen K-Gruppen, evangelikalen Sekten oder islamistischen Terrorgruppierungen beobachten. Gemeinschaften, die sich lediglich über „ähnliche Lebensziele“ oder „ähnliche ästhetische Ausdrucksformen“ bilden, haben dagegen in den wenigsten Fällen solche Totalitätsansprüche. Sie lassen problemlos zu, dass man Mitglied in mehreren Gemeinschaften sein kann.
Letztlich laufen die Anforderungen an Gemeinschaften in der modernen Gesellschaft auf ein Paradoxon hinaus. Einerseits kann ein tiefes Gefühl von Gemeinschaft nur entstehen, wenn das Gefühl vermittelt wird, sich als ganzer Mensch dauerhaft geborgen zu fühlen, andererseits droht immer die Gefahr, als Mensch komplett in der Gemeinschaft aufzugehen. Statt nach großen Gemeinschaften zu suchen, in denen man sein ganzes Leben lang und mit allen Rollen aufgehen kann, wird alternativ zwischen einer Vielzahl von Gemeinschaften gewechselt. Für den Einzelnen ist es anspruchsvoll, immer wieder neue Gemeinschaften zu finden, die das Bedürfnis nach Nähe befriedigen, aber es macht weniger abhängig von einzelnen Gemeinschaften.
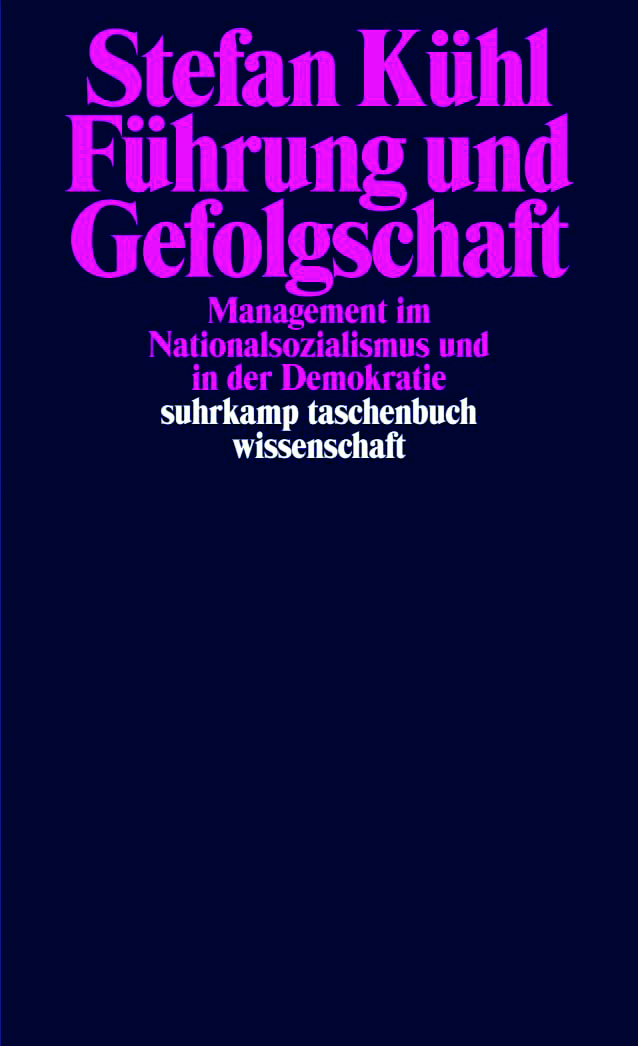
Stefan Kühl
Führung und Gefolgschaft. Management im Nationalsozialismus und in der Demokratie
Suhrkamp 2025,
265 Seiten, 24 Euro

Stefan Kühl ist Professor für Soziologie an der Universität Bielefeld und arbeitet als Organisationsberater für die Firma Metaplan.