Titelthema
Mehr Singen!

Eine Ermutigung
Vom Singen zum Verstummen
Singen befreit, Singen schafft Gemeinschaft, Singen kann glücklich machen, und Singen ist gesundheitsfördernd. Warum wird in Deutschland seit Jahrzehnten weniger gesungen? Die Ursachen dafür sind vielschichtig. Bis in die 1970er Jahre war das Singen von Volksliedern oder Wanderliedern in Familien und Schulen noch fester Bestandteil unserer Kultur. Ab den 1980er Jahren zeigen Befragungen unter anderem des Deutschen Musikrats, dass immer weniger Menschen regelmäßig singen. Das betrifft vor allem das informelle Singen in Familien und Schulen. Aber auch der Chorverband verzeichnet trotz intensiver Bemühungen einen Rückgang der Chorsängerinnen und Chorsänger, der bereits vor Corona eingesetzt, aber unter Corona dramatische Ausmaße angenommen hat.

Hören Sie hier den Artikel als Audio!
Einfach anklicken, auswählen und anhören!
In den vergangenen Dekaden hat sich ein Teufelskreis entwickelt. Die heutigen Eltern haben bereits als Kinder in den Grundschulen und später in weiterführenden Schulen weniger gesungen, auch weil manche Pädagogen das Singen für verzichtbar hielten. Als Folge gab es zu wenig junge Menschen, die sich an Musikhochschulen zu Musikpädagogen oder Chorleiterinnen und Chorleitern ausbilden ließen. Erzieherinnen und Erzieher fühlen sich überfordert, wenn sie mit den Kindern singen sollen, und so entfällt ein prägendes freudiges Erlebnis für die Kinder. Das früher noch an Grundschulen übliche Begrüßungs- und Morgenlied ist ausgestorben, da die Lehrerinnen und Lehrer sich nicht mehr zutrauen, es anzuleiten. Der Musikunterricht findet in der Grundschule sowieso nicht mehr und in den Gymnasien nur noch reduziert statt, und die curriculare Verankerung des Singens wird von Lehrplan zu Lehrplan geschrumpft. So verabschiedet sich nach und nach das Singen aus den Lebenswelten, denn Kinder, die nicht singen, tragen den Gesang auch nicht nach Hause und singen später auch nicht mit ihren Kindern.
Es gibt noch tiefer liegende Gründe für dieses Verstummen als nur den Mangel an Gesangsfachkräften: Singen, die Stimme allgemein, offenbart unsere Emotionen und ist eng mit unserem Persönlichkeitskern verbunden. Damit ist Singen auch etwas sehr Intimes, das wir ungern öffentlich zeigen wollen. Wenn wir das Gefühl haben, nicht gut ausgebildet zu sein, nicht "gut bei Stimme zu sein", haben wir große Angst, von anderen Menschen negativ bewertet zu werden. Sätze wie "Du hast ja eine dünne Stimme" oder "Du krächzt ja furchtbar" treffen uns sehr. Allein in der Dusche mag man gerne noch singen, auch weil es dort wegen der gekachelten Wände besonders gut klingt und andere es nicht hören. Singen vor anderen Menschen ist häufig mit Schamgefühlen verbunden. Singen passt nämlich nicht in eine Welt der Selbstoptimierung, der Anbetung des Oberflächlichen, der geschönten Selfies, denn Singen ist vom Wesen innerlich und ehrlich.
Wir sollten singen! Singen ist Teil unserer Natur und gehört zur genetischen Ausstattung von Homo sapiens.
Der Ursprung des Singens
Singen teilt Emotionen mit. Freude, Trauer, Sehnsucht, Gefühle der Nostalgie, der Vergänglichkeit und der Dankbarkeit werden beim Singen ausgedrückt. Gesang erzeugt diese Emotionen bei Hörerinnen und Hörern. Singen aktiviert, wenn wir müde sind, und beruhigt, wenn wir erregt sind. Singen schafft Gemeinschaft und synchronisiert Gruppen. Es liegt im Dunkeln, wann genau das Singen Teil unseres Verhaltensrepertoires wurde. Vermutlich standen am Anfang der Entwicklung bei unseren Vorfahren Affektlaute wie Stöhnen, Ächzen, Knurren, Lachen oder Weinen. Derartige Lautäußerungen besitzen nämlich viele musikalische Anteile, zum Beispiel Melodiekonturen, Klangfarben und Rhythmen. Mit der Vergrößerung des Gehirns vor rund einer Million Jahre entwickelten Homo erectus und der archaische Homo sapiens eine bewusste Kontrolle der Stimme. So wurden aus spontanen Affektlauten nach und nach kontrollierte Gesänge, die einerseits Emotionen ausdrückten, andererseits Gruppenbildungen im Sozialverband erleichterten und Menschen ein Gemeinschaftsgefühl gaben. Diese Gesänge wurden sicherlich mit Tänzen kombiniert und wurden zu festen Bestandteilen von Ritualen. Nach und nach gingen diese Gesänge in das kulturelle Gedächtnis über und wurden über Generationen vererbt. Dieser Prozess fand vermutlich vor der Entwicklung von Sprachen vor gut 400.000 Jahren statt. Auch die Individualentwicklung der Babys und Kleinkinder machen diese evolutio-näre Theorie – erst das Singen, dann die Sprache – wahrscheinlich. Die ersten Lautäußerungen von Babys sind melodische und rhythmische Gesänge, mit denen Babys ihre emotionalen Bedürfnisse äußern, und eben kein "Geschrei". Das Singen mit seinen kommunikativen und gemeinschaftsbildenden Aspekten kann somit zu Recht als "Ursprache" bezeichnet werden.
Wenn ein "Flow"entsteht
Singen wirkt vielfältig über psychologische und neurobiologische Mechanismen. Singen mit Babys und Kleinkindern reduziert Stress, schafft emotionale Bindung und Vertrauen. Es ist begleitet von vermehrter Ausschüttung des "Bindungshormons" Oxytocin, was Entspannung und ein Sicherheitsgefühl erzeugt. Gemeinsames Singen mit Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen vertieft die Gruppenbindung und schafft Vertrauen. Ein weiterer Aspekt des Singens in Gruppen ist das hohe Selbstwirksamkeitserleben. Darunter versteht man beispielsweise bei der Vorbereitung eines Chorkonzerts das Vertrauen in die eigenen Fähigkeiten, um Herausforderungen zu meistern und Hindernisse zu überwinden. Hohe Selbstwirksamkeit geht mit Optimismus, Ausdauer bei Rückschlägen und einem positiven Einfluss auf die psychische und physische Gesundheit einher.
Viele Arbeits- und Sportsituationen benötigen koordinierten Krafteinsatz. Hier kann Singen sehr gut bei der Synchron-isation von Bewegungen unterstützen. In früheren Jahrhunderten waren Matrosenlieder, Spinnerlieder oder Dreschegesänge üblich. In den individualisierten Arbeitswelten der Industrieländer haben derartige Synchronisationsgesänge keine Bedeutung mehr, aber in überwiegend bäuerlichen Gesellschaften gehören sie durchaus noch zur Praxis bei anstrengenden Ernten oder der Bearbeitung von Feldfrüchten. Singen kann hier die Entstehung von "Flow", das wohlige Eintauchen in einen Arbeitsvorgang und einen Verlust des Zeitgefühls, erleichtern. Derartige Zustände sind mit der Ausschüttung des Belohnungshormons Dopamin verbunden.
Singen ist immer auch Mitteilung von Gefühlen, also emotionale Kommunikation. Durch Singen können wir unsere Stimmung regulieren, beispielsweise aus einer schlechten Stimmung herauskommen, Stress abbauen, Selbstvertrauen und Optimismus gewinnen. Neuro-biologisch führt das gemeinsame Singen im Chor zu einer Verminderung der Ausschüttung des Stresshormons Cortisol. Interessanterweise ist dies vor allem bei Amateursängern der Fall, während in professionellen Opernchören das Singen eher mit einer Erhöhung des Stresses verbunden ist: Das ist der Preis der Professionalität, denn hier wird Singen zur Arbeit.
Die menschliche Stimme hat eine Besonderheit: Sie ist besonders geeignet, um sehr starke Emotionen, Gänsehautgefühle, auszulösen. Diese "Chill-Effekte" sind neurophysiologisch an eine Ausschüttung von körpereigenen Opioiden gebunden, sogenannten Endorphinen. Es gibt auch weitere neurobiologische Wirkungen des Singens: Singen ist Hörtraining, und Singen von Texten fördert die Gedächtnisbildung. So gehen wir davon aus, dass die großen historischen Epen, die Odyssee oder das Nibelungenlied, rhythmisiert gesungen wurden. Und schließlich ist Singen gut für die Gesundheit. Die bewusste, tiefe Atmung, die Achtsamkeit beim Singen mit dem Abbau von übermäßigen Körperspannungen und mit Regulierung des Muskeltonus, die bessere Selbstwahrnehmung helfen nicht nur beim Umgang mit Stress, sondern verbessern auch den Immunhaushalt und stärken so die Abwehrkräfte. So konnte bei Chorsängern nach einer Probe vermehrt Immunglobulin A im Speichel nachgewiesen werden. Es spielt eine wichtige Rolle bei der Abwehr von Krankheitserregern an Schleimhäuten, etwa beim Schutz vor dem Coronavirus.
Singen ist ein wichtiger Teil der Musiktherapie. Bei Erkrankungen der Atemwege und der Lungen kann Singen die Atemfunktionen und das Wohlbefinden nachhaltig verbessern. Nach Schlaganfällen der linken Hirnhälfte mit in der Folge Sprachstörungen, Aphasie, kann Singen den Wiedererwerb der Sprachkompetenz erleichtern. Diese "melodische Intonationstherapie" arbeitet mit dem neurowissenschaftlich belegten Effekt, dass bei Schädigungen der linken Hirnhälfte neuronale Netzwerke der rechten Hirnhälfte durch Singen angeregt werden, Sprachfunktionen zu übernehmen. Singen ist auch hilfreich bei Sprechstörungen, die mit der Parkinsonerkrankung ein-hergehen. Erkrankte haben oft eine sehr leise und raue Stimme. Sie neigen auch dazu, zu schnell zu sprechen. Hier kann das Singen die Stimme stärken und die Sprechgeschwindigkeit verlangsamen. Schließlich kann Singen bei Depressionen die Symptome lindern und bei der Demenz das Gedächtnis fördern, Angst reduzieren und die Lebensqualität erhöhen.
Fazit
Singen gehört zu uns Menschen. Wir sollten dieses Geschenk wieder in unseren Alltag integrieren, denn es ist ein wunderbares Mittel, soziale Erlebnisse zu schaffen, sich kreativ zu betätigen und etwas für die seelische und körperliche Gesundheit zu tun. Singen gebührt ein fester Platz in Familien, in Kindertagesstätten, Kindergärten und in Schulen. Freie Chöre, Betriebschöre, Kirchenchöre und Chorprojekte, auch neue Formate wie Rudelsingen oder Seniorensingen verdienen Unterstützung. In der Musiktherapie sollte Singen viel häufiger eingesetzt werden und einen festen Platz in der Altenpflege, im Krankenhaus und in Demenzstationen einnehmen. Lassen Sie uns dafür eintreten.
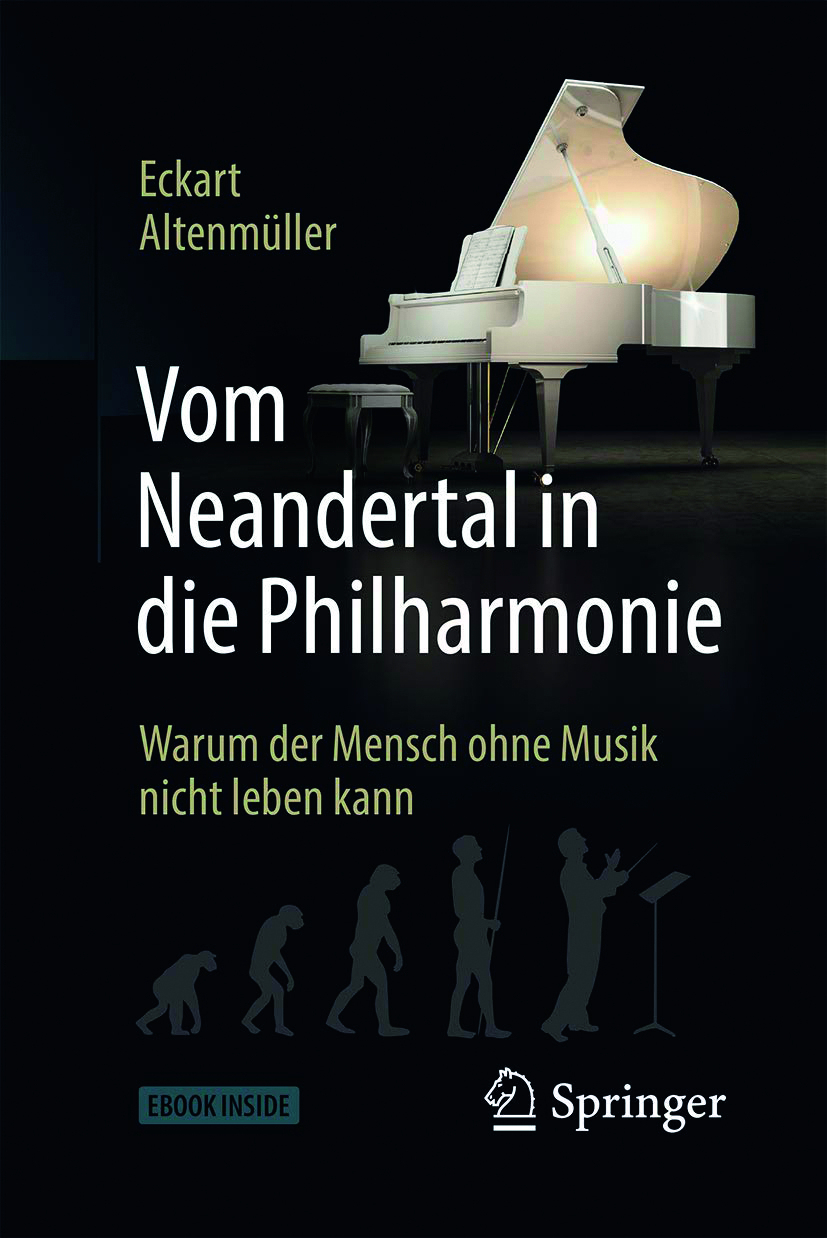
Buchtipp:
Eckart Altenmüller
Vom Neandertal in die Philharmonie:
Warum der Mensch ohne Musik nicht leben kann
2. Auflage, Springer Verlag 2026
29,99 Euro

<em><small>Copyright: HMTM Hannover</em></small>







