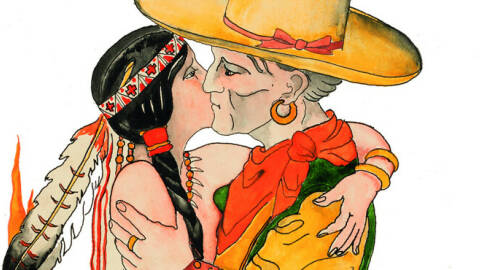Forum
Die „grandiose Alpenstraße”

90 Jahre Großglockner-Hochalpenstraße: Ein Jahrhundertbauwerk zwischen Salzburg und Kärnten mit starkem rotarischen Bezug
Mit dem Ende des Ersten Weltkriegs und dem Verlust Südtirols geht der Brenner als innerösterreichische Alpenüberquerung verloren. Die nächste ist der Tauernübergang, 156 Kilometer weiter östlich. Also sucht man nach einer weiteren Möglichkeit dazwischen.
1922 ist der Salzburger Rudolf Ramek (Bundeskanzler 1924–1926, sowie 1926 Gründungsmitglied und 1928/29 Präsident des RC Salzburg) einer der Ersten, der sich leidenschaftlich für den Ausbau des Fremdenverkehrs einsetzt. Er hat die Idee einer „grandiosen Alpenstraße“ – auf einem Weg, den bereits Kelten und Römer genutzt haben.
1924 wird der 1887 in Wien geborene Ingenieur Franz Wallack von der Kärntner Landesregierung mit der Planung einer Straße beauftragt. 1925 unternimmt er eine mehrmonatige Studienreise, bei der er 43 Alpenstraßen in Italien, der Schweiz und Frankreich inspiziert. Die Regierung unterstützt das Projekt, aber aus finanziellen Gründen zunächst nur ideell.
1928 wird Oberbaurat Franz Wallack Gründungsmitglied des RC Klagenfurt. Im Juni hält er im Club einen Vortrag zum Thema „Projekte über Straßen, über die Hohen Tauern“. Im August schlägt der Gründungsvater des RC Wien, Oskar Berl, vor, die Straße als „Rotary-Road“ zu finanzieren, doch Rotary International lehnt ab.

Harte Arbeit, lange Tage
Besondere Unterstützung erfährt das Projekt vom Salzburger Landeshauptmann (1922–1938) und leidenschaftlichen Autofahrer Franz Rehrl. Er sieht es als Komplementärprojekt zu den Salzburger Festspielen. Den Festspielgästen – zumeist wohlhabende Automobilisten – soll auch eine spektakuläre Ausflugstrecke geboten werden.
Die Weltwirtschaftskrise von 1929 liefert paradoxerweise den entscheidenden Schub: Eine Sonderfinanzierung soll Arbeitsplätze schaffen, und die Glocknerstraße bietet genau das. Die Verpflichtung, zu 80 Prozent Arbeitslose zu beschäftigen, hat aber auch gravierende Nachteile. Wallack beklagt in seinen 1949 erschienen Erinnerungen, dass die ihm zugewiesenen „Friseure, Kellner und andere Erwerbstätige, die noch nie eine Schaufel in der Hand gehabt hatten, vollkommen unzweckmäßig gekleidet und meist auch unterernährt waren“.
Im August 1930 beginnen die Bauarbeiten. Es kann wetterbedingt nur während fünf Monaten pro Jahr gebaut werden. Bis zu 2400 Arbeiter sind gleichzeitig beschäftigt. Die Bedingungen auf Österreichs höchster Baustelle sind hart. Lange Arbeitstage, sauerstoffarme Hochgebirgsluft und unberechenbares Wetter setzen den Männern zu. Die schweren Maschinen müssen in Teilen zu den Baustellen getragen und dort zusammengebaut werden. Die Arbeiter sind in großen Holzbaracken mit Küchen untergebracht, die von Baulos zu Baulos abgebaut und wieder aufgebaut werden. Demgegenüber steht eine lukrative Entlohnung, Krankengeld bei Bedarf und eine Schlechtwetterregelung. Arbeiter erhalten auch dann einen Lohn, wenn das Wetter die Arbeit unmöglich macht – eine damals außergewöhnliche Regelung. Sie errichten in 26 Monaten von 1930 bis 1935 satte 50 Kilometer Bergstraße, 67 Brücken, zwei Tunnel und Österreichs höchstgelegenen Parkplatz auf 2571 Meter Seehöhe mit Blick auf 37 Dreitausender, daneben noch Mauthäuser, Tankstellen, Straßentelefone, Gaststätten und Toiletten.

Mit Champagner und Jungfrau
1931 wird die Großglockner-Hochalpenstraßen-Aktiengesellschaft (Grohag) gegründet. Hauptaktionär ist die Republik Österreich. In diesen Jahren fließen 14 Prozent des gesamten österreichischen Straßenbaubudgets in diese Straße.
Am 3. August 1935 ist die feierliche Eröffnung. 20.000 Menschen kommen, unter ihnen der Bundespräsident Wilhelm Miklas, einige Regierungsmitglieder und zahlreiche Prominente, unter anderen Festspielgründer Max Reinhardt. Das internationale Medieninteresse ist enorm.
Am Tag nach der Eröffnung findet das erste Autorennen statt. Ein Zeitzeuge berichtet über die Rennwagen: „Fahren sie entlang der geraden Bergstrecken, hört sich dieses schmetternde Rattern ihrer Motoren wie das Geknatter schwerer Maschinengewehre an, das dann beim Passieren der vielen Kurven in ein wimmerndes Heulen zerfließt.“
Am 21. Jänner 1936 hält Wallack neuerlich einen Vortrag im RC Klagenfurt. Er selbst hat den Glockner im letzten Jahrzehnt 256 Mal überquert, anfangs zu Fuß, später mit dem Motorrad. Zu seiner 250. Überquerung hat er „sich das Kredenzen eines Glases Champagner durch eine Ehrenjungfrau aus dem Mölltale erbeten. Man hat beides pünktlich herbeigeschafft, Champagner und Jungfrau“, steht exakt so im Wochenbericht.
Kurz darauf, am 17. März 1936, ist zu lesen, „dass unser Rot. Wallack im RC Salzburg nunmehr zum Ehrenmitglied designiert wurde. (Zwischenruf aus dem Auditorium: ‚Wallack vorläufig noch in unserem Besitz …‘)“ Doch Wallacks beruflicher Lebensmittelpunkt ist nun Salzburg.
Die Straße wurde ein Erfolg. 1938 befahren sie knapp 400.000 Menschen in 75.000 Pkw und 5300 Autobussen.
Franz Wallack ist in den Jahren des Austrofaschismus Mitglied der Vaterländischen Front und wird in der NS-Zeit Mitglied des Nationalsozialistischen Kraftfahrkorps. Er stellt zweimal einen Antrag auf NSDAP-Mitgliedschaft. Beide werden abgelehnt, er gilt wegen seiner Mitgliedschaft bei Rotary als politisch unzuverlässig. Bemerkenswert ist, dass ebendiese Mitgliedschaft ihm nach dem Krieg hilft, rasch aus den Registrierungslisten gestrichen zu werden.

mussten hunderte Männer die Straße von den Schneebergen befreien.
Zu steil für die Trabis
Anfang 1950 wird der RC Salzburg wiedergegründet. Mit dabei ist auch Wallack. Am 25. Mai hält er einen Vortrag, über den im Wochenbericht zu lesen ist: „Und dann kam Hofrat Wallacks Vortrag, den man, was Thema, Form und Dauer betrifft, nur als beispielgebend bezeichnen kann.“
1953 entwickelt er einen Rotationspflug für die Schneeräumung, welcher „System Wallack“ genannt wird. Diese Kombination aus Schneefräse und Pflug schafft die Tagesleistung von 370 Schauflern. Die Rotationspflüge sind bis heute (!) alljährlich im Einsatz und schneiden die Straße von sechs bis zwölf Meter hohen Schneewächten frei.
Und selbst das Logo mit dem großen G, das sowohl die Straße mit einem Auto als auch den Großglockner umschließt, entwirft Wallack in den 30er Jahren selbst.
1959/60 ist Wallack Präsident des RC Salzburg. Er bleibt bis zu seinem Tod am 31. Oktober 1966 Vorstand der Grohag. Im Wochenbericht ist im Nachruf zu lesen: „Rot. Wallack hat die Straße geboren, sie großgezogen und ist eigentlich die Mutter davon.“
Ab 1981 wird die Idee eines länderübergreifenden Nationalparks Hohe Tauern Realität. Er ist eines der größten Naturschutzgebiete in Mitteleuropa und geht zurück auf eine Schenkung von 4000 Hektar, die der Industrielle Albert Wirth (Gründungsmitglied des RC Villach 1932) schon 1918 dem Alpenverein gemacht hat, der ihn als Naturschutzpark erhalten sollte.
Nach dem Fall des Eisernen Vorhangs wird die Großglocknerstraße zum Ziel vieler Reisender aus Osteuropa. 1992 rollen gezählte 335.614 Fahrzeuge, darunter viele Trabis und Wartburgs, über die Straße. Doch viele sind mit ihren 26 PS zu schwach und schaffen manches Mal die Kehren nicht. Die Streckenaufsicht empfiehlt, sie im Rückwärtsgang zu nehmen. Der ÖAMTC richtet einen eigenen Stützpunkt ein, um kostenlos Bremsen, Kupplung und Kühlwasser auf Tauglichkeit für die Bergstraße zu überprüfen.

Das größte Denkmal Österreichs
Heute ist die Grohag wieder in Salzburger rotarischer Hand: Generaldirektor Johannes Hörl und Hand-lungsbevollmächtigter Dietmar Schöndorfer leiten das Unternehmen. Im Büro – seit 1937 in der Rainerstraße 2 in der Stadt Salzburg – gibt es ein eigenes Großglockner-Wallack-Archiv. Die Region Großglockner ist seit Anfang der 2000er Jahre international anerkannter Nationalpark, die Straße seit zehn Jahren größtes Denkmal Österreichs und auf der Tentativliste zum Unesco-Welterbe. Die Grundlagen für diese Symbiose zwischen Natur und Technik hat der visionäre Rotarier Franz Wallack geschaffen.
Mit großem Dank für die Unterstützung bei der Quellensuche: André Hensel (RC Villach), Erich Lobensommer (RC Bad Ischl), Johannes Hörl (RC Salzburg-Paracelsus), Dietmar Schöndorfer (RC Salzburg-Altstadt), Rudolf Zrost (RC Salzburg)

Claus Bruckmann, RC Wien-Gloriette, ist Journalist in der ORF-Parlaments-redaktion und Autor. Für das Rotary Magazin berichtet er jeden Monat aus dem Distrikt 1910.
Foto: Lukas Grafleitner