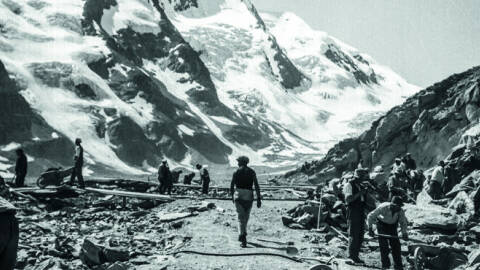Titelthema
"Unsere Idee ist einfach, aber radikal"

Tim Janßen und seine NGO "Cradle to Cradle" setzen sich für eine echte Kreislaufwirtschaft ein, bei der kein Müll mehr anfällt. Im Gespräch erklärt er, warum das längst keine utopische Spinnerei mehr ist.
Herr Janßen, Cradle to Cradle (C2C), frei übersetzt "von der Wiege zur Wiege", beschreibt ein Kreislaufmodell, das den Menschen als Nützling sieht, nicht als Schädling. Der Mensch hinterlässt also keinen negativen Fußabdruck, sondern einen positiven. Wie kann das gehen?
Das gelingt, indem wir die Dinge völlig anders machen, als wir es gewohnt sind. Durch C2C wird es auch weiterhin nützliche Produkte und Dienstleistungen geben. Was sich aber verändern wird, ist deren Qualität. Wir benötigen dafür auch andere Geschäftsmodelle und müssen Produkte von vornherein so entwickeln, dass sie eine richtig hohe Qualität haben, also materialgesund und kreislauffähig sind. All diese Produkte werden in Produktion und Nutzung dazu beitragen, dass wir unsere Lebensgrundlage erhalten und nicht zerstören. Das hört sich heute für manche utopisch an, aber das liegt einzig und allein daran, dass es noch nicht in der Breite umgesetzt wird. Aber es gibt viele Innovatoren, die zeigen, dass es geht, und das müssen wir jetzt groß ausrollen.
Aber der Mensch muss doch atmen, essen, Kleidung tragen und konsumieren.
Unser Ansatz geht von einer Fabrik aus, aus der das Produktionswasser sauberer herauskommt, als es hineinfließt, eine Fabrik, die mehr Energie erzeugt, als sie braucht. Eine Fabrik, die dazu beiträgt, dass es den Menschen, die in ihr arbeiten, gut geht, und die Produkte entwirft und produziert, die nie zu wertlosem Müll werden. Solche Fabriken erhalten Rohstoffe, machen Menschen nicht krank und produzieren keinen Abfall. Wenn wir es schaffen, unsere Wirtschaft dahingehend zu verändern, wird jedes Produkt, das wir kaufen, zu dieser Veränderung beitragen. Damit wird auch der Käufer zu einem Changemaker.
Nennen Sie doch mal ein praktisches Beispiel.
Ein sehr plakatives Beispiel sogar: Ein Textilgroßhändler, der global agiert und viele C2C-Produkte vertreibt, hat es vor Jahren schon in einer T-Shirt-Kollektion gezeigt, die in zigfacher Millionenauflage in Bangladesch produziert wurde. Dieser Händler hat vorher Fabriken ausfindig gemacht, die bereit waren, vieles umzustellen – auf Arbeitsbedingungen zu achten, auf eine faire Entlohnung, völlig andere, ungiftige Farbstoffe zu verwenden, andere Garne zu verwenden. Nur noch Biobaumwolle, das heißt, es geht schon auf dem Acker los. Und trotzdem sollte in hoher Stückzahl, zu niedrigen Kosten und damit wettbewerbsfähig produziert werden. Da ist das Wasser wirklich sauberer aus der Fabrik rausgeflossen, als es reingeflossen ist. Diese Textilien sind dann hier in Europa in den Handel gekommen, und der Händler hat dafür auch ein Rücknahmesystem eingeführt. Das heißt, der Kunde bekommt einen Coupon für den nächsten Einkauf, wenn er aufgetragene Textilien zurückbringt. Zumindest das bieten heute schon immer mehr Handelsketten an. Denn heute kann man Baumwollfasern, ähnlich wie Papier, zerkleinern und zu neuen Baumwollfasern verarbeiten. Die Fasern sind kreislauffähig. Natürlich gibt es entlang einer solchen globalen Liefer- und Handelskette noch einige eingetrübte Themen, etwa die Logistik, aber daran arbeiten wir.
Und diese T-Shirts waren dann ein paar Euro teurer?
Gar nicht. Gleicher Preis, absolut massenmarkttauglich. Wir haben mit den Leuten aus der Innovationsabteilung gesprochen, und die sagten, das, was mehr gekostet hat, war, sich zum ersten Mal mit dem Thema zu beschäftigen. Die Produktionskosten sind nicht gestiegen, aber natürlich mussten die sich einmal in das Thema reinfuchsen.
Um welchen Textilgroßhändler handelt es sich?
Das war das Beispiel der Firma C&A, aber es gibt viele Textilhersteller, die mittlerweile ihre Produktion umstellen: Trigema, G-Star, aber auch eine Pyjamakollektion der Schwarz-Gruppe für Lidl ist zu nennen. Das waren die ersten Textilien, die mit einer biologisch abbaubaren Offset-Druckfarbe bedruckt wurden. Die Farbe wurde damals gemeinsam mit CHT aus Tübingen entwickelt und seitdem kann man auch Textilien nach C2C bedrucken.
Schauen wir einmal in die Bauwirtschaft: Natürlich kann man Steine, Wände und andere Baustoffe wiederverwenden, aber sie müssen doch einmal initial produziert werden und kommen irgendwann an ihr Lebensende.
Das eine sind Bestandsbauten, das andere Neubauten. Wir haben hier in unserem C2C-Lab in Berlin gezeigt, was man aus dem schlimmsten Plattenbau machen kann, wenn er mit gesunden und kreislauffähigen C2C-Baustoffen saniert wird. Wir haben Schönheit und Nachhaltigkeit zusammengebracht. Wir haben geschaut, welche Materialien wir noch verwenden können, was lässt sich ausbauen, was lässt sich an den Hersteller zurückgeben? Gibt es jemanden, der sich um das Recycling kümmert? Dann haben wir alle Materialien mit digitalen Datenpässen versehen, Decken, Böden, Wände, Aufbauten, Wandfarben, das ganze Interieur und Mobiliar. Dadurch wissen wir genau, was verbaut wurde. So funktioniert es im Bestandsbau. Bei Neubauten beschäftigen sich mittlerweile unzählige Akteure mit dem Thema, unter anderem das größte Architekturbüro Deutschlands, HPP-Architekten, das gerade das Holzhybrid-Bürogebäude "The Cradle" gemeinsam mit dem Projektentwickler Interboden in Düsseldorf finalisiert hat. Wir haben einen Bauleitfaden für die öffentliche Hand veröffentlicht, denn immer mehr Kommunen beschäftigen sich mit dem Thema. Gerade läuft ein Wettbewerb zur kreislauffähigen Sanierung des Hauptgebäudes der RWTH Aachen, den wir begleiten. Im Bausektor tut sich unheimlich viel, aber er bietet ja auch unheimlich großes Potential. 60 Prozent des gesamten Abfalls fallen im Baubereich an. Wenn wir da jetzt viel umstellen, lässt sich wirklich etwas bewirken. Ich bin mir sicher, dass in drei bis fünf Jahren jeder große Bauträger – ob privat oder öffentlich – mindestens ein C2C-Pilotprojekt baut. Wer das Thema jetzt nicht begreift, wird womöglich vom Markt verschwinden.
Was sind eigentlich materialgesunde und kreislauffähige Baustoffe?
Kreislauffähig bedeutet, man muss es demontierbar gestalten, das heißt, die Verbindung der Materialien ist entscheidend. Schraub- und Steckverbindungen, modular und trennbar. Wenn geklebt wird, müssen wir reversible Klebstoffe nutzen, die sich leicht lösen und biologisch abbauen lassen. Man muss aber immer darauf achten, dass man sie sortenrein trennen kann. Und in der Chemie der Materialien darf nichts Giftiges enthalten sein. Viele Hersteller von Bodenbelägen verändern derzeit ihre Rezepturen, die Art, wie Materialien beschaffen sind. Es gibt ganz neue Holzbehandlungsmittel, auch die Beschaffenheit von Dämmmaterialien und Wandfarben ändert sich.
Schauen wir auf einen anderen Bereich, der für alle Menschen relevant ist: die Mobilität. Der Verkehrssektor ist in Deutschland für 20 Prozent der Treibhausgasemissionen verantwortlich. Feinstaub wird produziert, Mikroplastik freigesetzt, Autokomponenten müssen produziert und transportiert werden. Wie kann hier aus einer stark negativen Ökobilanz eine positive werden?
Zunächst einmal spielt die Elektrifizierung eine Rolle. Wir sehen, wie viel effizienter wir uns von A nach B bewegen können, wenn wir keine petrochemischen Energieträger verbrennen. Damit lassen sich noch keine Transatlantikflüge realisieren, weshalb auch synthetische Kraftstoffe noch ihre Berechtigung haben. Dafür brauchen wir große Mengen erneuerbarer Energien, und dazu brauchen wir kreislauffähige Anlagen, die solche Energien herstellen. Und das ist auch ein Knackpunkt für die Speicherung. Wir haben im Moment noch kein überzeugendes Modell zum Recycling von Batteriezellen oder Leichtbaustoffen. Das ist ein Thema für Windkraftanlagen, aber auch im Automobilbau. Daran forschen alle großen Automobilhersteller und Batteriezellenhersteller wie CATL. In letzter Konsequenz geht es aber auch um das Recycling von Autoreifen, die heute Feinstaub produzieren. Da sind wir mit Continental im Gespräch, Reifen zu produzieren, deren Material eben nicht langlebig ist und viel Feinstaub freisetzt, sondern die mit einer biologisch abbaubaren Schicht versehen sind und sich in die Umwelt abreiben dürfen.
Halten Sie es für aussichtsreich, einem 70-Jährigen, der auf dem Land wohnt, klarzumachen, dass er seinen SUV abgeben und sich lieber an die Bushaltestelle stellen soll?
C2C heißt auch Vielfalt. Es ist völlig klar, dass ein städtischer Raum wie Berlin anders funktioniert als ein ländlicher Raum in Brandenburg. Natürlich spielt der öffentliche Personennahverkehr eine große Rolle, aber wir möchten ja niemanden dazu zwingen, sein Auto abzugeben. Entscheidend ist, dass Autos so gebaut sind, dass sie temporäre Materiallager sind, die von A nach B rollen, deren Materialien erhalten bleiben. Es ist also weniger wichtig, wer wie lange ein Auto hält, denn das Material verbraucht sich in diesem Szenario nicht, sondern bleibt dem Kreislauf erhalten. Darum führt das nicht in eine Verbots- oder Verzichtsdiskussion, sondern wir sorgen dafür, dass wir wertvolle Rohstoffe gar nicht mehr verlieren.
In welchen Wirtschaftsbereichen ist es besonders anspruchsvoll, lineare Produkte zu ersetzen?
Sehr herausfordernd ist es im Bereich elektronischer Bauteile, weil man da sehr viele kleine Komponenten hat, die zum Teil in geringer Stückzahl hergestellt werden. Das lässt sich nicht manuell verändern, sondern ist hoch technologisiert.
Ich nehme an, auch Sie benutzen ein Smartphone.
Klar. Aber was wir hier im C2C-Lab zeigen, sind modular aufgestellte elektronische Produkte, zum Beispiel Bluetooth-Kopfhörer, bei denen man einzelne Komponenten austauschen kann. Das klappt auch mit Mobiltelefonen, zum Beispiel von Fairphone und Shiftphone, wo Kunden einzelne Module selbst austauschen können. Das sind gute Lösungen auf der Zwischenstrecke, aber natürlich brauchen wir auch in der Elektronik ein vollständiges Bauteilerecycling.
Aufgrund der Verflechtung der globalen Produktions- und Verbrauchssysteme setzen Ihre Überlegungen ja eine globale Umstrukturierung von Produktion und Konsum voraus.
Die Frage ist: Wer trägt wie viel Gestaltungswille und Verantwortung? Schauen Sie in die Supermärkte: Da wird man erschlagen von Angeboten. Es gibt vielleicht eine kleine Konsumenten-Avantgarde, die alle Nachhaltigkeitslabels überblickt. Es geht auch weiterhin nicht ganz ohne den Konsumenten, aber eigentlich treiben die Unternehmen die Entwicklung voran. Wir leben in einem rohstoffarmen Land und natürlich gibt es immer noch globale Verteilungskämpfe. Unternehmen, die das zusammendenken, haben klare Wettbewerbsvorteile.
Zur Person:Tim Janßen beschäftigt sich seit über zehn Jahren mit der Transformation der linearen Wirtschaft in eine geschlossene Kreislaufwirtschaft nach Cradle to Cradle. Der studierte Betriebswirt ist geschäftsführender Vorstand der 2012 von ihm mitgegründeten Cradle to Cradle NGO.
Ein gutes Beispiel dafür sind die Reinigungsprodukte der Marke Frosch. Kennt jeder. Kaufen viele Menschen, ohne zu wissen, dass es sich um C2C-Produkte handelt. Dahinter steckt ein Mittelständler aus Mainz, für den es selbstverständlich ist, auch die Flaschen zu 100 Prozent zu recyceln. Die können natürlich ganz anders in den Markt gehen, als andere Hersteller. Ich denke, die Konsumenten werden diese Standards immer stärker fordern, die Industrie wird ein handfestes betriebswirtschaftliches Interesse daran haben, die Kundenwünsche zu befriedigen, und die Politik unterstützt diese Entwicklung auch. Ist doch klar: Wenn Unternehmen von ihren Kunden keinen Müll, sondern Rohstoffe zurückbekommen, entsteht eine Gewinnmarge. Darin liegen neue Erlösmodelle.
Nun werden aber nur wenige Produkte an ein und demselben Ort hergestellt, gekauft und recycelt, was zu einem enormen Ressourcentransfer rund um den Globus führt.
Vor dem Hintergrund der globalen Lieferketten ist die Frage: Wie sammeln, sortieren, trennen und recyceln wir diese Materialien? Da gibt es große Kontroversen, denn es gibt ja immer noch große Abfallströme, die ins Ausland gehen. Das hat etwas mit Regulierung zu tun, das zeigt aber vor allem, dass wir uns in diesen neuen Märkten darauf einstellen müssen. Dort brauchen wir Recyclinganlagen und Logistikakteure, die die Materialien sammeln und trennen. Überall werden derzeit neue Recyclingkapazitäten aufgebaut, auch in Europa. Darum sehe ich keine Gefahr, dass Materialien wieder dorthin zurückgeliefert werden, wo sie produziert oder abgebaut wurden. Da entstehen gerade neue Business-Modelle.
Die ganze Idee basiert aber doch darauf, dass die Konsumenten mitmachen. Wie wollen Sie alte Verhaltensmuster aufbrechen? Verhaltensänderungen sind immer schwer herbeizuführen. Da müssen Sie richtig das Mindset verändern.
Wir wollen die Menschen begeistern, nur so entsteht Aufbruch. Wir müssen Lust auf den Wandel machen. Das geht nicht mit dem erhobenen Zeigefinger und dem Blick zurück. Wir zeigen, dass es nicht teurer wird, sondern einfach besser. In den letzten Jahren wurde diese Debatte falsch geführt, es ging um Verzicht und um Ängste. In Wirklichkeit geht es um bessere Produkte, die nicht krank machen. In unserem Beirat sitzt die Vorsitzende der IG Metall, ein großer Partner der C2C-Wirtschaft. Die IG Metall ist echt ein Treiber von C2C, denn sie hat verstanden, dass es um die "green Jobs" von Morgen geht. Das Wirtschaften von Morgen beeinflusst natürlich den Wirtschaftsstandort Deutschland.
Wie stellen Sie sicher, dass eine Kreislaufwirtschaft nach C2C-Kriterien allen nützt, also dass es nicht mehr Verlierer als Gewinner gibt?
Wir betrachten den Wandel holistisch, also keinen Abfall mehr zu produzieren, Rohstoffe immer wieder neu nutzbar zu machen, Materialien zu verwenden, die nicht giftig sind, sondern gesund, auf soziale Standards in der Produktion zu achten, Luft- und Bodenqualität im Blick zu behalten, Produktionsgewässer sauber zu halten. Konzeptionell bleibt kein Punkt unberücksichtigt. Es kommt ja nicht von ungefähr, dass die Kreislaufwirtschaft als einer der sechs Punkte in der EU-Taxonomie hinterlegt ist. Sie ist fester Bestandteil von Baustandards, sie ist Teil des Green Deals, es gibt einen Circular Economy Action Plan der EU, Deutschland gibt sich gerade seine Nationale Kreislaufwirtschaftsstrategie. Dennoch denken zu wenige Akteure umfassend genug über die Qualität der Kreislaufwirtschaft nach. Darum haben wir bei der C2C-NGO Partner, die es ernst meinen, die nicht nur irgendwie ein bisschen was "zirkulär" machen wollen. Darum gibt es auch ein C2C-Zertifizierungslabel. Ich höre aus der Wirtschaft, dass die Umsetzung sehr anspruchsvoll ist, weil im Zuge der Zertifizierung sehr viel geprüft wird. Wenn ein Unternehmen dann C2C-zertifiziert ist, hebt es sich dadurch deutlich von der Masse ab.
Wer prüft das?
Das macht eine gemeinnützige Stiftung mit Sitz in den USA und in den Niederlanden. Deren Auditoren prüfen nach einem 100-seitigen Kriterienkatalog und vergeben das Siegel.
Wie alle anderen Systeme kann auch die Kreislaufwirtschaft Versprechungen machen, die nicht eingehalten werden können. Wie stellen Sie also sicher, dass Interessensgruppen der Industrie und Verbraucher nicht in die Irre geführt werden?
Wir selbst zertifizieren nicht, sondern wir betreiben Bildungsarbeit und informieren. Wir bringen Wirtschaft, Politik und Gesellschaft auf vielen Veranstaltungen zusammen. Das sind Bildungskonferenzen, unser C2C-Kongress, Diskussionsrunden, wir erstellen Schulmaterialien, wir sind an internationalen Konferenzen beteiligt, wir mischen politisch mit. Überall stellen wir die Fragen: Wie machst du es? Warum machst du es nicht anders? Und wir ermächtigen immer mehr Menschen dazu, diese Fragen selbst zu stellen.
In der Tat ist die C2C-NGO in der großen Politik angekommen. Claudia Roth war naturgemäß von Anfang an dabei, zuletzt haben Sie aber auch mit Friedrich Merz und parteiübergreifend mit anderen Akteuren gesprochen. Haben Sie das Gefühl, dass es alle ernst meinen, oder haben einige einfach die Chance erkannt, ihren Narrativ von "Kompromissen und Zwängen" auf "Synergien und Chancen" umzustellen?
Ich war positiv überrascht von dem, was die CDU/CSU-Fraktionsspitzen auf ihrem Kongress zum Thema gesagt haben, auch Friedrich Merz. Die CDU/CSU ist spät dran, aber jetzt kann sie ja vieles richtig machen. Grundsätzlich hoffe ich, dass jede Bundesregierung das Thema stärker forciert. Die gegenwärtige Regierung handelt spät, aber immerhin, denn eine nationale Kreislaufwirtschaftsstrategie war ja Teil des Koalitionsvertrags. Mal sehen, was noch getan werden kann, ehe nächstes Jahr wieder gewählt wird. Egal, ob eine liberal getriebene Wirtschaftspolitik der FDP, eine sozial getriebene der SPD, eine umweltorientierte der Grünen oder eine Wirtschaftspolitik der Union – jede demokratisch getriebene Kraft kann in unserem Konzept Punkte finden, die in ihre politische Agenda passen. Gerade weil es ein Konzept ist, das sehr stark aus der Wirtschaft kommt, finde ich es erstaunlich, dass die konservativen Kräfte sehr lange gebraucht haben, das zu realisieren. Das war einmal anders. Friedrich Merz hat es selbst gesagt: Es ist eigentlich ein altes Thema. Wie auch immer eine Regierungskonstellation 2025 aussieht: Ich habe den Eindruck, dass wir uns einbringen können und gehört werden. Das ist auch nötig, denn andere Länder in Europa sind weiter als wir: die Niederlande, Dänemark, Finnland. Aber wir glauben an die Innovationskraft des deutschen Mittelstands.
Sehen Sie Ihre Idee von der Kreislaufwirtschaft als eine Art Neustart des Kapitalismus?
Nein, wir wollen eigentlich nur das Selbstverständliche verankern. Wir sind nicht im systemischen Umsturz. Natürlich wird sich viel verändern, aber es fühlt sich nicht nach Revolution an. Wir wollen mit allen zusammen einfach nur den logischen nächsten Schritt gehen und unsere Existenzgrundlage sichern.
Ihre Idee ist trotzdem radikal, auch wenn Sie nicht so marktschreierisch und dogmatisch rüberkommen wie zum Beispiel "die letzte Generation".
Wenn wir schauen, wo wir heute stehen, ist die Idee, keinen Müll mehr zu produzieren, absolut radikal. Aber wenn wir in die Natur schauen, ist diese Idee völlige Normalität. Zwischen diesen zwei Polen bewegen wir uns und sie zeigen das Spannungsfeld perfekt auf.
Sie sind seit einigen Jahren Mitglied im RC Berlin-Brandenburger Tor. Ecken Sie mit Ihren Ideen gelegentlich auch mal an?
Ich nehme das so wahr, dass ich mit einer großen Neugierde im Club aufgenommen wurde. Ich schätze die großen Erfahrungswerte der Clubfreunde sehr und freue mich über unterschiedliche Perspektiven auf das Thema. Unterschiedliche Berufsbilder, reiche Erfahrungen, unterschiedliche Perspektiven – genau das brauchen wir. Mein Anliegen ist es ja, zu verstehen, wie wir Menschen überzeugen können. Im Kontext Rotary wird schnell verstanden, dass wir nicht "Stopp" rufen, sondern "Start". Unsere Idee ist einfach, aber radikal.
Das Gespräch führte Björn Lange.
Über die C2C-NGO:
Die 2012 gegründete Cradle to Cradle NGO beschäftigt heute 40 Mitarbeiter in Berlin, davon 30 hauptamtliche. Darüber hinaus profitiert sie von einem wachsenden Netzwerk von derzeit rund 1000 ehrenamtlichen Aktiven in Deutschland, Österreich und der Schweiz mit Büros in Wien und Zürich. Sie steht im Austausch mit den 35 Mitgliedern ihres C2C-Wirtschaftsnetzwerks.