Titelthema
Niemals kreisförmig

Plastik ist einer der wichtigsten Werkstoffe unserer Zeit – und einer der umstrittensten. Die Kreislaufwirtschaft kann die Probleme nicht lösen. Im Gegenteil!
Der Deckel ist nicht mehr wegzubekommen. Egal, wie sehr sich die Hand um die Wasserflasche windet, der Deckel geht nicht ab. Auch von der ColaFlasche ist er nicht zu lösen. Ein Plastikring hält den Deckel an den Trinkflaschen fest. Die „Tethered Caps“ irritieren die Verbraucher, aber sie dienen einem höheren Gut: Sie sollen der Kreislaufwirtschaft helfen.

Hören Sie hier den Artikel als Audio!
Einfach anklicken, auswählen und anhören!
Die Idee: Kein Plastikdeckel soll mehr achtlos auf dem Boden landen oder in der falschen Mülltonne und in der Verbrennungsanlage enden. Stattdessen sollen die Deckel mit der Flasche in den Pfandautomaten und zur Recyclinganlage gelangen. Damit Deckel wie Flasche verwertet werden.
Seit Kunststoffe vor etwa einem Jahrhundert in unser Leben kamen, machen sie es einfacher, haben Fortschritt gebracht. Elektroautos, der Ausbau der erneuerbaren Energien, medizinische Präzisionswerkzeuge, nichts davon wäre ohne Plastik möglich. So gesehen leben wir im Plastikzeitalter.
Wirtschaft und Konsum sind abhängig davon, dass Plastik so vielseitig und günstig ist – und im Gegensatz zu anderen Rohstoffen quasi unbegrenzt verfügbar. Wenn Bevölkerung und Wohlstand wachsen, steigt der Plastikverbrauch. Bis 2050 könnte sich die globale Plastikproduktion noch verdreifachen, prognostizierte die Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD).
Schwächelnder Recyclingweltmeister
Dabei sind die Folgen schon heute kaum kontrollierbar. Gut 350 Millionen Tonnen Plastikmüll fallen jedes Jahr an, schätzt die OECD. Nur neun Prozent davon landen in Recyclinganlagen. Ein weitaus größerer Teil endet auf Deponien, selbst in wirtschaftsstarken Staaten wie den USA oder dem Vereinigten Königreich. Plastikmüll wird in Zementwerken oder Hinterhöfen verbrannt, erzeugt dabei Giftstoffe und Emissionen. 22 Millionen Tonnen Plastikmüll enden in Umwelt und Meer. Die Kosten dafür trägt die Gesellschaft, nicht die Plastikindustrie.
Die Kreislaufwirtschaft gilt als die Lösung dieser Probleme. Sie soll Abfall in Rohstoffe verwandeln. Auch Plastik soll im Kreis geführt und immer und immer wieder verwertet werden. Deutschland gilt als ein Vorreiter. Die Deutschen trennen Müll, seitdem vor über 30 Jahren der Grüne Punkt eingeführt wurde. Sie sind stolz auf den Titel des Recyclingweltmeisters, kaufen Einkaufstaschen und T-Shirts, die versprechen, dass sie einst Plastikflaschen waren. Und sie nehmen dafür auch hin, dass sie ihre Flaschendeckel nicht mehr abschrauben können.
Nur: Bisher hat die Kreislaufwirtschaft die Hoffnungen nicht erfüllt, auch in Deutschland nicht. 21 Millionen Tonnen hat die deutsche Plastikindustrie 2021 produziert, rechnete die Beratung Conversio im Auftrag der Kunststoffverbände aus. Trotz gesetzlicher Recyclingquoten: Nur in zwölf Prozent ersetzt Rezyklat aus Altplastik neu produzierten Kunststoff. Und es ist unwahrscheinlich, dass die befestigten Deckel daran viel ändern können.
Wer verstehen will, warum das so ist, muss tiefer eintauchen in die Lieferkette von Kunststoffen. „Das Plastik“ gibt es nicht. Im Supermarkt finden sich rund 50 Plastiksorten. Jeder dieser Stoffe hat unterschiedliche physikalische und chemische Eigenschaften. Was sie gemein haben, ist, dass ihre Struktur auf sich vielfach wiederholenden Bausteinen mit Kohlenwasserstoffketten aufbaut.
Selbst wenn Wissenschaft und Industrie heute theoretisch Plastik aus Zucker oder Stärke herstellen könnten – in der Realität geschieht das kaum. Über 99 Prozent des Plastiks auf der Welt entstehen aus Erdöl und Erdgas. Die größten Kunststoffhersteller der Welt sind die Ölkonzerne: ExxonMobil, Sinopec, Dow. Die Produktion verursacht 90 Prozent der klimaschädlichen Emissionen durch Plastik. Dagegen sind die Effekte durch Plastikmüll beinahe zu vernachlässigen.
Zu viele Beispiele für Downcycling
Die Fabriken der Ölindustrie verlassen die Kunststoffe meist als Granulat. Beinahe ein Drittel landet in Verpackungsfabriken. In diesen Fabriken werden die Granulate eingeschmolzen, mit Farbstoffen, Weichmachern und anderen Zusätzen versehen und in neue Formen gespritzt oder gegossen. Hier beginnen spätestens die Probleme der Kreislaufwirtschaft. Recycling ist dann einfach, wenn das gebrauchte Plastik möglichst sortenrein und sauber ist. Plastikgemische sind schwierig, sie taugen kaum für mehr als für Parkbänke und Bahnschwellen. Die sind braun und grau, weil die Recyclingindustrie kein Wundermittel gefunden hat, das Farbe verschwinden lässt.
Wenn die Recyclingkonzerne den Plastikmüll aus den gelben Säcken und Tonnen verarbeiten, können sie nicht wissen, ob in dem Plastikbehälter Shampoo war oder Abflussreiniger. Sie wissen auch nicht, ob vielleicht krebserregende Weichmacher enthalten waren. Recycling kann gesundheitsgefährdend sein, warnen Umweltorganisationen wie Greenpeace oder die Anti-Plastik-Allianz Gaia. Die EU lässt es deshalb heute nicht zu, dass Rezyklate aus Verpackungsmüll mit Lebensmitteln in Kontakt kommen.
Es gibt eine Ausnahme: PET-Pfandflaschen. Sie werden getrennt vom restlichen Müll in Pfandautomaten gesammelt. Die Flaschen sind durchsichtig und einfach zu verarbeiten. Aus einer PET-Flasche lässt sich wieder eine PET-Flasche herstellen, ein vollständiger Kreislauf. Dafür warb Moderator Günther Jauch kürzlich im Auftrag des Discounters Lidl. Nur passiert das heute kaum. Denn die PET-Flasche ist auch für andere ein begehrter Rohstoff, etwa für die Modeindustrie. Aus PET lässt sich das Garn Polyester herstellen. Die Outdoormarke Patagonia verkaufte die erste Fleecejacke mit Plastikflaschenanteil bereits vor über drei Jahrzehnten. Heute gibt es Fußballtrikots und Einkaufstaschen aus Plastikflaschen, sogar Radwege oder Reifen enthalten Plastikflaschen.
Doch das sind nur Beispiele für Downcycling. Aus dem Trikot lässt sich kein neues Trikot herstellen – und erst recht keine Plastikflasche. Ein Kreislauf kann so nicht entstehen.
Das größte Problem ist: das Geld
Die Chemie- und Ölindustrie drängt auf eine neue Technologie: Das chemische Recycling. Sie will die Kohlenwasserstoffketten im Plastik chemisch aufsprengen und wieder neu zusammensetzen. Doch bisher fehlen die Beweise, dass diese Verfahren in großen Maßstäben funktionieren. Oder umweltfreundlich sind. Die Autoren einer Studie im Auftrag des Chemieriesen BASF kamen sogar zu dem Ergebnis, dass chemisch recyceltes Plastik 77 Prozent mehr Emissionen verursachte als der gleiche Kunststoff aus Erdöl. Die Studienautoren bescheinigten sich trotzdem eine positive Bilanz, weil sie auf einen Trick zurückgriffen: Sie nahmen an, dass ohne chemisches Recycling mehr Plastik in der Müllverbrennungsanlage gelandet wäre und dort mehr Emissionen erzeugt hätte.
Chemisches Recycling ist also so energieintensiv, dass es klimaschädlicher sein könnte als Neuplastik aus fossilen Rohstoffen. Wahrscheinlich wäre es auch teurer.
Das Geld ist bis heute das größte Problem der Kreislaufwirtschaft. Plastikrecycling lohnt sich kaum. Die Rezyklate konkurrieren mit einem Werkstoff, der qualitativ und auch preislich weit überlegen ist – Neuplastik aus Öl. Als im vergangenen Jahr die Ölpreise fielen, geriet die deutsche Recyclingindustrie in eine Krise. Große Recyclingwerke schlossen. Darunter ein Flaschenrecycler, der Coca-Cola zu seinen Partnern zählte.
Mehrwegmärkte statt Supermärkte
Was also ist die Lösung? Wie entkommen wir unserer Plastiksucht? Herausrecyceln können wir uns aus dieser Krise nicht. Das zeigt auch das Beispiel der Plastikflasche. Selbst wenn die Einwegplastikflasche vollständig recycelt wird, gibt es ökologischere Wege, um Wasser zu trinken. Zwar gibt es keine unabhängige Studie – aber Umweltorganisationen gehen davon aus, dass die Mehrwegflasche mindestens ähnlich umweltfreundlich sein dürfte. Lidl hat keine einzige Mehrwegflasche in seinen Regalen.
Noch klimafreundlicher ist das Wasser aus dem Wasserhahn. So entsteht am wenigsten Plastikmüll. Die Plastikprobleme lösen sich nicht, wenn wir den Plastikmüll möglichst effizient wiederverwerten. Natürlich ist es gut, wenn mehr Plastikflaschen und Flaschendeckel recycelt werden. Aber noch ökologischer wäre es, wenn diese gar nicht auf den Markt kämen.
Die Kreislaufwirtschaft dient deshalb oft als Ablenkung von den wahren Problemen. Wenn die meisten Emissionen in der Plastikproduktion entstehen, dann müssen wir weniger Plastik produzieren. Wir brauchen ein grundlegendes Umdenken – entlang der gesamten Lieferkette: Der Plastikkonsum muss sinken. Fossile Rohstoffe dürfen nicht günstiger sein als Rezyklate. Wir brauchen Mehrwegmärkte statt Supermärkte. Dafür müssen Konsumkonzerne und Handel Produkte und Verkaufswege überdenken. Weltweit müssen Staaten Infrastrukturen aufbauen, um Müll zu sammeln und Umweltverschmutzung aufzuräumen. Das wäre auch die Basis für eine Recyclingindustrie.
Die Abhängigkeit von Plastik zu durchbrechen ist eine globale Aufgabe. Die Verhandlungen darüber laufen bereits. Das EU-Parlament hat Ende April neue Vorschriften für Verpackungsmüll verabschiedet: Mitgliedsstaaten haben nun Vermeidungsziele und sollen Mehrwegquoten einführen – auch wenn die Liste von Ausnahmen so lang ist, dass die Plastiklobbyisten stolz sein dürften. Die Vereinten Nationen wollen noch bis Ende 2024 einen Entwurf für ein internationales Plastikabkommen vorlegen. Einer der Diskussionspunkte: eine Einschränkung der Plastikproduktion auf „nachhaltige Level“. Wie diese Level aussehen? Ob die Produktionsgrenze durchkommt? Das ist unklar. Aber sie wäre um einiges wirksamer als die befestigten Plastikdeckel.
Buchtipp
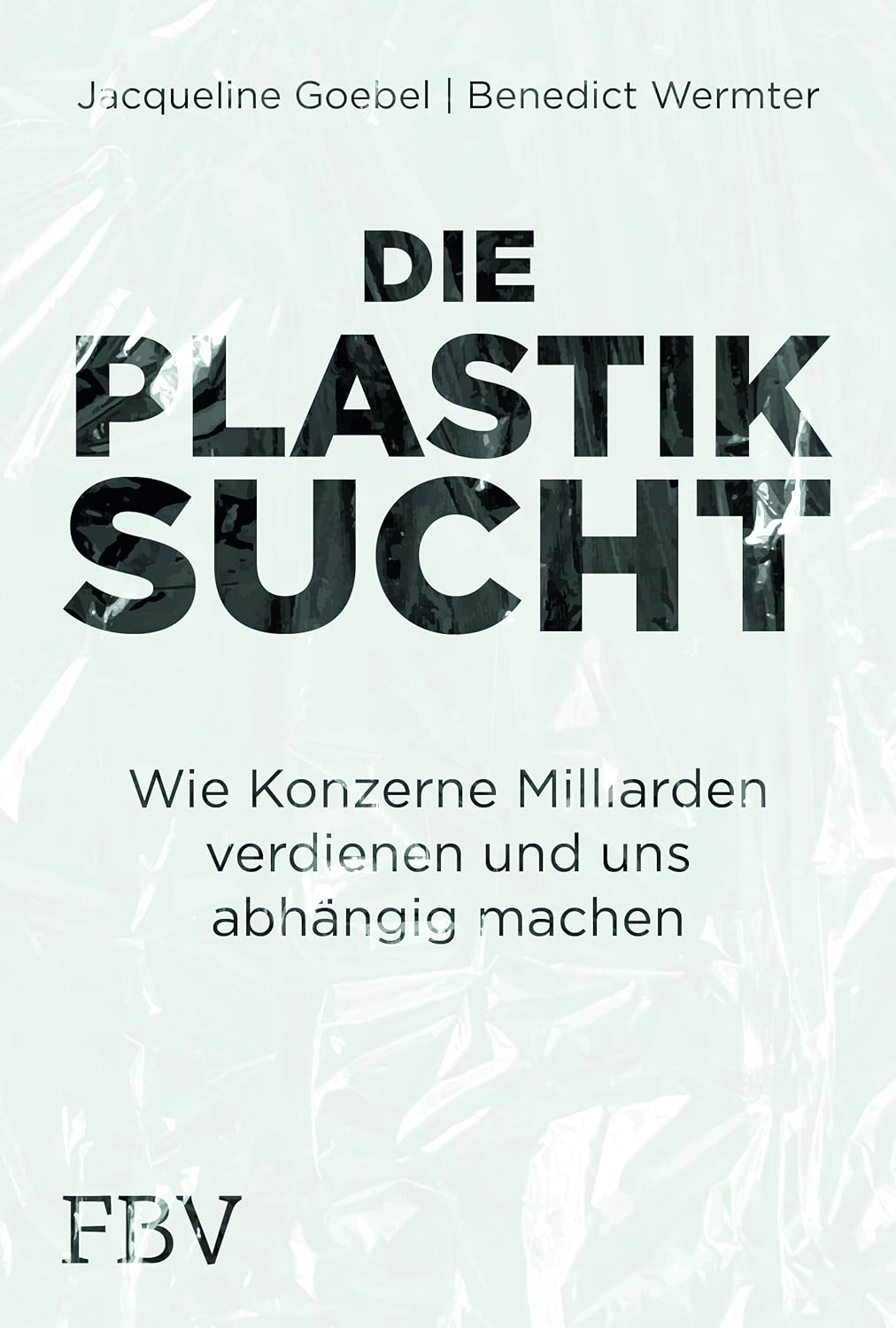
Jacqueline Goebel, Benedict Wermter
Die Plastiksucht: Wie Konzerne Milliarden verdienen und uns abhängig machen
FinanzBuch Verlag 2023,
304 Seiten, 22 Euro

Jacqueline Goebel ist Wirtschaftsjournalistin der „Wirtschaftswoche“. Dort schreibt sie über das Spannungsverhältnis zwischen Wirtschaft und Umwelt, insbesondere zur Logistik, Konsumgüterindustrie und Recyclingbranche.
© Patrick Schuch







