Titelthema
Der dreifache Frieden
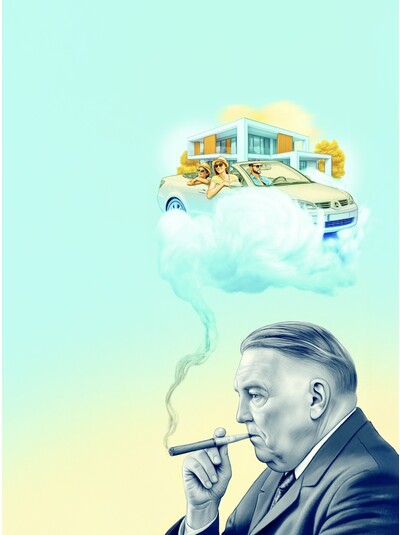
Die Wunder der sozialen Marktwirtschaft bringen uns bis zum heutigen Tag Wohlstand. Jetzt müssen wir ihre friedensstiftende Kraft neu entfachen.
Gut 80 Jahre nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges stellt sich erneut die Frage, ob der Frieden in Europa gesichert ist. Umso erhellender ist der Blick zurück in die frühen Jahrzehnte der Nachkriegszeit und dabei hin zu einem Friedensstifter, an den viel zu selten gedacht wird: die Marktwirtschaft.
Die westdeutsche Gesellschaft begab sich noch vor Gründung der Bundesrepublik auf eine Reise, die sie innerhalb eines Jahrzehnts befrieden sollte – gleich in mehrfacher Hinsicht und mit bis heute andauernder Wirkung. Zur DNA der Bundesrepublik gehört das Wirtschaftswunder fest dazu. Aber was genau war daran wundersam?
Jedenfalls nicht die Wirtschaftspolitik an sich. Dass die Kombination aus freien Preisen, stabiler Währung, gesichertem Wettbewerb und internationaler Öffnung zur Prosperität führt, überrascht nicht. Aber dass die Institutionalisierung dieses Ordnungsrahmens dauerhaft gelang und dies zur tragenden Säule des neuen Staates wurde, hätten damals nur wenige erwartet. Die Währungs- und Preisreform von 1948, welche die westlichen Alliierten und Ludwig Erhard vollbrachten, hätte scheitern können, denn die guten Jahre folgten nicht sofort. Aber die Menschen schöpften Hoffnung und bald auch Vertrauen in die neu entstehende Ordnung mit ihrer sozialen Marktwirtschaft. Ganz anders die Menschen in der DDR, die bei erster Gelegenheit 1953 die Chance zum Massenaufstand nutzten, um die Ordnung der stalinistischen Planwirtschaft abzuwerfen.
Das erste Friedenswunder bestand darin, dass die Menschen in einer höchst polarisierten Gesellschaft als Bürger zueinanderfanden. Denkt man an die unmittelbaren Nachkriegsjahre, so sieht man eine ideelle und materielle Polarisierung, welche die heutige um einiges übersteigt. Die ideellen Gräben der Zwischenkriegszeit hätten ohne Weiteres erneut aufreißen können. Materiell war die Ungleichheit erdrückend – zwischen demjenigen etwa, der noch ein nicht ausgebombtes Haus besaß, und denjenigen, die mit einem Pferdewagen aus den Ostgebieten angekommen waren. Aber das Aufstiegsversprechen der neuen Zeit hatte eine Wettbewerbsordnung im Mittelpunkt, und das signalisierte, dass es jeder und jede aus eigener Anstrengung zu Wohlstand bringen kann.
Das Beste kommt erst noch
Wundersam war und bleibt zweitens, dass die Westdeutschen ihren Frieden mit dem Kapitalismus schlossen. Wie jede westliche Gesellschaft schleppte und schleppt auch die deutsche ihren eigenen Antikapitalismus mit sich. Aber durch die glückliche Begriffsprägung „soziale Marktwirtschaft“ gelang eine neue Tonalität. Dass die Marktwirtschaft eine Kooperation aller ist, in der jeder und jede die eigenen Fertigkeiten einbringt und damit seinen Mitmenschen in friedlichen Tauschprozessen zu neuem Wohlstand verhilft, konnten zunehmend viele Bürger sehen. Die Angst vor dem Kapitalismus war gezähmt, denn dieser ermöglichte immer mehr Menschen wundersamerweise vor allem: das gute Leben.
Das dritte Wunder, das den Westdeutschen passierte, lässt sich sogar datieren: Walter Hallstein wurde im Januar 1958 erster Kommissionspräsident der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft. Dass lediglich ein Jahrzehnt nach Ende des Krieges ausgerechnet ein deutscher Jurist ein so zentrales Amt in Europa erhielt, machte vor allem eins deutlich: die Westeuropäer waren offenbar bereit, mit den Deutschen ihren Frieden zu schließen. Auch dazu bot die Wirtschaft die nötige Arena.
Wirken diese drei Wunder bis heute nach? Ja, sie haben Langzeitwirkung. Entfalten sie diese automatisch? Nein, die Langzeitwirkung muss immer wieder neu zum Leben erweckt werden. Die drei historischen Wunder offenbaren Quellen, aus denen auch die heutigen Bürger erneut Vertrauen in die Ordnung der Bundesrepublik schöpfen können: Jede Generation muss ihre Polarisierung überbrücken, die antikapitalistischen Instinkte überwinden und die Spannungen in der europäischen Einigung lösen.
Und ja, aus diesen drei Quellen kann auch heute neues Vertrauen entstehen.
Gerade in einer Gesellschaft, in der die Parteien ihre integrierende Funktion für alle nicht mehr erfüllen und in der sich die Medienlandschaft immer mehr zerklüftet, kann der Hinweis auf die integrierende Funktion der Wirtschaft umso wertvoller sein. Dass wir trotz allem, was uns aktuell an polarisierenden Nachrichten umgibt, mit unseren Mitmenschen in einer mannigfachen Arbeitsteilung stehen, enthält einen wichtigen Hinweis: Wenn wir unsere Nachbarn – national und international – zu Feinden erklären, verlieren wir den in unseren friedlichen Wirtschaftsbeziehungen begründeten Wohlstand.
Antikapitalismus im heutigen Deutschland bedeutet konkret: Arbeit ist eine zu minimierende Lästigkeit, Kapitalmärkte sind Ansammlungen von Heuschrecken, Innovationen sind Treiber des Chaos. Wenn es nicht gelingt, diese altbewährten Denkmuster abzustreifen, wird die Wachstumsschwäche des Landes anhalten. Ein Umdenken ist aber möglich. Stimmen, die für eine veränderte Arbeits-, Kapitalmarkt- und Innovationskultur eintreten, können es auch heute wie in den Nachkriegsjahrzehnten schaffen, die eigenen Mitbürger davon zu überzeugen, dass die besten Zeiten erst noch bevorstehen.
Nicht jammern, sondern anpacken
Schließlich bedeutet das Auseinanderbrechen des Westens angesichts der Entwicklungen in den USA, dass die europäische Integration für die Bundesrepublik umso überlebenswichtiger geworden ist. Die EU als Friedensprojekt einer „Reintegration“ nach innen und außen neu zu konzipieren, in dem also die Integration des Binnenmarktes noch besser gelingt und die Nachbarn noch näher an die EU heranrücken, ist eine faszinierende Aufgabe, welche uns ab sofort beschäftigen muss.
In den vergangenen 200 Jahren hat die Menschheit einen ungeahnten Wohlstand erreicht. Und tiefe Abstürze wie 1945 erlebt. Wir leben heute in einer Welt, die fast jeden Tag ihre Fragilität zeigt. Aber wir haben noch die Chance, sie zu bewahren. Dafür muss man nicht an Wunder glauben, sondern lediglich das, was in der Geschichte wundersam erschien, in die aktuelle Welt übersetzen und behutsam erklären. Die soziale Marktwirtschaft ist ein solcher befriedender Anker für Deutschland und Europa.
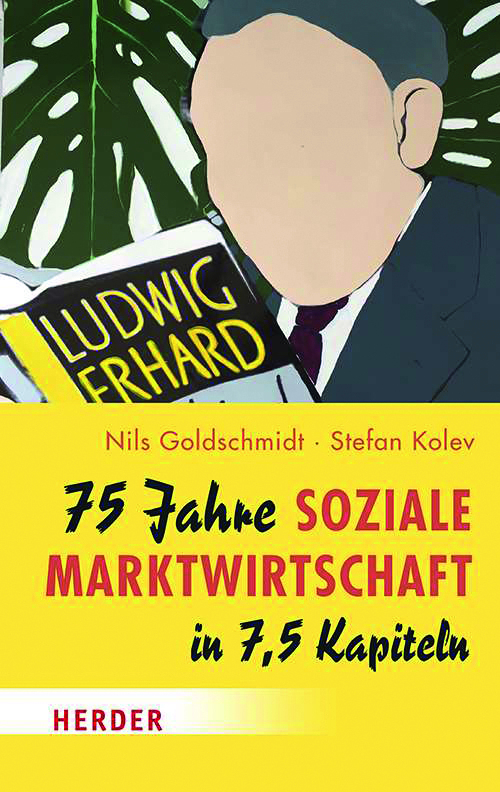
Stefan Kolev und Nils Goldschmidt
75 Jahre Soziale Marktwirtschaft in 7,5 Kapiteln
Herder 2023,
80 Seiten, E-Book 8,99 Euro

Stefan Kolev ist der wissenschaftliche Leiter des Ludwig-Erhard-Forums für Wirtschaft und Gesellschaft in Berlin und Professor für Wirtschaftspolitik an der Westsächsischen Hochschule Zwickau.







