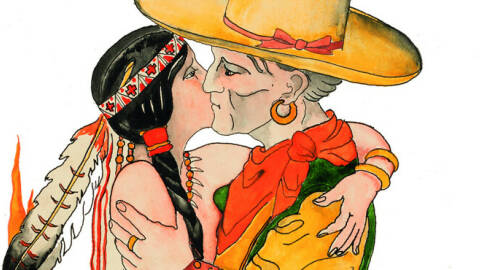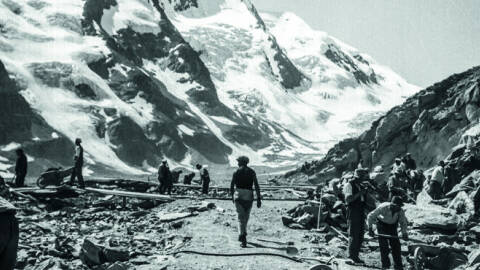Titelthema
Philosemitismus ohne Juden

Vor dem Zweiten Weltkrieg gehörte die jüdische Community Wiens zu den größten Europas. Als Überlebende nach dem Krieg zurückkehrten, begegnete man ihnen auf merkwürdige Weise
Man stelle sich ein unwahrscheinliches Szenario vor: Eine ungeduldige Menschenmenge von fast 200 Personen versammelte sich 1949 am Wiener Westbahnhof. Sie warteten sehnsüchtig auf die Rückkehr des jüdischen Volkskünstlers Armin Berg, der nach elfjährigem Exil in New York mit dem Zug anreiste. Noch wenige Jahre zuvor waren die Wiener Bahnhöfe Orte der Flucht, der Deportation und der Angst gewesen. Doch in den späten 1940er und frühen 1950er Jahren erlebten jüdische Künstler im Exil ein ganz anderes Spektakel: bewundernde Fans.

Hören Sie hier den Artikel als Audio!
Einfach anklicken, auswählen und anhören!
Diese Begeisterung war nicht auf Berg oder populäre Künstler beschränkt. Sie war bezeichnend für eine breitere philosemitische Atmosphäre, die die Österreicher der Nachkriegszeit dazu veranlasste, ausgewählte jüdische Künstler und jüdisch codiertes kulturelles Material, wie das Kabarett, das Kaffeehaus und den Modernismus in der bildenden Kunst, als Zeichen der Erlösung Österreichs nach dem Nationalsozialismus zu betrachten. Vereinfacht ausgedrückt, ist Philosemitismus der Wunsch nach dem, was Juden – aufgrund von Stereotypen – in der Vorstellung der Menschen repräsentieren. In einer verblüffenden Wendung wurden die Juden zu einem grundlegenden Bestandteil des kulturellen Wiederaufbaus nach dem Nationalsozialismus und dem Holocaust.
Gespielte Freude
Wie lässt sich dieser verblüffende Eifer für die jüdische Rückkehr in einer Stadt erklären, die eher für ihren heftigen Antisemitismus und ihre Ablehnung der Überlebenden bekannt ist? Die Österreicher gaben den Juden häufig die Schuld am Krieg, an seinen katastrophalen Folgen und insbesondere an der alliierten Besatzung.
Die wenigen Juden, die zurückkehrten oder in Wien blieben, stießen auf eine undurchdringliche Bürokratie und scheinbar endlose Hürden. Von wenigen Ausnahmen abgesehen, war es in den Jahrzehnten unmittelbar nach dem Zweiten Weltkrieg nahezu unmöglich, geraubtes Eigentum wiederzuerlangen. Die Angst vor Restitution wurde zu einer starken politischen Kraft und inspirierte sogar die Gründung einer reaktionären Bewegung zum Schutz der Rechte der „Ariseure“. Trotz des Trubels änderte Bergs Berühmtheit wenig an seiner materiellen Realität im postnazistischen Wien: Er konnte seine 1938 arisierte Vor-Nazi-Wohnung nicht zurückfordern. Im Gegenzug wohnte der Star in einem Hotel, bis er sich 1952 mithilfe der Stadtverwaltung eine Wohnung sichern konnte.
Diese beiden Gesichter Wiens spiegeln ein Paradoxon im Herzen der Nachkriegskultur wider: Nur wenige Österreicher wünschten sich die robuste und vielfältige jüdische Bevölkerung Wiens so zurück, wie sie vor 1938 gewesen war. Gleichzeitig hofften viele Politiker, Beamte und Kulturschaffende, die urbane und moderne Kultur wiederzubeleben, die stark mit einer realen oder imaginären jüdischen Präsenz verbunden war. Letzteres erforderte offenbar die punktuelle oder zeitweilige Präsenz jüdischer Künstler wie Berg. Philosemitismus und Antisemitismus waren kaum Gegensätze. Ihre Wechselbeziehung trug dazu bei, Wien in der Zeit des Wiederaufbaus nach dem Krieg neu zu definieren.
Philosemitismus und Antisemitismus waren seit dem 19. Jahrhundert wesentliche Bestandteile der europäischen Kultur. In Mitteleuropa bildeten Antisemitismus und Philosemitismus zwei Seiten einer mächtigen Reihe von Debatten, die Stereotype jüdischer Differenz und Fantasien jüdischer An- und Abwesenheit nutzten, um moderne und städtische Kultur zu bewerten. Während Antisemiten die Anschuldigungen der jüdischen Präsenz nutzten, um die modernistische Kunst und Kultur, die sie als geschmacklos empfanden, zu verurteilen und zu bekämpfen, feierten Philosemiten die jüdische Präsenz als Beweis für die dynamische urbane Kultur, die sie zu unterstützen wünschten.
Zusammen mit ihren nichtjüdischen Kollegen waren viele Juden – wenn auch nicht alle – tatsächlich an der Entwicklung Wiens zu einer modernen Kulturhauptstadt beteiligt. Aber diese allgegenwärtige Art der Bewertung von Kultur erforderte nicht unbedingt die Anwesenheit von echten Juden. Obwohl beispielsweise der Maler Gustav Klimt kein Jude war, wurde er von seinen Gegnern häufig beschuldigt, einen sogenannten jüdischen Geschmack zu vertreten. Er reagierte darauf, indem er den Vorwurf des Jüdischseins als Hinweis auf seinen Status als Bohemien und Außenseiter auffasste – mit anderen Worten: als wahrer Künstler. Stereotype über Juden und ihre angebliche Verbindung zur Moderne bildeten die Grundlage für beide Sichtweisen. In der Zwischenkriegszeit wurde sogar die Stadt Wien einer solchen Bewertung unterzogen: Viele Österreicher verstanden die Stadt als einen jüdischen und damit fremden Raum, der in Opposition zur vermeintlich authentischen österreichischen Nation definiert wurde.

Abgrenzung von Deutschland
Philosemitismus und Antisemitismus blieben auch nach 1945 bestehen. Aber sie veränderten sich auch in mindestens zwei entscheidenden Punkten. Erstens waren Philosemitismus und Antisemitismus vor 1938 kulturelle und räumliche Gegensätze gewesen, wobei der Antisemitismus an die Nation und der Antimodernismus und Philosemitismus an die städtische Moderne gebunden waren. Nach 1945 vollzog sich ein erstaunlicher Wandel: Die Nation übernahm eine selektive jüdische Präsenz, den Modernismus und die Stadt, einschließlich ihrer ikonischen, jüdisch codierten Räume, des Kaffeehauses und des Kabaretts, als Symbole der österreichischen Erlösung und als Beweis für Österreichs historische Abgrenzung von Deutschland. Der „wahre“ Österreicher, so sagten viele, sei paradigmatisch europäisch und sei während der Nazizeit zum Opfer geworden, kehre nun aber zurück, um die Kulturhauptstadt wiederzubeleben. Hinter solchen Äußerungen stand das Bemühen, dem Bild der historischen Verbindung, der Verschmelzung oder des Anschlusses mit Deutschland entgegenzuwirken und es, wie ein Beamter treffend bemerkte, durch einen „gesunden Anschluss an Europa“ zu ersetzen. Die groß angelegten Rebranding-Bemühungen lieferten ebenfalls Futter für Österreichs Nachkriegs-Opfermythos und verdrängten die Begeisterung, mit der viele Österreicher die Ankunft der deutschen Truppen im März 1938 begrüßten.
Wiens große Selbstamputation
Nach 1945 gab es eine zweite wichtige Veränderung im Philosemitismus. Er fand in der Regel ohne ausdrückliche Erwähnung von Juden statt. Man könnte von einem „Philosemitismus ohne Juden“ sprechen. Stattdessen beriefen sich die Nachkriegsösterreicher, die sich an diesem Diskurs beteiligten, typischerweise auf Juden durch Stereotype, die sofort erkennbar waren, aber das Wort „jüdisch“ ausschlossen, oder durch Bilder des Verschwindens und der Rückkehr.
Ein Kritiker, der über die Rückkehr eines anderen gefeierten jüdischen Künstlers, Hermann Leopoldi, schrieb, stellte sich vor: „Von dem Moment an, als Hermann Leopoldi sich ans Klavier setzte, hatte man das eigenartige Gefühl, dass er überhaupt nie weg gewesen war.“ Obwohl die Gründe für Leopoldis langen „Abgang“ in der Presse nie erörtert wurden, wurde seine Abwesenheit häufig beschworen und beklagt. Ein Kommentator beschrieb Leopoldi 1949 als „einen Onkel aus Amerika, der viele Geschenke mitbrachte“. Hier sehen wir jüdische Stereotype – die heute positiv bewertet werden –, die Bilder von Amerikanern, Juden und internationalen Organisationen überlagern, aber jede explizite Diskussion über sein Jüdischsein ausschließen.
Leopoldi und seine Kollegen trugen eine große Verantwortung in einem kulturellen System, das die Rollen von Opfern und Tätern vertauschte, indem es unter anderem die Österreicher als Opfer der jüdischen Abwesenheit darstellte. Die Österreicher wünschten sich die selektive Rückkehr jüdischer Künstler als Träger der kosmopolitischen und europäischen Vergangenheit Wiens, verstanden die Juden aber auch als außerhalb der Grenzen der österreichischen Kultur und Gesellschaft stehend. Dieses widersprüchliche Szenario führte zu seltsamen und temperamentvollen Formulierungen, da das Publikum die Künstler je nach Kontext und Bedarf als paradigmatisch österreichisch oder fremd ansah.
Wenn sie nicht explizit als jüdisch identifiziert wurden, wurde das, was zuvor als „jüdische“ Kultur galt, zu etwas, das die Österreicher neu erfinden, absorbieren und in eine Vorstellung von christlicher Harmonie und als Beweis für die Eignung Österreichs für ein liberal-demokratisches Europa assimilieren konnten, in dem die Zweite Republik ihre Zugehörigkeit beweisen wollte.
Es versteht sich von selbst, dass diese Veränderungen im Philosemitismus und Antisemitismus mit einem schockierenden demografischen Wandel einhergingen. Wie andernorts auch dezimierte der Holocaust die jüdische Bevölkerung in Wien. Untrennbar von der Zerstörung der jüdischen Gemeinde zerstörte der Holocaust jedoch ein Netzwerk intimer Beziehungen zwischen Juden und Nichtjuden, zusammen mit der Kultur, die aus dieser komplexen Verflechtung von Leben und Schicksalen hervorging. Grob gesagt hat die nichtjüdische Bevölkerung Wiens während der Nazizeit eine brutale Selbstamputation vorgenommen.
Feier der geliebten Opfer
Wie soll sich eine Stadt ohne eine einst bedeutende Minderheit neu definieren? Diese Frage ließe sich auf die meisten städtischen Räume nach dem Zweiten Weltkrieg und dem Holocaust anwenden. Sicherlich könnte man auch an andere postgenozidale Kontexte denken. Die Nachkriegsvariante des Philosemitismus entwickelte sich als eher unreflektierte Reaktion auf eine tiefgreifende jüdische Abwesenheit. Er zeigt langfristige Folgen und Kontinuitäten mit der Zeit des Völkermords auf, nämlich eine Gesellschaft, die sich danach sehnt, ihre Opfer in ihrer Abwesenheit zu konsumieren, neu zu definieren und ihnen symbolische Bedeutung zu verleihen. Die starke symbolische Kraft und das kritische Potenzial der Wiederentdeckung der verschwundenen Juden hatten sich erhalten. Es hat sich in jedem Moment, in dem sich die Grenzen Europas verschoben haben oder sie umstritten waren, mit Nachdruck gezeigt – nach dem Nationalsozialismus, in der Zeit nach dem Kommunismus und in der angespannten Gegenwart, die durch den Aufstieg rechtsextremer Parteien, migrationsfeindliche Stimmungen und Islamophobie gekennzeichnet ist.
Die Beispiele aus der Zeit nach dem Holocaust zeigen uns, dass Präsenz und Abwesenheit als Kritikmodell eine grundlegende Herausforderung darstellen: Selbst wenn seine Befürworter aufrichtig sind und auf dem Erbe der jüdischen Vergangenheit aufbauen, um die Vielfalt zu fördern, verstärkt es potenziell die Annahme, dass Österreicher oder Europäer, Migranten und Minderheiten unterschiedliche Gruppen sind und nicht Mitgestalter städtischer oder anderer Kulturen. Darüber hinaus wird vorgeschlagen, dass Außenseiter, wenn sie überhaupt willkommen geheißen werden sollen, mit Geschenken kommen müssen.