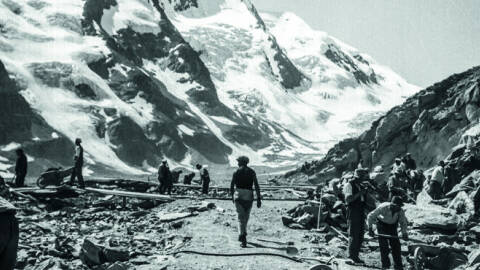Titelthema
Zeichen auf der Haut

In der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts waren Tattoos schon beinahe so cool wie heute. Selbst Sisi ließ sich stechen
Eine (mehrfach tätowierte) Person wie mich würde er auf keinen Fall einstellen, sagte mein Papa einmal zu mir. Er war als staatlicher Bankmanager tätig und ist seit vielen Jahren im Ruhestand.
Manche Mitmenschen interpretieren sichtbare Tätowierungen als Zeichen für Unprofessionalität, einen geringen Bildungsstand, generelle (Lebens-)Unfähigkeit. Bestenfalls wird der Körperschmuck als trendiger Unfug wahrgenommen. (Vor-)Urteile wie „Geschmacksverirrung“, „Selbst-“ oder gar „Sachbeschädigung“ sind ebenso häufig. Tätowierungen in Europa – und auch in den USA – wurden und werden bekämpft, seit sie als „cool“ gelten. Also schon ziemlich lange.
In der Epoche des Similaunmannes vulgo Ötzi waren Tattoos noch nicht cool, dafür ganz alltäglich. Ohne Zweifel wohnte ihnen eine besondere Bedeutung inne. Als magischer Schutz dienten sie sowohl der Abschreckung von Feinden als auch der Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen Gruppe. Der im Eis konservierte Mann aus der Bronzezeit besaß 59 verschiedene Tätowierungen.
Mumien unterschiedlichster Kulturzusammenhänge weisen Hautzeichen auf. In Nubien (heute Südägypten und Sudan) oder in Arabien waren nur Frauen tätowiert. Die Hautmale, die die Mädchen beim Einsetzen der Pubertät erhielten, orientierten sich an denen ihrer Vorfahrinnen und standen für Schönheit und Fruchtbarkeit. Solche Tätowierungen beginnen zwischen den Brüsten und führen über den Unterleib zu den Oberschenkeln – eine Kartografie zur Inbesitznahme des weiblichen Körpers. Man kann diese Praktik mit der Funktion erotischer Dessous vergleichen.
Die in Europa vielerorts vorhandene Tradition der Hautzeichen verschwand mit der Ankunft des Christentums. Falls es nach dem Mittelalter noch tätowierte Personen gab, so existierten diese im Verborgenen. Quellen belegen jedoch, dass es auch zu dieser Zeit für bestimmte Gruppen Körperkennzeichnungen gegeben hat: So trugen etwa Kreuzritter Tätowierungen, ebenso Jerusalem-Wallfahrer oder Bauernkinder, die zur Arbeit in die Fremde geschickt wurden.
„Wer sich tätowiert, ist ein Verbrecher oder ein degenerierter Adeliger“
Zur Zeit des ausgehenden 18. Jahrhunderts nahm die Begeisterung für Tattoos in Europa (wieder) Fahrt auf. Es war im Jahr 1774, als der Weltumsegler James Cook einen tätowierten Mann aus der Südsee zur Schau stellte. Im Einklang mit dem damals viel beschworenen „edlen Wilden“, der Sehnsucht nach dem vermeintlich Ursprünglichen und der Vision von „Utopia“ wurde das „Tattaw“ ein Symbol des Exotismus: Es gehörte zum archaischen – nun positiv besetzten – Urbild des Menschen.
Jean-Baptiste Bernadotte, General und Kriegsminister unter Napoleon, wurde später König von Schweden – womit er nicht gerechnet hatte, denn er trug unter anderem die Tätowierung „Tod dem König“. Die Hautmale wurden erst nach seinem Tod entdeckt, hatte sie der Herrscher doch zeitlebens zu verbergen gewusst, sogar vor seinen Ärzten. Seine Nachfahren sind weiterhin Monarchen in Schweden.
Als die 18-jährige Queen Victoria im Jahr 1837 ihr Amt antrat, hieß es: „Es wird jedem Seemann ans Herz gehen, für eine so junge Königin zu kämpfen. Sie werden sich ihr Gesicht auf die Arme tätowieren lassen.“
In der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts waren Tattoos schon beinahe so cool wie heute. Nicht nur Matrosen und Hafenarbeiter hatten welche; auch Erzherzöge und Kaiserinnen, wie etwa in der österreichischen Monarchie Kronprinz Rudolf, Thronfolger Franz Ferdinand oder Elisabeth („Sisi“), die sich als über 50-Jährige einen Anker stechen ließ.
Doch bis heute dominiert teilweise die Aussage des Architekten und Designers Adolf Loos: „Wer sich tätowiert, ist ein Verbrecher oder ein degenerierter Adeliger.“ In einer juridischen Dissertation der Universität Wien aus dem Jahr 1976 konnte man lesen, dass „Tätowierungen in der Regel ein Indiz für kriminelles Verhalten sind“.
Ein Blick in die USA
Martin Hildebrandt, ein Einwanderer aus Deutschland, dürfte der Erste gewesen sein, der Mitte des 19. Jahrhunderts in New York einen „tattoo parlour“ eröffnete. Zu dieser Zeit wurden Tätowierungen in den USA mit Geheimpraktiken assoziiert, weiters noch mit fahrenden Zirkusartisten, fernen „Primitivkulturen“, Schiffsvolk und den Native Americans.
Aber es war auch zu beobachten, dass weiße Amerikaner aus unterschiedlichen Bevölkerungsgruppen anfingen, sich für Tattoos zu interessieren. Hildebrandt erzählte einem Journalisten von Mitgliedern der Freimaurer, die mit speziellen Zeichen tätowiert seien. Er selber habe hoch- und niederrangige Leute tätowiert, von Mechanikern bis zu „real ladies“ sei alles dabei gewesen.
Hildebrandt kämpfte im Amerikanischen Bürgerkrieg und machte seine Kameraden mit dem Tätowieren vertraut. „Im Krieg habe er nicht eine freie Minute“ gehabt, berichtete er später. Tausende Soldaten und Seeleute würden von ihm gestochene Motive am Körper tragen.
Der Deutsche war offenbar der einzige Tätowierer, der sich offen zu Bürgerkriegs-Tattoos geäußert hat. Es müssen aber zahlreiche weitere Tätowierer ihrem Handwerk nachgegangen sein, sodass Tätowierungen zum ersten Mal in der US-Geschichte „Mainstream“ geworden sind. Hildebrandt tätowierte die Namen seiner Klienten auf deren Arme oder Oberkörper. Viele konnten so erkannt werden, nachdem sie verwundet oder getötet worden waren.
Tätowierungen waren damals schmerzhaft, und der Vorgang dauerte seine Zeit. Allein für einen Namen musste man eine Stunde einkalkulieren. Arme schwollen an und Wunden entzündeten sich. Meist tätowierte man mit einer Mischung aus Tinte und feuchtem Schießpulver. Danach wurde die Stelle mit Wasser, Urin und Rum gereinigt.
Die Geschichte der Tattoos im militärischen Bereich reicht weit zurück, bis ins antike Rom. Dort wurden Soldaten mit einer Mixtur aus Akazienrinde, Bronze und Schwefelsäure tätowiert. Man wollte auf diese Weise vor allem Deserteure identifizieren.
Und heute?
In Europa sind durchschnittlich 3000 von 10.000 Personen tätowiert – Tendenz seit Langem steigend. In manchen Branchen soll es mittlerweile Chefs geben, die ein Tattoo für förderlich bei der Jobsuche halten.
40 Prozent der US-Millennials, also der um 1990 Geborenen, haben ein Tattoo (Studie veröffentlicht in der britischen Ausgabe der Zeitschrift Elle, 2018). Davon sagen 72 Prozent, dass sie ihr Tattoo üblicherweise verstecken. Zum Endergebnis der Studie gehört, dass sich Tattoos weder positiv noch negativ auf das Arbeitsverhältnis oder die Höhe des Gehalts auswirken. Es gebe immer mehr (jüngere) Arbeitgeber, die Tattoos als Ausdruck von Individualität und Persönlichkeit wahrnehmen und ihren „Trägern“ somit durchaus Positives abgewinnen können.
Dass Tattoos inzwischen in der Mitte der Gesellschaft angekommen sind, beweisen auch die zahlreichen Tattoo-Shows, die man auf diversen TV-Kanälen sehen kann. Es scheint sich um ein quotenträchtiges Format zu handeln, das seine Fans über lange Zeit unterhalten kann.
Sie dürfen sich also ruhig trauen. Es tut auch gar nicht weh.

Michaela Lindinger ist Autorin und Kuratorin im Wien Museum. Zuletzt sind von ihr „Die dunkle Kaiserin. Elisabeths späte Jahre“ und „Wallis Simpson: Verhinderte Queen. Aufsteigerin. Meistgehasste Frau der Welt“ bei Molden (Wien 2024) erschienen.
Foto: Sabine Hauswirth