Titelthema
Der gefesselte Souverän
Deutschland hat sich eine Verfassung gegeben, die den Mehrheitswillen einhegt. Doch wenn das Recht aus dem nationalen Rahmen heraustritt, wird Liberalismus ohne Demokratie möglich. Über juristische Macht und politische Gegenmacht
Wir reden heute von der liberalen Demokratie – und davon, dass sie in der Krise sei. Historisch betrachtet ist diese Sprechweise alles andere als selbstverständlich. Bis ins frühe 20. Jahrhundert hinein wurden Liberalismus im Sinne der Garantie individueller Freiheitsrechte des bürgerlichen (besitzenden) Privatsubjekts und Demokratie im Sinne der Volkssouveränität und der Mehrheitsregel eher als gegensätzliche, fast immer latent und bisweilen manifest im Konflikt miteinander stehende Prinzipien verstanden.

Hören Sie hier den Artikel als Audio!
Einfach anklicken, auswählen und anhören!
Hinzu kommt, dass unsere heutige Sprechweise von der liberalen Demokratie, so weitverbreitet, wie sie ist, zumeist recht diffus bleibt. Warum genau meinen wir Demokratie mit dem Zusatz „liberal“ näher qualifizieren zu müssen? In vielen Beiträgen kann man lesen, dass es so etwas wie eine „illiberale Demokratie“ (Viktor Orbán) gar nicht geben kann, dass sie ein Selbstwiderspruch ist. Eine Demokratie sei entweder liberal oder gar nicht demokratisch. Das hieße, dass die Redeweise von der liberalen Demokratie tautologisch wäre. Warum aber sollte man in Tautologien reden?
Garantie zahlreicher Rechte
Wenn man die Geschichte des Begriffs rekonstruiert, zeigt sich zudem, dass er erst vor Kürzerem seinen Siegeszug angetreten hat. Man findet ihn vereinzelt auch schon in den 1960er oder 1970er Jahren verwendet, aber erst ab den 1990er Jahren setzt er sich flächendeckend durch – und auch erst ab dann bekommt er seinen spezifischen zeitgenössischen Sinngehalt. Gemeint ist nun eine Demokratie, die in einem sehr umfangreichen Sinne dem Minderheitenschutz und den Menschenrechten verpflichtet ist. Die Begriffskonjunktur und den spezifischen Sinn, der dem Begriff nun verliehen wird, muss man – so denke ich – als Hinweis auf das Wesen unserer gegenwärtigen Konflikte verstehen.
Aber wie verhält es sich mit den liberalen Rechten und der Demokratie? Auf einer ersten, noch recht allgemeinen Ebene adressiert die Rede von der liberalen Demokratie die grundsätzliche und schwierige Frage, wie das Verhältnis zwischen „elektoralen“ und „liberalen“ Elementen in einer Demokratie real ausgestaltet ist (und wie man es grundlegend verstehen sollte). Einerseits ist klar, dass die effektive Garantie bestimmter Rechte eine Voraussetzung dafür ist, dass eine Demokratie auch als eine tatsächliche, echte, wirkliche Demokratie gelten kann. Zentral sind hier offenkundig die Meinungs-, Versammlungs- und Asso - ziationsfreiheit. Da diese ja im Konfliktfall geschützt und effektiv durchgesetzt werden müssen – insbesondere gegen diejenigen, die sie einschränken können und auch eventuell wollen (etwa um auf diesem Wege ihre Herrschaft zu sichern) –, setzt also schon auf dieser sehr allgemeinen Ebene das elektorale Funktionieren einer Demokratie Rechtsstaatlichkeit, eine unabhängige Justiz, gleichen Zugang der Bürger zu den Gerichten et cetera voraus. Mit anderen Worten: Selbst ein äußerst dürres Verständnis von Demokratie („full disclosure“, der ich selber anhänge), die sie beispielsweise lediglich definiert als ein „politisches System, in dem (Regierungs-) Parteien Wahlen verlieren und die Macht abgeben, wenn sie verloren haben“ (Adam Przeworski), muss automatisch diese Form umfassender Rechtsstaatlichkeit immer mitmeinen.
Die Tyrannei der Mehrheit als …
Insofern impliziert auch ein minimalistisches Demokratieverständnis im obigen Sinne ein hochvoraussetzungsvolles, „liberales“ Gemeinwesen. Damit rechtfertigt sich auch eine Frage, wie sie der Verfassungsrechtler Christoph Möllers vor Kurzem gestellt hat. Er fragte, wo auf der ganzen Welt wir denn überhaupt das eine, die Demokratie, ohne das andere, die liberalen Grundrechte, oder umgekehrt diese liberalen Grundrechte ohne die Demokratie finden könnten? Möllers Antwort: nirgends. Mit anderen Worten: Selbst wenn wir konzeptionell, ideengeschichtlich, vielleicht polit-philosophisch zwischen beiden – liberaler Rechtsstaatlichkeit und demokratischer Mehrheitsregel – unterscheiden wollten, real-empirisch treten sie, so Möllers, eigentlich immer zusammen auf, und offenkundig mit gutem Grund. Somit könnte man ihr Verhältnis als geklärt betrachten. Die Wirklichkeit antwortet auf die Frage, ob Liberalismus und Demokratie zusammengehören: zwingend! Und diese kurze Abhandlung könnte schon an ihren Schluss gelangt sein.
… Gefahr für die Demokratie
Aber der Begriff der liberalen Demokratie zielt zumeist – obwohl das von denjenigen, die den Begriff nutzen, gerne etwas im Unklaren gelassen wird – über ein Verständnis deutlich hinaus, das „nur“ auf die grundlegenden Funktionsbedingungen für freien demokratischen Wettbewerb abstellt. Die Denkfigur der Tyrannei der Mehrheit wird dann häufig bemüht (zumeist aber nicht ausformuliert, was mit ihr genau gemeint sein soll), um der Vorstellung Ausdruck zu verleihen, dass das rein elektorale Funktionieren eines politischen Gemeinwesens nach dem Mehrheitsprinzip nicht nur (normativ) nicht ausreicht, sondern dass in ihm sogar eine substanzielle Gefahr für die Demokratie liegen würde, weil Mehrheiten (dauerhafte) Minderheiten unterdrücken könnten. Dann bekommt die Sprechweise von der liberalen Demokratie einen anderen Bedeutungsgehalt. Jetzt geht es um umfangreichen Schutz von Grundrechten, die am besten in einer Verfassung festgehalten werden. Das erfordert dann natürlich auch Gerichte, die über diese Grundrechte wachen und gegebenenfalls Gesetze verwerfen, wenn Richter zum Schluss kommen, dass sie mit der Verfassung in Widerspruch stehen. Hier scheint es so zu sein, dass das Liberale auch in einem Spannungsverhältnis zum Elektoralen stehen kann und ja idealerweise auch stehen sollte, wann immer Mehrheiten „etwas Falsches“ wollen.
Das einzigartige „Modell Karlsruhe“
Es gehört zum Wesen der Politik, dass im Einzelfall jeweils umstritten ist, wo eine solche Einschränkung zulässig und geboten ist oder aber übergriffig wird. (Konkret: Rechtfertigt die Berufung auf Grundrechte [zukünftiger Generationen] die Entscheidung eines Verfassungsgerichts, ein mit parlamentarischer Mehrheit verabschiedetes Klimaschutzgesetz zu verwerfen?) Dass national je unterschiedliche Formen der (verfassungs)rechtlichen Verpflichtung demokratischer Entscheidungsverfahren zu unterschiedlichen Gewichtungen des Liberalen und des Elektoralen kommen, sollte als vergleichende Beobachtung aber unkontrovers sein. Man denke etwa an die britische Parlamentssouveränität einerseits im Vergleich zum „Modell Karlsruhe“ andererseits. Dafür, dieses Spannungsverhältnis eher stark konstitutionell (also etwa: deutsch) oder stark majoritär (also etwa: britisch) aufzulösen, gibt es jeweils sehr plausible Argumente – und in diesen Argumenten spielt die jeweilige historische Erfahrung eine starke Rolle. (Immerhin eröffnet das die Möglichkeit, dass sich im Vergleich zeigen könnte, dass das eine „institutionelle Gleichgewicht“ insgesamt demokratisch besser funktioniert und Rechte stabiler garantiert als ein anderes.)
Gewicht und Gegengewicht
Aber ganz unterschiedliche institutionelle Lösungen für dieses Spannungsverhältnis lassen sich wiederum als jeweils mehrheitlich, also demokratisch gewollt, verstehen. Sie entstehen halt vor dem Hintergrund unterschiedlicher historischer Erfahrungen. Um im Beispiel zu bleiben: Dort, wo die Demokratie scheiterte (wie etwa in Deutschland), besitzt die Vorstellung einer „wehrhaften Demokratie“ stärkere historische Evidenz als dort, wo diese schmerzhafte Erfahrung nicht gemacht zu werden brauchte. Die skandinavischen Länder kennen bis heute keine Verfassungsgerichte, aber wir würden sie wohl trotzdem umstandslos als liberale Demokratien bezeichnen. Wenn es aber zum politischen Gründungskonsens eines Landes gehört, den Mehrheitswillen stark einzuhegen, lässt sich das dennoch als mehrheitlich gewollt – also als demokratisch – verstehen. Ein Verfassungssouverän sorgt dafür, dass der temporäre Souverän – die jeweils gerade Machthabenden – „gefesselt“ bleibt (ein anderer Verfassungssouverän hingegen fesselt eine Regierung womöglich in viel geringerem Ausmaß). Aber eine Verfassung ist ja durch diesen Verfassungssouverän – vielleicht zunächst nur in der Fiktion, aber dann wenigstens nachträglich legitimiert durch die Verfassungspraxis – heutzutage grundsätzlich selbst demokratisch legitimiert. Wie es in der Präambel des Grundgesetzes heißt, „hat sich das Deutsche Volk kraft seiner verfassungsgebenden Gewalt dieses Grundgesetz gegeben“. Führt also auch der Durchgang durch dieses zweite Argument zum schlichten Schluss, dass die liberale Einschränkung der Demokratie und der demokratische Mehrheitswillen gar nicht unbedingt im Widerspruch zueinander stehen, sondern immer nur aufeinander verweisen? Nicht zwingend.
Selbstbeschränkung des Supreme Court
Zunächst: Der Verweis auf einen demokratischen Verfassungssouverän überzeugt dann, wenn im Gründungsakt der Verfassung selbst die konstitutionelle Einhegung vorgesehen ist. Dort aber, wo oberste Gerichte sich erst im Verlaufe der Zeit verfassungsrechtliche Kompetenzen eigenmächtig zuweisen, wie im Falle der USA (die legendäre Malbury-v.-Madison-Entscheidung von 1803) oder wie in Israel, wo sich der Supreme Court in den 1990er Jahren in kühnster Weise selbst zu einem Verfassungsgericht aufgeschwungen hat (in einem Land, das keine geschriebene Verfassung kennt), ist diese Argumentationsfigur deutlich weniger belastbar. Wenig überraschend hat dann auch der US-SupremeCourt eine Doktrin entwickelt, in welchen Fällen er keine Zuständigkeit beanspruchen will und kann (seine sogenannte „political question doctrine“; bekanntlich kennen weder das Bundesverfassungsgericht noch der Europäische Gerichtshof solche Selbstbeschränkungen). Und wenig überraschend ist die „constitutional revolution“ in Israel bis heute hochgradig politisch umstritten, wie an den intensiven Konflikten über die israelische Justizreform des letzten Jahres abgelesen werden konnte.
Politische Eskalation vorprogrammiert
Aber es wird noch einmal komplizierter: mit dem Aufstieg der supranationalen Gerichtsbarkeit, nehmen wir den Europäischen Gerichtshof als Beispiel, ist die Rückbindung an einen demokratischen Verfassungssouverän – wie auch eine Austarierung richterlicher Macht durch demokratisch legitimierte politische Gegenmacht – weitgehend gelockert bis völlig abwesend. Der Europäische Gerichtshof hatte europäisches Recht auch erst nachträglich mit Direktwirkung und unmittelbarer Anwendbarkeit versehen – und damit seiner Auslegung dieses Rechts ultimativen Status auch über per parlamentarisch mehrheitlich verabschiedeten Gesetzen verliehen. Zugleich ist die Grundlage seines richterlichen Handelns – die europäischen Verträge – faktisch unabänderbar. Damit aber bekommen wir tatsächlich zunehmend liberale Rechte ohne demokratische Legitimierung von Macht – oder doch nur sehr schwacher. An dieser Stelle müssen wir also Möllers Antwort korrigieren. Doch, es gibt diese Kombination, und sie greift immer tiefer in unsere Lebenswelt ein: Liberalismus ohne oder mit nur sehr wenig Demokratie.
Der Populismusforscher Cas Mudde zielt mit seiner pointierten Formel, der Populismus sei eine „illiberale demokratische Antwort auf undemokratischen Liberalismus“, genau auf dieses zunehmend virulente Konfliktverhältnis ab. Es hilft nicht weiter, die populistischen Feinde dieser „liberalen Demokratie“ als Feinde der Demokratie abzukanzeln. Und es hilft nicht weiter, über das in unserer Gegenwart in seiner Bedeutung enorm gewachsene Spannungsfeld des Liberalen und des Elektoralen mit Pauschalformeln hinwegzugehen oder hinwegzusehen. Diesen „illiberalen Protest“ dann selbst wiederum vornehmlich mit rechtlichen Mitteln bekämpfen zu wollen, scheint mir ebenfalls eine ausgesprochen schlechte Idee zu sein und ein recht sicheres Rezept für weitere politische Eskalation.
Buchtipp
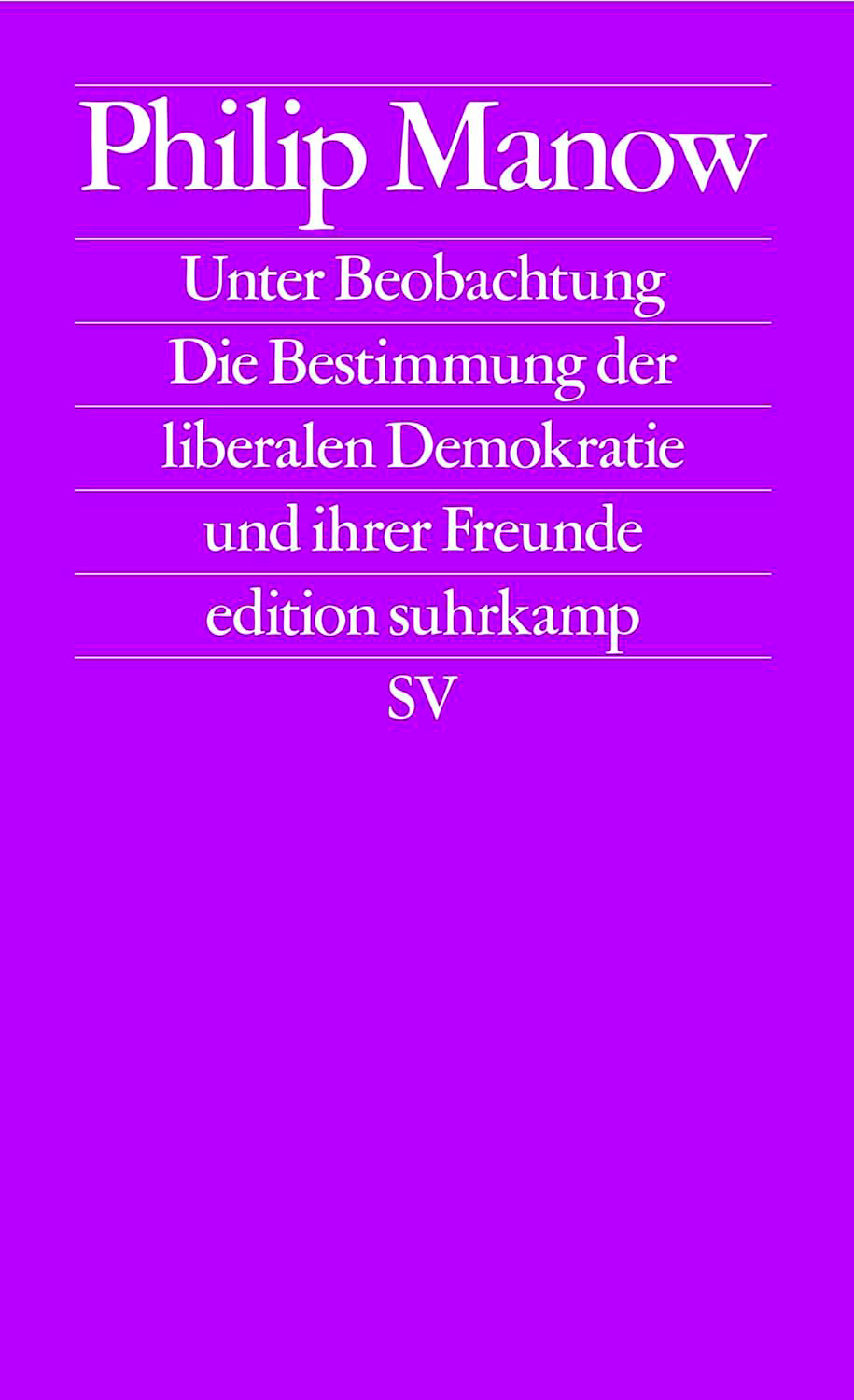
Philip Manow
Unter Beobachtung: Die Bestimmung der liberalen Demokratie und ihrer Freunde
Suhrkamp 2024,
252 Seiten, 18 Euro

Philip Manow ist Politikwissenschaftler und Professor für Internationale Politische Ökonomie an der Universität Siegen.







