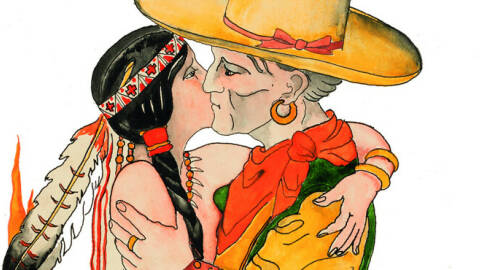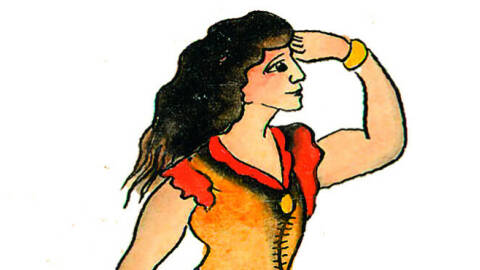Titelthema
Die neue deutsche Frage

Deutschland taumelt, und Italien nimmt es mit Schadenfreude zur Kenntnis. Dabei bräuchte das Land dringend einen starken deutschen Partner.
Mit einer Mischung aus Beunruhigung und versteckter Genugtuung, die in manchen Fällen in echte Schadenfreude umschlägt (ein Gefühl, das in der Dialektik der deutschitalienischen Beziehungen immer wieder auftaucht): So wird die tiefe Krise, die heute die Wirtschaft und das politische Leben in Deutschland kennzeichnet, von der öffentlichen Meinung im „bel paese“ und von den wichtigsten Analysten der Zeitungen und Zeitschriften beurteilt. Das beherrschende Element dieser pessimistischen Diagnose ist die Überraschung über das Ende der Stabilität des deutschen politischen Systems – einer Stabilität, die die Italiener bis gestern, vielleicht noch vor der bewunderten Effizienz des Wirtschafts- und Produktionssystems, als das entscheidende und begründende Element Deutschlands als Macht der Mitte Europas angesehen hatten. Ein Beleg für diese Art von Fassungslosigkeit ist die weitverbreitete Nostalgie für Angela Merkel und ihre sehr lange Regierungszeit, die auf den Seiten großer Zeitungen und in Talkshows als eine Art verlorenes goldenes Zeitalter des alten Kontinents gefeiert wird. Während es in Italien im gleichen Zeitraum zwischen 2005 und 2021 nicht weniger als zehn verschiedene Regierungen gab – von Berlusconi bis Draghi.

Dies ist natürlich eine fragwürdige Neuinterpretation der Geschichte: Es genügt, an die harsche Kritik zu erinnern, die dieselben Zeitungen und Talkshows an der sogenannten Sparpolitik geübt haben, die die Bundeskanzlerin und Deutschland Italien Mitte der 2000er Jahre während der Schuldenkrise angeblich „aufgezwungen“ haben. In Wirklichkeit hat Italien ein vitales Interesse daran, dass Deutschland seine politische Stabilität wiedererlangt, und vor allem daran, dass sich seine Wirtschaft erholen kann, denn Deutschland ist sein wichtigster Handelspartner, und der Wohlstand Italiens – das wird oft vergessen – hängt zu einem großen Teil von der Antriebskraft der „deutschen Lokomotive“ ab. Und da es nie ein gutes Zeichen für Europa ist, wenn Italiener und Deutsche sich nicht einig sind, könnte die Tatsache, dass die beiden Länder im November letzten Jahres einen Aktionsplan unterzeichnet haben, der zwar nicht formell, aber in der Praxis den gleichen Stellenwert hat wie der ÉlyséeVertrag zwischen Frankreich und Deutschland, die Entwicklung eines gemeinsamen europäischen Vorgehens begünstigen – angefangen bei dem inzwischen unausweichlichen Thema der Migrationskontrolle.
Natürlich ist es nicht das erste Mal, dass die deutsche Wirtschaft eine schwere Krise durchmacht: So wurde Deutschland zu Beginn dieses Jahrhunderts nach den gigantischen Anstrengungen für seine Wiedervereinigung vom Economist als „der kranke Mann Europas“ bezeichnet. Helmut Kohl (dem keine Kritik jemals seine historischen Verdienste schmälern kann) hatte eine lange Ära politischer Stabilität um den Preis eines systematischen Aufschubs notwendiger sozioökonomischer Reformen garantiert. Und selbst dann war ein Krieg, der durch die Auflösung des ehemaligen Jugoslawien ausgelöst worden war, zurückgekehrt, um Europa mit Blut zu beflecken (auch wenn er den euphorischen Glauben, die Wendezeit habe wirklich das Ende der Geschichte markiert, nicht trüben konnte). Doch die scheinbaren Ähnlichkeiten zwischen den Ereignissen vor einem Vierteljahrhundert und der heutigen Realität sind trügerisch. Tatsächlich hat sich das deutsche politische System nach den Wahlen von 1998 und der Bildung der rot-grünen Regierung unter Gerhard Schröder und Joschka Fischer als fähig erwiesen, einen radikalen Wandel im Regierungshandeln herbeizuführen – sowohl innenpolitisch als auch international. Die Verabschiedung der Agenda 2010, die von dem sozialdemokratischen Bundeskanzler nachdrücklich gewünscht wurde, ermöglichte eine radikale Reform des Sozialsystems und des Arbeitsmarktes, die Deutschland, wie Merkel selbst ehrlich einräumte, die Dividenden des Zeitalters der Globalisierung garantierte, indem sie das Land zum Exportweltmeister machte. In der Außenpolitik mit der militärischen Intervention an der Seite der Nato-Verbündeten zur Verteidigung des Kosovo im Zeichen von „Nie wieder Auschwitz“.
Auf Betreiben von Joschka Fischer brach Deutschland mit seinem selbst auferlegten absoluten Pazifismus. Seit den Wahlen 2021 ist nichts Vergleichbares mehr geschehen, und die von Scholz geführte Koalition hat sich als die vielleicht schwächste Regierung im Nachkriegsdeutschland erwiesen. Sie hat das gesamte politische System in eine Krise gestürzt, aus der es nur sehr schwer wieder herauskommen wird. Der nächste Bundeskanzler wird die Konsequenzen aus der Zeitenwende nach dem Ende der Ära des Freihandels und des Multilateralismus ziehen müssen. Das bedeutet, eine Agenda 2030 in Wirtschaft und Gesellschaft zu verwirklichen. Und in der Außenpolitik die Wählerinnen und Wähler davon zu überzeugen, dass die Sicherheit des Landes (und Europas) nicht mehr dem Wohlwollen der amerikanischen Führung anvertraut werden kann. Und dass es deshalb an Deutschland ist, in einer Welt, die vom Wettbewerb der Großmächte geprägt ist, die neue Verantwortung zu übernehmen, die sich aus den neuen geopolitischen Imperativen ergibt. Andernfalls wird bei den nächsten Wahlen der Extremismus von links und rechts die politische Agenda diktieren. Deshalb halte ich es nicht für übertrieben, von einer „neuen deutschen Frage“ zu sprechen. Es geht nicht nur um die Zukunft der deutschen Demokratie, sondern auch um die der Europäischen Union.

Bild: Laurent Burst
Weitere Artikel des Autors