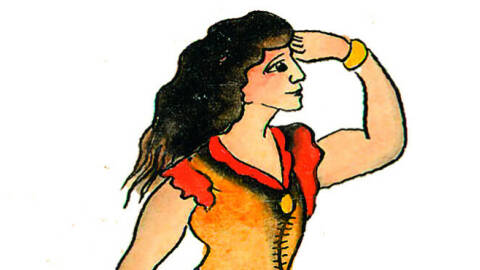Titelthema
Mitspielen, nicht entscheiden
Im Sport, so heißt es, sind die Aufstiegschancen für Menschen mit Migrationshintergrund besonders hoch. Stimmt das?
Der Applaus ist laut und anhaltend, als Otto Addo die Bühne verlässt. Mehr als 100 Gäste haben sich im Kölner Sportmuseum für eine Konferenz über Integration versammelt. Viele von ihnen bewundern Addo, den Sohn eines ghanaischen Arztes, der in Hamburg aufwuchs und oft Rassismus erdulden musste. Der aber mit Talent und Disziplin zum bekannten Profifußballer aufstieg, und fast 100 Bundesligaspiele bestritt.
Otto Addo scheint die Durchlässigkeit des Fußballs zu bestätigen, die man auch woanders beobachten kann. Bei der Europameisterschaft 2024 hatten von 26 deutschen Nationalspielern neun eine Ein wan derungs ge schich te, mehr als ein Drittel. Damit war die Mannschaft ein Sinnbild der deutschen Gesellschaft, in der knapp 30 Prozent einen Migrationshintergrund haben. Und in den Nachwuchsteams ist der Anteil migrantischer Spieler noch höher. Ob Bundestag, Dax-Konzerne oder Kultureinrichtungen: Nirgendwo ist Diversität so sichtbar wie auf dem Fußballplatz.
Und neben dem Platz? Laut dem „Mediendienst Integration“ hatten 2020 unter den 372 Mitgliedern der höchsten Gremien im Deutschen Fußball-Bund (DFB) nur vier Prozent eine Einwanderungsbiografie. In den Präsidien der Bundesligaclubs, in den Sportredaktionen oder in Marketingagenturen ist dieser Anteil oft noch geringer. Zugespitzt formuliert: Nichtweiße Menschen dürfen Fußball spielen, aber nicht die Entscheidungen darüber treffen.
„Es ist wichtig, dass Menschen, die von Rassismus betroffen sind, eine Stimme bekommen und dass sie empowert werden“, sagt Otto Addo. „Dass sie wissen, dass es große Brüder und große Schwestern gibt, die sich für sie interessieren.“ Addo ist Initiator und Vorsitzender von „Roots“, einem neuen Netzwerk gegen Rassismus im Sport. „Wir möchten dafür eintreten, dass die Vielfalt auch in den Führungsgremien des Fußballs wächst.“
Aber wie genau? Zunächst möchte Roots bei Vereinen und Sportverbänden dafür sensibilisieren, dass Rassismus nicht erst mit Anfeindungen auf der Tribüne beginnt, sondern dass rassistische Denkmuster tief in der Gesellschaft verwurzelt sind. Laut der repräsentativen „Mitte-Studie“ der Friedrich-Ebert-Stiftung stimmten mehr als 40 Prozent der Befragten der Aussage zu, dass „schwarze Menschen im Sport besonders talentiert“ seien. Ein Stereotyp, für das es keinen wissenschaftlichen Beleg gibt.
Zudem untersuchte das Berliner Institut für empirische Integrations- und Migrationsforschung (BIM) die Spielpositionen in der Ersten und Zweiten Bundesliga: Auf den laufintensiven Außenbahnen und vorne im Sturm waren überproportional häufig schwarze Spieler vertreten. Es sind Positionen, die mit Kraft, Ausdauer und Temperament verknüpft werden. Und Untersuchungen in England fanden heraus, dass die meist weißen Fernsehkommentatoren schwarze Fußballer eher für Athletik und Schnelligkeit lobten, weiße Spieler hingegen für Kreativität und Weitsicht.
Die Vorstellung von der intellektuellen Unterlegenheit und der körperlichen Überlegenheit schwarzer Menschen, die sich seit dem Kolonialismus hält, findet ihren Ausdruck also besonders im Fußball. „Wir wollen bei Roots über die Konsequenzen für die Betroffenen aufklären“, sagt Otto Addo. Studien legen nahe, dass RassismusErfahrungen bei Opfern zu Stress-Symptomen führen können, zu Verspannung, Erschöpfung, Depressionen. Oft müssen sie viel Energie dafür aufbringen, gängige Stereotype mit ihrem Verhalten nicht zu bestätigen, bewusst oder unbewusst.
„Auch ich wurde in meiner Jugend oft auf mein Fußballtalent reduziert“, sagt Pablo Thiam, der ab Mitte der 1990er Jahre mehr als 300 Bundesligaspiele bestritten hat, die meisten für Wolfsburg, Stuttgart und Köln. Rassismus? „Einige Trainer und Mitspieler haben mir damals gesagt, dass ich die Anfeindungen einfach abschütteln solle. Ich sollte mit guten Leistungen zeigen, dass ich über den Dingen stehe.“
Pablo Thiam, Sohn eines Diplomaten aus dem westafrikanischen Guinea, war Ende der 70er Jahre als Kind mit seiner Familie nach Bonn gekommen. Auf der Straße oder in Einkaufszentren wurde er angestarrt und angefasst, und immer wieder kamen Sätze wie: „Wo kommst du her?“ Thiam konnte die Sorgen und die Wut darüber auf dem Rasen in Energie umwandeln. Kompetente Ansprechpartner für Diskriminierung gab es während seiner Karriere nicht.
„Integration durch Erfolg“
Stattdessen Kampagnen mit griffigen Slogans wie „Mein Freund ist Ausländer“, „Zeig Rassismus die Rote Karte“ oder „Mach einen Strich durch Vorurteile“. Pablo Thiam findet diese Symbolik oberflächlich, er sagt: „Viele Leute nehmen diese Botschaften gar nicht mehr wahr.“ Und auch die Phrase „Integration durch Sport“ würde er anders formulieren, nämlich „Integration durch Erfolg“. Schwarze oder türkischstämmige Fußballer werden oft nur dann akzeptiert, wenn sie gute Leistungen zeigen. Wenn sie aber, wie im Fall des englischen Nationalteams im EM-Finale 2021 gegen Italien wichtige Elfmeter verschießen, dann bricht eine Welle der Ablehnung über sie herein. Pablo Thiam gehörte nach seiner Karriere zu den wenigen nichtweißen Funktionären im Spitzenfußball, als Nachwuchschef beim VfL Wolfsburg und später bei Hertha BSC in Berlin. „Bei Trainerseminaren oder Fortbildungen war ich fast immer der einzige schwarze Vertreter im Saal“, sagt er. „Für mich war das normal, ich konnte damit umgehen. Doch andere würden sich vielleicht beobachtet und kontrolliert fühlen. Deshalb müssen wir an der Basis ansetzen.“
Zur Basis des Fußballs gehören 25.000 Vereine. Die Menschen, die sich dort ehrenamtlich als Vorsitzende, Schatzmeister oder Trainerinnen engagieren, brauchen dafür Freizeit, einen finanziellen Spielraum und verständnisvolle Arbeitgeber. Wenn sie es in den Vorstand eines Verbandes oder ins Präsidium eines Proficlubs schaffen wollen, müssen sie meist jahrelang Kontakte knüpfen, manchmal jahrzehntelang. „Menschen mit Migrationshintergrund, die auf dem Arbeitsmarkt oder in der Schule Diskriminierung erleben, sind da im Nachteil“, sagt Thiam. „Deshalb sollte der Sport Barrieren abbauen.“
Aber wie genau? In den USA führte die NFL im American Football die „Rooney-Rule“ ein, benannt nach dem früheren Eigentümer der Pittsburgh Steelers, Dan Rooney. Diese Regel besagt, dass für freie Trainerposten auch nichtweiße Kandidaten zum Vorstellungsgespräch eingeladen werden müssen. Der englische Fußballverband FA hat diese Regel adaptiert und auch ein Quotenmodell eingeführt: Bis 2028 sollen mindestens 25 Prozent der Trainer und Trainerinnen einen Migrationshintergrund haben. „Im deutschen Fußball trauen sich viele nicht an die Quoten-Diskussion heran“, sagt Younis Kamil. „Man möchte nicht das Narrativ bedienen, dass man Migranten etwas schenkt. Deshalb müssen wir mehr über den Kontext aufklären.“
Younis Kamil ist als Trainer und Vorsitzender beim Club Al Hilal im Bonner Stadtteil Pennenfeld aktiv, wo viele Menschen aus Einwandererfamilien auf engem Raum leben. Fast alle Spieler haben Eltern oder Großeltern, die nach Deutschland eingewandert oder geflüchtet sind. „Wir möchten unseren Mitgliedern früh Verantwortung übertragen“, sagt Kamil. „Damit sie ihre Gemeinschaft selbstbewusst und mit Empathie mitbestimmen können.“
Kamil gibt den Jugendlichen früh zu verstehen, dass eine Profikarriere für sie unwahrscheinlich ist. Er betont Bildung und schaut regelmäßig in die Zeugnisse seiner Spieler. Wer Probleme in der Schule hat, kann im Vereinsumfeld Nachhilfe erhalten. Kamil fördert Selbstreflexion, Dialogbereitschaft, Kritikfähigkeit. So ebnet er ihnen die Entwicklung zum Trainer, Gruppenleiter oder Verantwortlichen für soziale Medien.
Hilfe bei der Integration
In den vergangenen drei Jahren hat der Sportwissenschaftler Kamil zu Diversitätsfragen im Sport geforscht. Wichtig sei es für Vereine, sagt er, intensiver auf Menschen mit Einwanderungsgeschichte zuzugehen. Sportverbände sollten Kieze besuchen, Broschüren in mehreren Sprachen anbieten, Förderanträge erläutern. Sie könnten bei der Jobvergabe auf anonymisierte Bewerbungsverfahren setzen, um den Vorurteilen gegenüber nicht deutsch klingenden Namen weniger Raum zu geben. Und sie könnten Praktika, Minijobs oder Stipendien vergeben.
Doch selbst wenn Personen mit Einwanderungsgeschichte durch eine Quote aufrücken würden, bedeutet das nicht, dass sie sich dort auch entfalten und ihre Talente einbringen können. Wichtig sei es, sagt Younis Kamil, dass Verbände diese Maßnahmen ausführlich erläutern und auch den historischen Kontext von jahrzehntelanger Ausgrenzung thematisieren. Im Jahr 2030 werden 50 Prozent der unter 18-Jährigen in Deutschland einen Migrationshintergrund haben. Wenn der Vereinssport langfristig stabil bleiben will, sucht er auch in dieser Gruppe seine künftigen Entscheider.
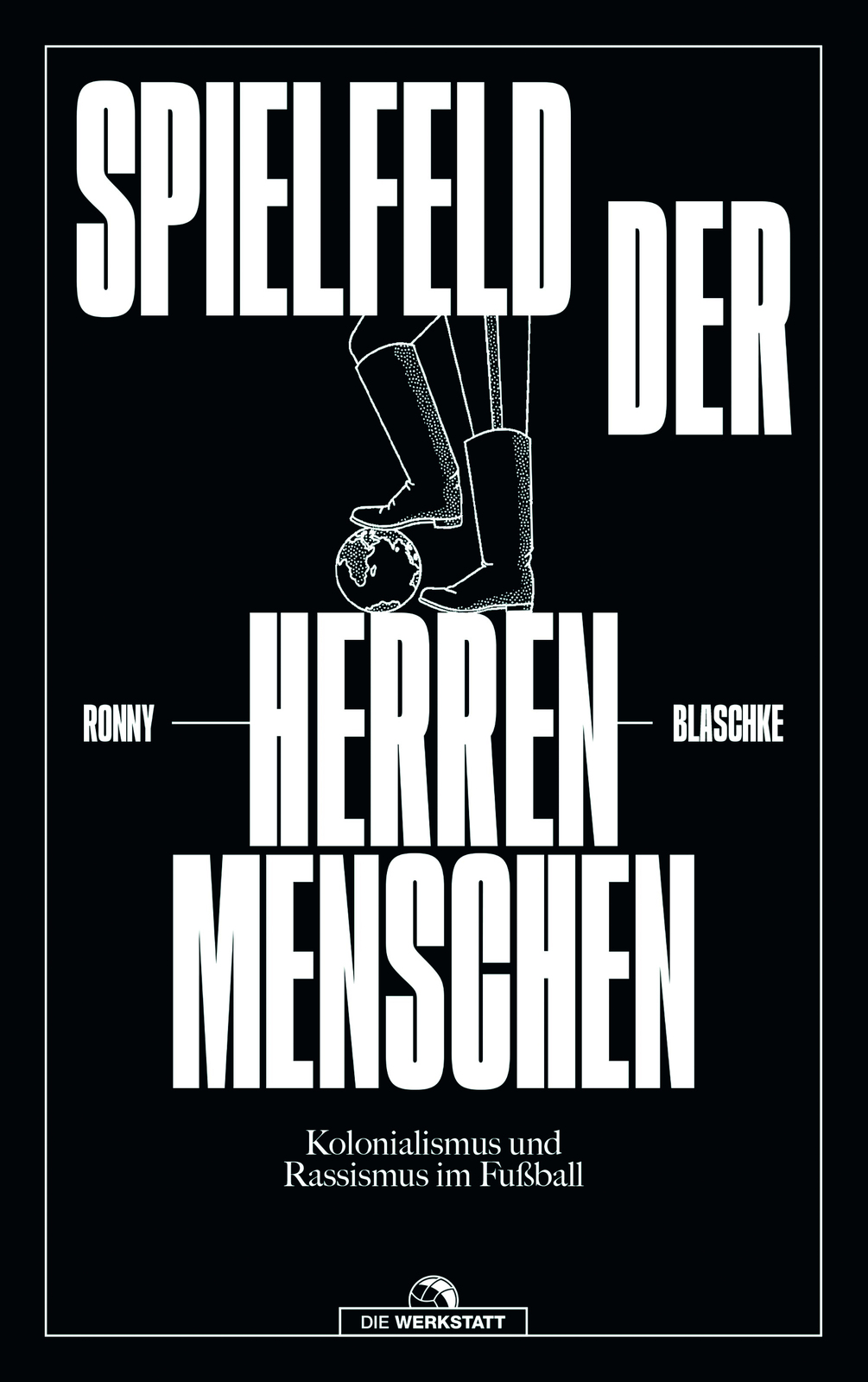
Ronny Blaschke
Spielfeld der Herrenmenschen
Verlag Die Werkstatt 2024,
256 Seiten, 22 Euro

Ronny Blaschke ist als Journalist auf politische Themen im Sport spezialisiert. Mit „Spielfeld der Herrenmenschen“, seinem sechsten Buch, möchte er eine Debatte über Kolonialismus und Rassismus im Sport anstoßen.
© Sebastian Wells