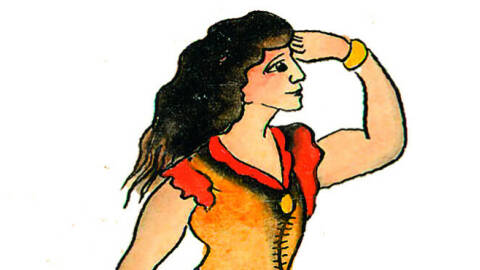Forum
Ein letzter Friedenssommer?

Einige Experten rechnen mit dem Schlimmsten, aber wie plausibel ist die Annahme eines russischen Angriffskrieges auf die baltischen Republiken wirklich?
Im Sommer 1914 dachte kaum jemand an Krieg. Die Menschen fuhren, sofern sie sich das leisten konnten, in Urlaub oder genossen anderweitig das anhaltend schöne Wetter. Gut, es gab die politischen Verwicklungen auf dem Balkan, die Ermordung des österreichischen Thronfolgers Franz Ferdinand in Sarajewo – aber wann hatte es zuvor keine Probleme auf dem Balkan gegeben? Es hatte dort bereits zwei kurze Kriege um die Verteilung der Konkursmasse des Osmanischen Reichs gegeben, aber die waren zeitlich und räumlich begrenzt geblieben. Selbst wenn es jetzt zu einem dritten Balkankrieg kommen würde, so sagten sich die politisch Interessierten, würde auch der wohl kurz und auf Serbien begrenzt sein. Es kam anders: Der Konflikt zwischen dem Habsburgerreich und Serbien wurde zum Ausgangspunkt des Ersten Weltkriegs, der die lange Friedensperiode Europas beendete und die politische wie gesellschaftliche Ordnung in Europa grundstürzend veränderte. Die Erinnerung an den Sommer 1914 war bis vor Kurzem eine historische Reminiszenz an Zeiten, von denen man mit guten Gründen annehmen konnte, dass man sie endgültig hinter sich gelassen hatte. Das hat sich inzwischen geändert: Zwar herrscht zurzeit keine Vorkriegsstimmung in Europa, auch wenn die von einigen Putin nahen Populisten in Deutschland geschürt wird. Aber eine solche Stimmung gab es im Sommer 1914 ja auch nicht. Es gibt freilich ein paar ernst zu nehmende Stimmen, die befürchten, dass dies der letzte weithin sorglose Sommer in Europa sein könnte. Der Krieg, der bislang auf die Ukraine beschränkt war, könnte auf das Baltikum übergreifen und Artikel 5 des Nato-Vertrags aktivieren, womit alle Nato-Staaten zur Verteidigung der baltischen Republiken verpflichtet wären. Wie plausibel ist ein solches Szenario?
Unsere Angst, Putins Freude
Halten wir als Erstes fest: Im Gegensatz zu 1914 ist unsere Gegenwart von Angstwellen, Niedergangstheorien und Schreckensvisionen geprägt. Das macht viele empfänglich für die Vorstellung, es könne ein Krieg ausbrechen, der alle Fortschritte und Aufbauleistungen der letzten Jahrzehnte zunichtemachen werde. Das ist nicht nur ein Szenario, das Sicherheitsspezialisten, Historiker und Politikwissenschaftler durchspielen, weil sie den Worst Case auf dem Schirm haben müssen, sondern zugleich ein Narrativ, mit dem sich in politischer Absicht Ängste bewirtschaften lassen. Es ist ein Narrativ, das Putin und den Strategen im Kreml, immerhin den Angreifern in der Ukraine, in die Hände spielt, weil es die Europäer – und vor allem die Deutschen – verschrecken und dazu bringen soll, die russischen Forderungen widerspruchs- und widerstandslos zu akzeptieren. In vorauseilendem Gehorsam sollen sie alles unterlassen, was sich in irgendeiner Weise als eine Unterstützung der Ukraine verstehen lässt. Oder was als Aufrüstung zwecks Abschreckung der russischen Führung aussieht. Das Narrativ soll ängstigen und Schrecken einjagen, damit die Gegenseite ihren Willen ohne Risiken und Anstrengungen durchsetzen kann. Es ist somit ambig: Es kann zu energischer Aufrüstung auffordern, um den potenziellen Angreifer abzuschrecken, aber ebenso kann es nahelegen, alles dieser Art tunlichst zu unterlassen.
In Erwartung des Schlimmsten
Die Menschen im Sommer 1914 waren im Unterschied zu uns heute nicht von sich epidemisch ausbreitenden Angstwellen gepeinigt. Sie glaubten in ihrer überwiegenden Mehrheit an den Fortschritt: an den sozialen Aufstieg wie an einen sich weltweit ausbreitenden Frieden, in der Summe an eine durchweg bessere Zukunft. Das hätte man von den Deutschen und den meisten Menschen in Europa vor 20 Jahren vermutlich auch sagen können; nach der Aufeinanderfolge von Eurokrise, Migrationskrise, Covid19-Pandemie und der Rückkehr kriegerisch-imperialer Bestrebungen nach Europa ist das jetzt anders: Wir haben es uns abgewöhnt, Horrorszenarien für eine Spinnerei oder einen Blockbuster aus Hollywood zu halten. Wir rechnen ständig mit dem Schlimmsten. – Aber wie plausibel ist die Annahme eines russischen Angriffskrieges auf die baltischen Republiken wirklich? Solange der Krieg in der Ukraine weitergeht, ist die russische Armee im Schwarzmeerraum gebunden. Ihre erheblichen Verluste sind zwar immer wieder mit Freiwilligen und Wehrpflichtigen aufgefüllt worden, aber die Verluste an erfahrenen Soldaten und Offizieren dürften sie doch erheblich geschwächt haben. In der Folge wird sie, selbst wenn der Krieg jetzt enden würde, einige Jahre zur Rückgewinnung ihrer Kampfkraft brauchen. Andererseits handelt es sich um eine Armee mit großer Kriegserfahrung, was für die europäischen Nato-Truppen nicht gilt. Dennoch wird man bezweifeln dürfen, dass die Kremlführung nach dem Ende des Ukraine-Kriegs sogleich den nächsten Krieg beginnen wird. Immerhin muss sie befürchten, dass sie dann auf den Widerstand von erheblichen Teilen ihrer Bevölkerung stoßen würde, die ebenfalls kriegsmüde ist. Aber wird Putin darauf Rücksicht nehmen? Oder wird ihm die Angst vor den sozioökonomischen Folgen, die mit der Umstellung einer Kriegs- auf eine Friedenswirtschaft verbunden sind, derart zusetzen, dass er lieber umgehend in den nächsten Krieg zieht? Es würde sich dann um strukturelle Zwänge handeln, von denen politische Kalküle überwältigt werden. Oder wird die russische Führung, was das Wahrscheinlichste ist, ihre Kriegswirtschaft auf kleiner Flamme halten, sodass sie diese jederzeit wieder hochfahren kann, wenn es ihr opportun erscheint? Dann hätten die Europäer genügend Zeit, um ihrerseits eine starke Abschreckungsmacht aufzubauen. In diesem Sinn ist die Ukraine gegenwärtig tatsächlich der Verteidiger Europas.
Aber hat Putin überhaupt die Absicht, nach einem erfolgreich beendeten Krieg in der Ukraine weiter mit militärischen Mitteln Russland territorial zu vergrößern? Oder ging es ihm tatsächlich nur, wie die russischen Erklärungen es verbreiten, um die Verhinderung eines Nato-Beitritts der Ukraine? Folgt man dem russischen Narrativ, was mindestens zwei politische Parteien in Deutschland tun, so war und ist Russland beim Krieg in der Ukraine kein Angreifer, sondern ein Verteidiger, und Putin wäre tatsächlich saturiert, wenn er die Ukraine als souveränen Staat vom Schachbrett der Geopolitik entfernt hätte. Dagegen spricht freilich, dass es ihm augenscheinlich um den gesamten Schwarzmeerraum geht, ein Gebiet, das die russische Politik seit Katharina der Großen beschäftigt hat. Der Georgien-Krieg von 2008 und die jüngsten Wahlbeeinflussungen in Rumänien sowie der fortgesetzte Druck auf die Republik Moldau zeigen, dass der Kreml in großem Stil die Anrainerstaaten des Schwarzen Meeres unter seine Kontrolle bringen will. Ist das so, dann ist damit zu rechnen, dass er als Nächstes sein Augenmerk auf den Ostseeraum und dort insbesondere auf das Baltikum legen wird, wo Russland seit Peter dem Großen die führende Macht war – es aber nicht mehr ist und es darum wieder werden will. Das spricht dafür, dass dort mit dem nächsten großen Konflikt zu rechnen ist.
Europa muss aufwachen
Es ist wahrscheinlich, dass Putin, wenn es denn dazu kommt, den Versuch einer Ausweitung russischer Präsenz in diesen Raum nach dem Drehbuch der UkraineDestabilisierung prozedieren dürfte. Das heißt, dass der Konflikt nicht gegen Litauen und den Suwalkikorridor beginnt, der zwischen Belarus und der russischen Enklave Kaliningrad liegt, sondern in Estland, wo eine große russische Minderheit lebt, von der sich behaupten lässt, sie werde von der estnischen Regierung benachteiligt und unterdrückt. Deswegen hätten sich bewaffnete Selbstverteidigungseinheiten gebildet, die nun von russischen Truppen unterstützt würden. Ob man sich im Kreml einen solchen Schritt zutraut, der ein Angriff auf ein Nato-Land wäre, dürfte entscheidend davon abhängen, wie Putin die Europäer und ihre Fähigkeit sowie Bereitschaft zur Gegenwehr einschätzt. Und ob er, wenn denn der nukleare Schutzschirm der USA über Europa löchrig oder gar eingeklappt worden ist, davon ausgeht, dass er die Europäer mit nuklearen Eskalationsdrohungen einschüchtern und von der Verteidigung der baltischen Republiken abhalten kann. Ist das der Fall, dann wird es nicht bei einer militärischen Übernahme Estlands bleiben, sondern dann wird es als Nächstes um Lettland und Litauen gehen. Dann wäre Europa im Krieg. Das ist freilich ein Szenario, das erst am Ende dieses Jahrzehnts möglich ist. Und dessen Eintritt sich durch den Aufbau umfassender Abschreckungsfähigkeiten verhindern lässt. Nachlässigkeit und Schläfrigkeit der Europäer dagegen könnten befördern, dass es doch so weit kommt.
1914
Im Sommer 1914 gab es, ähnlich wie heute, in weiten Teilen der Bevölkerung keine Kriegsangst. Die Stimmung kippte in eine Kriegslust, als von der Politik propagiert wurde, dass die Sowjetunion der Angreifer sei.
1933
Adolf Hitler und Ernst Röhm waren im Sommer 1933 auf dem Reichsparteitag in Nürnberg. Als Demonstration der Macht ließ Hitler auf dem „Reichsparteitag des Sieges” die SA aufmarschieren.
1999
Zuvor schon im Amt, legte Putin am 7. Mai 2000 im Beisein des vorherigen Staatspräsidenten Boris Jelzin seinen Amtseid ab. Heute gilt Russland unter Putin wieder als Hauptgegner der Nato.
2022
Im Februar 2022 überfiel Russland die Ukraine. Mehr als drei Jahre später hat sich der Konflikt zu einem Abnutzungskrieg entwickelt, bei dem bislang mehr als 12.000 ukrainische Zivilisten starben.

© Ralf und Heinrich