Forum
Rivalität als Normalzustand
Wenn sich das Ziel ökonomischen Vorteils mit politischem und militärischem Dominanzstreben verbindet: Werner Plumpe unternimmt einen historischen Ritt durch die Geschichte der Wirtschaftskriege.
Rechnet sich das? Ein Wirtschaftskrieg? Ob sich Donald Trump diese Frage schon gestellt hat? Zumindest ausreichend genug? Der amerikanische Präsident sollte Werner Plumpe fragen. Der emeritierte Professor für Wirtschafts- und Sozialgeschichte an der Johann-Wolfgang-Goethe-Universität in Frankfurt am Main hat nicht nur einen historischen Ritt durch die bisherigen Wirtschaftskriege unternommen – definiert als Konflikte um Macht und Vorteile im zwischenstaatlichen Handel und bei der Organisation und Strukturierung von grenzüberschreitenden wirtschaftlichen Austauschprozessen. Auch veranschaulicht er nicht nur, dass Phasen geregelter und friedlicher ökonomischer Arbeitsteilung mit heftigen Konflikten wechselten, die von Momenten des Wirtschaftskrieges bis hin zu gewaltsam ausgetragenen Auseinandersetzungen geprägt waren. Plumpe wirft darüber hinaus die Frage auf, wann diese Rivalitäten, die er für den historischen Normalzustand hält, gefährlich werden und das Potenzial besitzen, die Regeln der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit – letztlich zum Nachteil aller – zu zerstören.
Um diese Frage beantworten zu können, verweist Plumpe auf einen grundlegenden Konflikt, der keine Frage der Moral, sondern Ausdruck eines objektiv existierenden Problems sei und hinter dem Auf und Ab von Wirtschafts- und Handelskriegen liege. Es geht hierbei um eine Problemstellung, die in der Tat bis zum heutigen Tag besteht, gespiegelt nicht zuletzt in der erneuten Präsidentschaft von Trump, in der einmal mehr die Frage aufgeworfen wird, ob die Kosten der Schaffung und Aufrechterhaltung einer Ordnung rechtfertigen, dass deren Träger die Vorteile dieser Ordnung allein oder zumindest vorrangig für sich in Anspruch nehmen und andere davon ausschließen darf.
Oder müsse dieser Träger es hinnehmen, wie Plumpe fragt, dass andere, obwohl sie für die Kosten nicht aufkämen, nicht nur vom Rahmen dieser Ordnung profitierten, sondern ihn sogar mit erheblich geringerem Aufwand nutzen könnten und sich so große wirtschaftliche Vorteile verschafften, gerade weil sie die Kosten nicht oder kaum trügen.
Je nachdem, wie dieser Konflikt reguliert oder auch nur wahrgenommen wurde, entwickelten sich gemäß Plumpes geschichtlichem Überblick Rivalitäten unter Umständen zu produktivem wirtschaftlichen Wettbewerb – oder es kam zu gefährlichen Konfrontationen, speziell dann, wenn sich das Ziel des ökonomischen Vorteils mit politischem und militärischem Dominanzstreben verband.
Neue Eroberungsfantasien
Nach Plumpes Analyse geht es wie in der Auseinandersetzung um die beste Ausgangslage bei der Ausbeutung der sogenannten Neuen Welt im 16. Jahrhundert auch heute wieder um die besten Positionen bei der Nutzung der vielversprechenden Zukunftsräume des ökonomischen und technologischen Wandels, die freilich nicht mehr territorial gebunden seien, sondern zunehmend in die digitale Welt der globalen Kommunikation quasi grenzenlos diffundierten. Gerade diese Grenzenlosigkeit, die mit jedem technologischen Schub nicht nur weiter zunehme, sondern zugleich ökonomische, politische, kulturelle und nicht zuletzt militärische Handlungschancen und -zwänge hervorbringe, macht den Cyberspace in Plumpes Wahrnehmung zu einer Art Schlachtfeld, auf dem es neben den Versuchen zur Regulierung vor allem darum gehe, die eigene technologische Handlungsfähigkeit zu sichern.
Zwar dominiert der amerikanisch-chinesische Konflikt auch nach Plumpes Darstellung derzeit die Vorstellungen von Wirtschaftskriegen, sehe man von dem Versuch ab, Russland im Ukraine-Krieg wirtschaftlich in die Knie zu zwingen. Doch mahnt er zu Recht, sich nicht dazu verführen zu lassen, die gegenwärtigen Konflikte und Prozesse des ökonomischen Strukturwandels in anderen Teilen der Welt zu vernachlässigen, die wiederum politische Gewichtsverteilungen infrage stellten – ob in Afrika oder im Nahen Osten, in Lateinamerika oder Südasien.
Daraus leitet Plumpe ein realistisches Szenario ab: Aus einer klaren Ordnung mit nur zwei entscheidenden Akteuren – den Vereinigten Staaten und der Sowjetunion in der bipolaren Welt vor 1990, danach für einige Zeit mit nur einem großen Akteur, den USA – sei mittlerweile eine offene Situation geworden, in der niemand bedeutend genug sei, um eine Ordnung zu ermöglichen, geschweige denn zu erzwingen. Das bisherige Erfolgsrezept der durch einen dominanten Akteur geprägten inklusiven Ordnung, die auf Anreize setze und nicht auf Zwang, sei im Licht von Chinas Aufstieg nicht mehr möglich.
Erratisch und doch zielstrebig
Die zentrale Frage lautet daher nun auch für Plumpe, was an deren Stelle treten wird: ein permanenter Konflikt, der jederzeit eskalieren könne, oder eine multilaterale Kooperation, in der bei allen Interessengegensätzen die Orientierung am gemeinsamen ökonomischen Nutzen vorherrschend sei. Letzteres liefe auf eine permanente Neuaushandlung von Beziehungen und ihren konkreten Strukturen hinaus, einen laufenden Balanceakt zwischen politischer Rivalität und dem Nutzen ökonomischer Kooperation, der keine wirkliche Stabilität kenne, sondern vielmehr mit all den Unwägbarkeiten des historischen Wandels rechnen müsse.
In Trumps Wirtschaftsdiplomatie erkennt Plumpe auch eine Antwort darauf und nicht nur ein Risikospiel. Zwar sei der Stil des amerikanischen Präsidenten erratisch, sprunghaft, ja launisch. Aber hart verhandeln, Deals und Kompromisse schließen und dadurch eine Art Fließgleichgewicht konkurrierender Interessen zu erreichen, das stets neu auszuhandeln sei – all das könne die Zukunft der Weltwirtschaft nach dem Auslaufen der Pax Americana kennzeichnen.
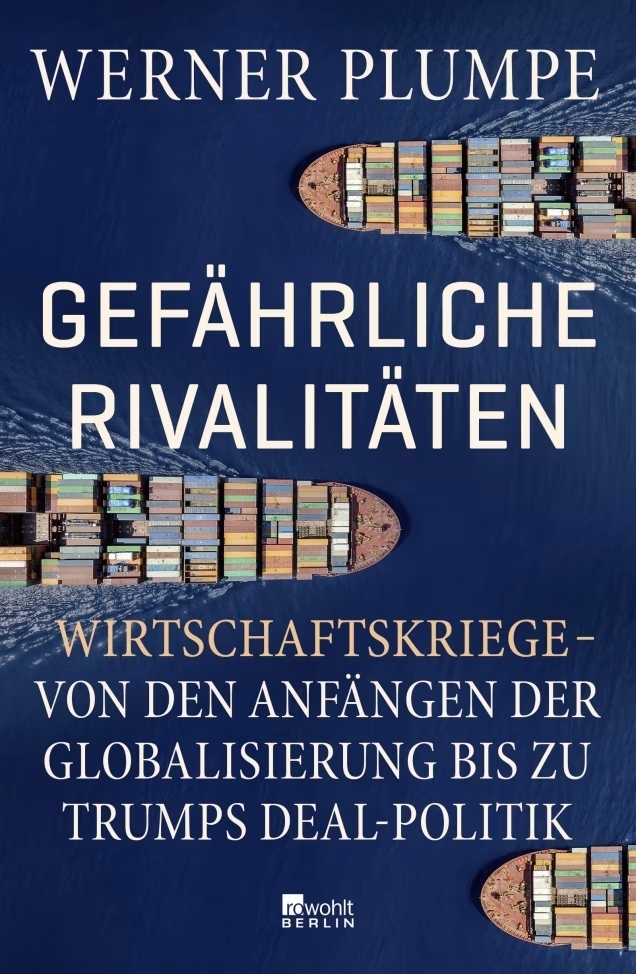
Dies setze jedoch voraus, dass die USA ihren relativen Bedeutungsverlust letztlich akzeptierten und nicht versuchten, sich gewaltsam gegen die neuen Verhältnisse zu behaupten oder gar die wirklichen oder vermeintlichen Gegner zu dominieren oder zu Fall zu bringen. Was bei Plumpe auch für andere Akteure gilt: Zu glauben, eine Situation sei erreichbar, in der eine Seite den Ton angebe und die anderen folgten, sei unrealistisch. Ob sich Trump diese Fragen auch schon gestellt hat? Zumindest ausreichend genug?
Werner Plumpe: Gefährliche Rivalitäten
Wirtschaftskriege – von den Anfängen der Globalisierung bis zu Trumps Deal-Politik. Rowohlt Berlin 2025, 319 Seiten, 25 Euro

Dr. Thomas Speckmann ist Historiker und Politikwissenschaftler und hat Lehraufträge an den Universitäten Bonn, Münster, Potsdam und der FU Berlin wahrgenommen.
© Laurence Chaperon
Weitere Artikel des Autors







