Titelthema
Rückkehr des Nationalismus
Globalisierungskritik kommt von links wie von rechts, jedoch unterschiedlich motiviert. Von Antiimperialisten und solchen, die ans Kultur- und Blutsvolk appellieren.
Die appellative Anrufung der eigenen Nation erlebt seit einigen Jahren eine massive Konjunktur, international gewiss am deutlichsten durch das zentrale Wahlkampfmotiv des heutigen amerikanischen Präsidenten Donald Trump, „Make America great again“, symbolisiert. Zugleich feiern rechtsextreme Parteien in Europa nachhaltige Erfolge, die migrationsfeindlich ausgerichtet sind, die Globalisierung ablehnen und einer Stärkung der eigenen Nation, oft verbunden mit einem politischen und/oder ökonomischen Protektionismus, das Wort reden. Es liegt auf der Hand, für diese Phänomene die Renaissance der Ideologie des Nationalismus verantwortlich zu machen, denn: Die rhetorischen Strategien beziehen sich nur allzu oft auf „die Nation“, es geht immer um das „Eigene“ und das „Fremde“.
Unsere Vergangenheit, Gegner, Ziele
Der historisch-systematische Blick auf die Geschichte des Nationalismus zeigt aber, dass eine genauere Fokussierung vonnöten ist, um zu versehen, welche Formen des Nationalismus hier eine Renaissance erleben – und warum diese nur allzu oft verbunden sind mit einer nationalprotektionistischen Haltung, die gleichermaßen die Globalisierung verantwortlich macht für die eigene Krise. Nationalismus lässt sich in den Worten des Soziologen Norbert Elias als „eines der mächtigsten, wenn nicht das mächtigste soziale Glaubenssystem des 19. und 20. Jahrhunderts“ beschreiben. Er stellt ein insbesondere entlang der zugeschriebenen kollektiven Identität von Sprache, Kultur, Religion und Geschichte konstruiertes Weltbild dar, das der sozialen Kreation, politischen Mobilisierung und psychologischen Integration eines großen Solidarverbandes – eben der späteren Nation – dient.
Die Nation fungiert dabei zunächst lediglich als eine „vorgestellte Gemeinschaft“ (Benedict Anderson), die unter Einbezug der Traditionen eines Herrschaftsverbandes entwickelt und peu à peu durch den Nationalismus als Handlungseinheit geschaffen wird. Als Phänomen der Neuzeit ist Nationalismus verknüpft mit einer Politisierung der Begriffe Volk und Nation, deren vorher separat abrufbare schichten- und gruppenspezifische Verwendungen vereinheitlicht und dabei zugleich ideologisiert wurden – stets verknüpft mit einer in die Zukunft gerichteten, scheinbaren Offenheit. Insofern schafft der Nationalismus als Integrationsideologie das Bewusstsein der Zusammengehörigkeit, verknüpft mit der Erkenntnis, über eine gemeinsame Vergangenheit zu verfügen, gemeinsame Gegner wie auch gemeinsame Ziele für die Zukunft zu haben. Die Nation firmiert dabei sittlich, politisch, sozial und historisch als „Letztwert“ (Dieter Langewiesche) beziehungsweise „Letztinstanz“ (Reinhart Koselleck) und damit als oberste Legitimationsquelle, hinter die es kein Zurück gibt und die durch keine andere Instanz in ihrer Wirkungsmächtigkeit zu überbieten ist.
Bei allen Gemeinsamkeiten nationaler Ideologie liegt die mit Blick auf ihre integrative oder desintegrative Wirkung entscheidende Differenz zwischen Typen des Nationalismus letztlich in der inhaltlichen Konkretisierung der zunächst für den Nationalismus als solches konstitutiven Innen-Außen-Relation. Denn die Frage, wer dazugehören darf und wer nicht, wird im – wie der Nationalismusforscher Anthony D. Smith es nannte – „civic model of the nation“ grundsätzlich anders beantwortet als in der „ethnic conception of the nation“. Idealtypisch betrachtet begründet die „civic nation“ ihre In- und Exklusionsvorstellungen durch das politische Bekenntnis und den erklärten Willen der Zugehörigkeit zur Nation und bindet sie an die freie Selbstbestimmung des Individuums. In der Theorie der „ethnic nation“ wird der Nation hingegen eine ethnische Interpretation als Volk zugrunde gelegt. Der Begriff des Volkes wird hier nicht in seiner vormodernen, situativen Bedeutung im Sinne von Masse oder Untertanen verstanden, sondern in seiner existenziellen, völkischen Bedeutung als „Kultur- und Blutsvolk“. Dieser ethnische Nationalismus strebt eine Identität und Homogenität von Angehörigen der ethnischen Gruppe, des von ihr besiedelten Territoriums und der formalen Zugehörigkeit zu der jeweiligen staatlichen Organisation an, ist also strukturell desintegrativ und gegen die faktische Realität moderner Gesellschaften als gesellschaftlich heterogene Orte fortwährender Migration gerichtet.
Und genau diese Differenzierung ist der zentrale Punkt: Es sind eben Konzepte des ethnischen Nationalismus, die Homogenität und Abgrenzung wollen – und nicht der Nationalismus als solcher. Ethnischer Nationalismus ist immer kulturalistisch geprägt, das heißt, er geht von einem mehr oder weniger unabrückbaren „Eigenen“ aus, das stets „von außen“ als gefährdet unterstellt wird. Republikanischer Nationalismus hat hingegen einen universalistischen Anspruch, man entscheidet sich nach politischen Willenskriterien, ob man dazugehören möchte oder nicht, insofern steht letzterer nicht zwingend im Widerspruch zu ökonomischen Globalisierungsprozessen.
Nun lässt sich die hier formulierte Unterscheidung, die man sozialwissenschaftlich idealtypisch nennen würde, freilich leichter auf dem Papier attestieren als wirklich so eindeutig abgrenzbar in der gesellschaftlichen und politischen Realität – oft überlappen beide Konzepte in bestimmten Punkten, es entstehen Widersprüche in der Realität, die man auf die beiden Idealtypen von Nationalismus zurückführen kann. Dennoch lässt sich festhalten: Die idealtypische Unterscheidung hilft zu verstehen, welche Denkprinzipien einem bestimmten Typ von Nationalismus zugrunde liegen – und warum sich dieser mit einer Antiglobalisierungshaltung verbindet, die man in der extremen Rechten bereits seit mehreren Jahrzehnten als immer dominanter werdende Grundhaltung ausmachen kann.
Gleich, aber anders
Dieser Antiglobalisierungshaltung in der extremen Rechten liegt aber nicht nur ein ethnischer Nationalismus zugrunde, sondern auch ein Antiliberalismus, sowohl politisch wie ökonomisch. Und dieser Antiliberalismus ist der Grund, weshalb sich in diesem Antiglobalisierungsanliegen die extreme Rechte mit Teilen der extremen Linken trifft, deren globalisierungsfeindliches Motiv aber selten nationalistisch, sondern „antiimperialistisch“ ist und sich in einem spezifischen Verständnis gegen die mit der Globalisierung verbundene ökonomische Ungleichheit wendet. Ist es seit jeher eigentlich Grundlage sozialistischer Überzeugungen, für ökonomische Gleichheit einzutreten und dies mit einem internationalistischen Verständnis zu verbinden, weicht die so genannte antiimperialistische Linke von dieser traditionellen Vorstellung markant ab: Sie denkt nicht mehr global, sondern in nationalen Kategorien, die sie mit starrem Freund-Feind-Denken verbindet (das freilich in seiner Grundidee eigentlich aus dem rechtsextremen Denkarsenal der Weimarer Republik stammt), und trifft sich in diesem Anliegen mit der extremen Rechten: antiliberal, national-homogen, globalisierungsfeindlich.
Buchtipp
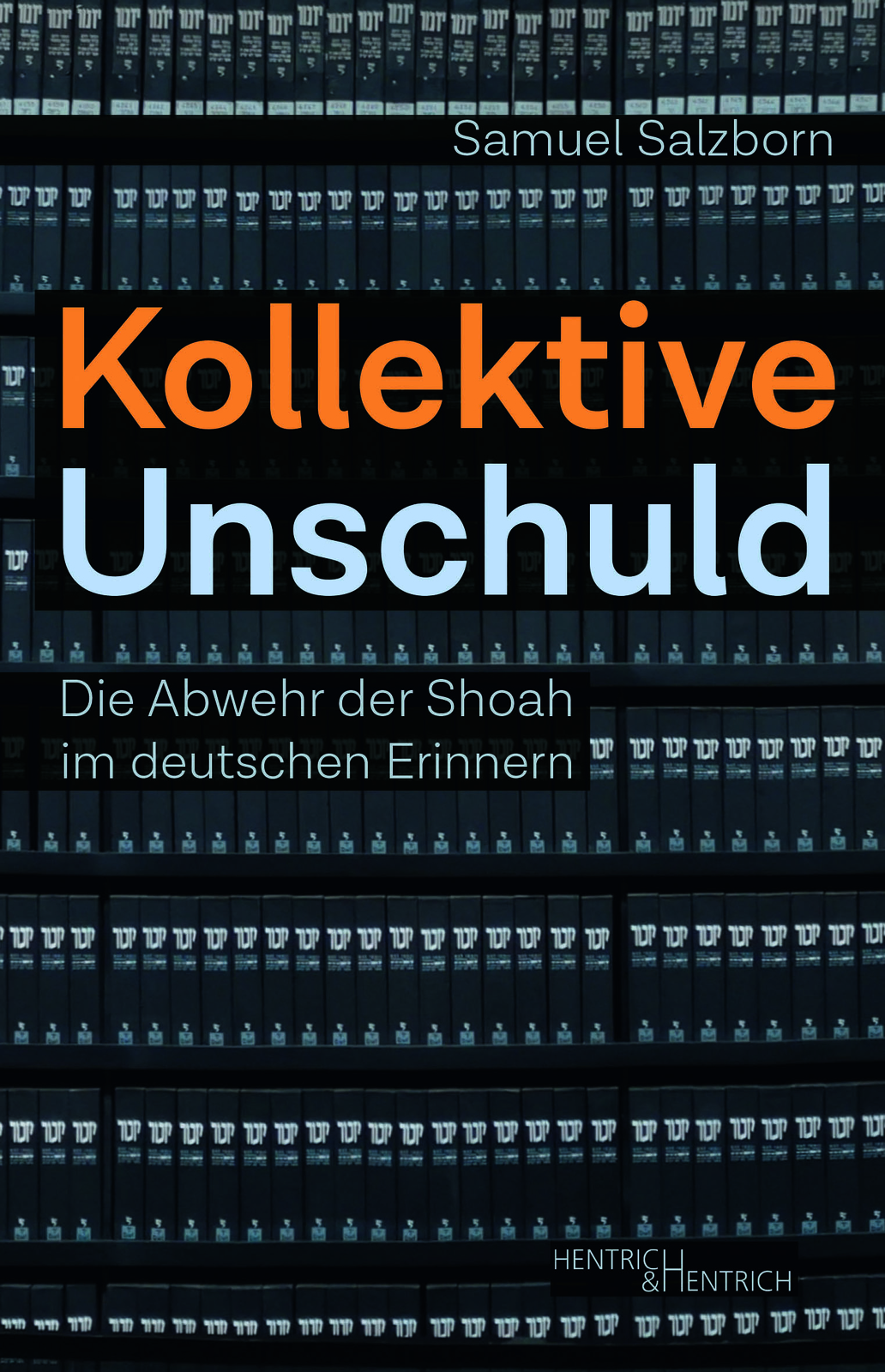
Samuel Salzborn
Kollektive Unschuld
Hentrich und Hentrich Verlag, 2020,
136 Seiten, 15 Euro.

Samuel Salzborn ist apl. Professor für Politikwissenschaft an der Justus-Liebig-Universität Gießen und befasst sich mit Politischer Theorie und Gesellschaftstheorie, zudem mit Rechtsextremismus und Antisemitismus.







