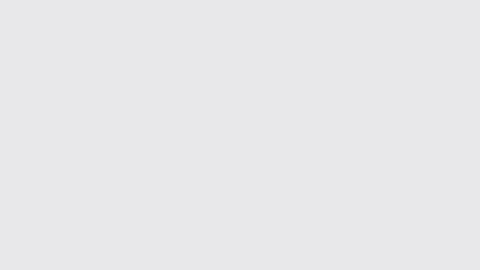Jerusalem-Reise

Eine Reise des RC Wien nach Jerusalem mit besonderem Hintergrund
Um Brücken zu bauen, Missverständnisse auszuräumen und somit ein Zeichen für ein friedliches Zusammenleben von Juden, Christen und Muslimen zu setzen, unternahm der Rotary Club Wien im November 2017 eine Begegnungsreise nach Jerusalem. Eine Reise, die nicht dem Selbstzweck dienen sollte, sondern ganz nach dem Motto „verstehen heißt handeln“ aufzeigen sollte, dass und wie interreligiöser Dialog gelingen kann. Über die Gemeinsamkeiten, Unterschiede und Konflikte von drei Weltreligionen (Judentum, Christentum, Islam) wurde sechs Tage lang mit den vier mitreisenden Glaubensvertretern monotheistischer Religionen - allesamt Mitglieder eines Rotary Clubs - in Jerusalem intensiv diskutiert.
Gemeinsam mit einer kleinen rotarischen Reisegruppe hatten sich Dr. Ednan Aslan (Professor für islamische Religionspädagogik), Dr. Michael Bünker (Bischof der Evangelisch-Lutherischenen Kirche in Österreich), Landesrabbiner Schlomo Hofmeister und der Generalvikar der Erzdiözese Wien, Dr. Nikolaus Krasa, auf die Reise ins Heilige Land begeben.

Verstehen, nicht bekehren
Ziel der Reise war es, an für Juden, Christen und Muslime bedeutsamen Orten in ein Gespräch zu treten, welches das Verständnis füreinander fördert. Es ging darum, den anderen zu verstehen und nicht zu bekehren. „Denn etwas ganz Wichtiges ist: zu erkennen, wie unterschiedlich die Traditionen sind, weil man häufig zu leicht alles in einen Topf wirft“, formulierte es Generalvikar Krasa, der mit Dankbarkeit auf diese Reise zurückblickt.
Dichtes Programm

Nach der Ankunft in Tel Aviv erfolgte der Transfer nach Jerusalem, wo wir passenderweise in einer ehemaligen Talmudschule, dem Sephardic House Hotel, einquartiert waren. Der Tag begann meist sehr früh und spirituell – je nach Konfession oder auch Interesse am anderen Glauben – mit dem Besuch einer evangelischen oder katholischen Messe (Erlöserkirche, Dormitio-Kirche), der Teilnahme am jüdischen Morgengebet an der Klagemauer oder auch in der Hurva-Synagoge.

Beim anschließenden Frühstück in einer Bäckerei, die mit allerlei Köstlichkeiten aufwartete, wurden dann bei einer Tasse Kaffee die Eindrücke verarbeitet.
Fragen, vor allem zum Judentum, gab es viele: Warum sind beim Gebet bei den Juden Frauen und Männer stets streng getrennt, was hat es mit den hochsitzenden schwarzen Hüten (Schtreimel) und den kleinen schwarzen Kästen (Tefillin) auf den Köpfen auf sich, warum tragen Juden Bikeles (Locken) am Kopf und Quasten am Hosenbund und wie ist das mit der Eheschließung und auch der Scheidung bei den Juden? - Rabbiner Hofmeister stand unermüdlich Rede und Antwort.
Jahrmarkt-Stimmung in der Grabeskirche

Ganz anders als erwartet präsentierte sich die Grabeskirche – jenes Bauwerk, das sich über dem Ort von Christi Kreuzigung, Grablegung und seiner Auferstehung befindet. Ganz entgegen unserer Vorstellung, an dieser heiligsten Stätte der Christenheit auf eine andächtige Stimmung zu stoßen, ging es hier mehr wie auf einem Jahrmarkt zu.
Im Massenansturm gab es neben Gläubigen, die unter Tränen unablässig jene Steinplatte küssten, auf der Jesus seine letzte Salbung erhalten hat, wild gestikulierende orthodox anmutende Aufpasser, die laut schreiend den dicht gedrängten Ansturm zum Jesu-Grab mit eisernen Absperrgittern in Reih und Glied ordneten.

Glücklicherweise hat aber niemanden von uns - ob der ernüchternden Stimmung - das sogenannte „Jerusalemsyndrom“ ereilt: eine vorübergehende psychische Störung, bei der Jerusalem-Besucher mit einer besonders hohen spirituellen Erwartungshaltung, plötzlich in weiße Bettlaken gehüllt, predigend durch die Straßen wandeln und sich mit bekannten biblischen Figuren identifizieren.
Über die Via Dolorosa zum Österreichischen Hospiz

Sacher-Torte
Gestärkt von Falafel und herrlich frischem Granatapfelsaft, der hier an jeder Ecke feilgeboten wird, ging es dann weiter über die Via Dolorosa, die Straße des Kreuzweges Christi, bis hin zum österreichischen Hospiz, einem im Stil eines Wiener Ringstraßen-Palais erbauten Pilger-Gästehaus, in dessen grün bewachsenem Gastgarten man Meinl-Kaffee und Sachertorte genießen konnte.
Empfangen wurden wir von Rektor Markus Stephan Bugnyar, der uns auch auf die Dachterrasse des Hauses führte. Von hier aus bot sich uns ein gigantischer Blick über die Altstadt Jerusalems. In der roten Abenddämmerung, just untermalt von zahlreichen Muezzin-Rufen, war es wahrlich ein „Bild für Götter“.

Bei einem zweiten Termin im Haus trafen wir auf den Österreichischen Botschafter Michael Weiß, der uns seine Perspektive des nicht enden wollenden Nahost-Konflikts näherbrachte. Ein brodelndes Fass, in dem das kleinste Fehlverhalten schon große Konsequenzen hat. Auch Rabbiner Hofmeister war vorsichtig und tauschte seinen schmucken schwarzen Hut vor dem kaum wahrnehmbaren Wechsel von einem jüdischen in ein arabisches Viertel, stets gegen ein unauffälliges Baseball-Kapperl aus: „Ich will nicht provozieren“.
Vom Christentum zum Islam

So wie die Tage waren auch unsere Abende überwiegend von Spaziergängen geprägt – einmal sogar des Nachts über die Dächer von Jerusalem auf dem Rückweg von einem koscheren Restaurant im neuen Teil der Stadt. Hierbei klärte mich meine Sitznachbarin Anette mit dem Zitat „Du sollst das Böcklein nicht in der Milch seiner Mutter zubereiten…“ darüber auf, weshalb im jüdischen Glauben „fleischiges“ von „milchigem“ Essen getrennt zubereitet und verspeist werden sollte. Streng genommen müssen sogar (Koch-) Geschirr und Besteck separiert werden, was dazu führt, dass einige jüdische Haushalte sogar zwei Küchen haben.
Die ungewöhnliche, abendfüllende Geschichte der blonden, blauäugigen Konvertitin Anette, die vom Protestantismus zum Islam übergetreten ist, faszinierte mich und war eine großartige Gelegenheit, endlich die vielen offenen Fragen zum Islam zu stellen.

Als norddeutsches Mädel hatte sie sich vor Jahren auf eine spirituelle Suche nach Indien begeben und dort im Islam ihre Erleuchtung gefunden. Leicht kann man sich die Reaktion ihrer protestantischen Eltern ausmalen, deren deutsche Tochter plötzlich in Vollverschleierung auf ihrer Türschwelle stand. Erst die Enkelkinder waren es dann, die die Tochter ihren Eltern wieder näherbrachte.
Auch sie hatte natürlich einen Muslim geheiratet – denn „im Islam funktioniert die automatische Glaubensweitergabe über den Vater, gerade andersherum als bei den Juden, bei denen die Mutter den Glauben vererbt“.
„Einfahrt für israelische Bürger gefährlich“
Über Check-Points ging es am nächsten Tag im Reisebus rund 30 Kilometer durch diese unheimlich karge und karstige Landschaft, einer Wüste gleich, bis nach Hebron, eine jener Städte, in der der Nahost-Konflikt am deutlichsten spürbar ist.
Davor stieg Suzi Cohen-Weisz, aus der Siedlung Nokdim zu uns in den Bus. Die Politologin, die zum größten Erstaunen einiger Mitreisender ursprünglich aus Wien-Währing kam und das Lyceé Francais besucht hatte, lebt mit ihrem Mann und ihren vier Kindern in dieser Siedlung, die wir später besuchen sollten. Während der Fahrt legte sie uns ihre Sicht der Dinge zum Nahost-Konflikt dar und machte uns darauf aufmerksam, dass wir gerade die Stelle passiert haben, wo vor einigen Jahren drei Jugendliche entführt und von radikalen Palästinensern umgebracht wurden. Für Suzi Cohen-Weisz ist eines klar. „Ich will ein friedliches Zusammenleben, auch wir sind mit Palästinensern befreundet, aber ja, wir glauben, es ist unser Land. Wir haben sehr viel Geschichte hier."
Auffallend sind vor den palästinensischen Orten große, rote Tafeln mit der Aufschrift „Einfahrt für israelische Bürger gefährlich“. Kein Wunder also, dass unser ursprünglich geplanter Termin in einer palästinensischen Siedlung platzte. Zu groß war die Angst vor den negativen Konsequenzen, die ein Besuch einer Gruppe, die auch noch von einem Rabbi begleitet wurde, hier auslösen könnte.
Geteiltes Patriarchengrab

Angekommen in dem ärmlich wirkenden Hebron besuchten wir das militärisch streng bewachte Patriarchengrab, Ruhestätte der Erzväter Abraham, Isaak und Jakob sowie ihrer Frauen Sara, Rebekka und Lea. Beim Patriarchengrab, das für alle drei Religionen eine große Bedeutung hat, wurden den Besuchern erneut die Gemeinsamkeiten wie auch die Differenzen der Religionen klar vor Augen geführt. Das Gebäude über den Gräbern, hat zwei Eingänge, einen für Juden und einen für Moslems. Auch im Inneren ist die Grabstätte in eine jüdische Synagoge und eine islamische Moschee getrennt. Nur Christen haben auf beiden Seiten uneingeschränkten Zugang.
Dass das Gebet an einem so heiligen Ort, nur unter einer so strikten Separierung möglich ist, mutet seltsam an. Doch ein Massaker im Jahr 1994, bei dem 29 Palästinenser ermordet wurden, hat solche strengen Maßnahmen notwendig gemacht. Selbst dem ORF-Kamerateam, das uns einige Tage begleitete, wurde aufgrund der strengen Sicherheitsvorschreibungen der Zugang verweigert.
Nachdem die Frauen unserer Gruppe in hellblaue Umhänge mit spitzen Zipfelmützen gesteckt wurden, mit denen wir eher wie Ku-Klux-Klan-Mitglieder aussahen, betraten wir den moslemischen Teil der Grabstätte. Während Rabbiner Hofmeister seine Gebete im jüdischen Teil, den wir davor besucht hatten, absolvierte, gab Ednan Aslan uns auf der reich verzierten muslimischen Seite eine Einführung in die Gebetsriten und dabei notwendigen Bewegungsabläufe, übersetzte aus dem Koran und erklärte die Luftschächte, durch die heilige Grabes-Luft emporsteigt. „Man kann seine persönlichen Glaubenserfahrungen auf so einer Reise viel besser teilen“, freute sich der Religionspädagoge.
Danach ging es nach einem Zwischenstopp am Herodium, einer Tempelanlage des König Herodes (74–4 v. Chr.), mit einem verzweigtem Zisternensystem in einem künstlich errichteten Berg, in die Heilige Stadt.

Betlehem
Doch um nach Betlehem zu kommen, das in dem von den Palästinensern selbstverwalteten Teil des Westjordanlandes liegt, mussten wir erst eine Grenze passieren. Reisebusse wurden schnell durchgewunken, aber Palästinenser, die im nahen Jerusalem arbeiten, musstenen meist schon ab drei Uhr früh an diesem Grenzübergang anstehen, um rechtzeitig bei der Arbeit zu erscheinen. Es ist eine 759 Kilometer lange und acht Meter hohe abgesicherte Mauer, die Israel von der Westbank trennt. Angeblich zum Schutz der Palästinenser errichtet, lehnen jene die Mauer ab und fühlen sich durch ihre Existenz isoliert und vom Rest des Landes abgeschnitten.
Nachdem wir uns unseren Weg durch aufdringliche Souvenirverkäufer gebahnt hatten, erreichten wir schließlich die Geburtskirche. „Eine der wenigen erhaltenen frühchristlichen Bauten, die sich über der Geburtshöhle Jesu befindet“, wie Generealvikar Nikolaus Krasa erzählte. „Ob Jesus aber genau an dieser Stelle geboren wurde, ist ähnlich wie an den anderen heiligen Orten, nicht ganz gesichert.“ Auch hier stießen wir - diesmal mit weniger großer Überraschung - auf Massentourismus in Reinkultur. Menschenschlangen drängten sich hinter geschäftstüchtigen Guides jene Treppen hinab, die zur Geburtshöhle Jesu unter der Kirche führen.

Hauptattraktion in diesem niedrigen, überfüllten, stickigen und doch so geschichtsträchtigen Raum ist ein in den Boden eingelassener, silberner 14-zackiger Stern, der die Stelle der Geburt kennzeichnen soll. Hier wird – sofern im Gedränge möglich – innegehalten, kniend gebetet, Kerzen entzündet, der Stern geküsst und die Hand in das darin befindliche Öl getaucht. Wir machten die Rituale einfach mit, ohne viel zu empfinden und waren froh, den Ort rechtzeitig verlassen zu können, bevor wir von einem orthodoxen Priester, der den nächsten Besucheransturm durchschleusen wollte, hinausgescheucht wurden. Alles in allem ein eher ernüchterndes Erlebnis.
Ort der Stille – der Felsendom
Ganz anders als die Besichtigung der christlichen Kirchen und Betlehem gestaltete sich die Besichtigung des Tempelbergs. An einem warmen, sonnigen Vormittag gingen wir mit einer Sondergenehmigung fast alleine hinauf zum Felsendom, dem monumentalen Sakralbau des Islams. Er ist eines der islamischen Hauptheiligtümer. Es war ein wahrlich erhabener Moment, auf diesem sandsteinfarbenen Platz vor der in der Sonne funkelnden, goldene Kuppel des blauen Doms zu stehen und endlich Stille zu genießen. Eine echte Ausnahme bei diesem sonst eher dicht gedrängten Reiseprogramm.


Es war ein Mittwoch, an dem sich kaum Gläubige und nur einige Touristen hierher verirrten: Einige Muslime verrichteten ihre rituellen Waschungen an den goldenen Wasserhähnen. Wir zogen unsere Schuhe aus und betraten den mit rot gemusterten Teppichen ausgelegten, kunstvoll verzierten Dom. In dessen Mitte ragte ein von einer Balustrade eingegrenzter abgeflachter Fels hervor, von dem aus Mohammed die Himmelfahrt und seine Begegnung mit den früheren Propheten des Judentums und Jesus angetreten haben soll.
Wieder waren wir an einem für alle drei Religionen historisch bedeutsamen Ort. Nach volkstümlicher, jüdischer Tradition soll auf dem Felsen die Welt gegründet worden sein. Auch ist es jene Stelle, an der Abraham seinen Sohn Isaak opfern wollte.

Eindrucksvoll auch die daneben befindliche Al-Aqska-Moschee mit silberner Kuppel und vier Minaretten. Zum Abschluss unseres Ausflugs besuchten wir am Fuße des Tempelbergs noch eine Kreuzfahrerkirche mit einem schön bewachsenen Garten. Bizarres Detail am Rande, eine lateinamerikanische Musikergruppe gab hier auf deutsch „Stille Nacht, heilige Nacht“ zum besten – und das Mitte November.
Yad Vashem
Auch wenn es ein dunkles Kapitel der Menschheit beleuchtet, darf ein Besuch des Holocaust-Museums Yad Vashem bei keiner Jerusalemreise fehlen. Beschämend, niederschmetternd, erdrückend sind jene Worte, die meine Eindrücke am besten zusammenfassen. Besonders beklemmend: die vielen Originalfilme aus den Konzentrationslagern und Ghettos, deren Bilder einem sehr unter die Haut gingen. Allein den Anblick auszuhalten war oft schwierig, wie unvorstellbar schwer muss das Ertragen dieses Lebens gewesen sein. Ein erschütterndes Mahnmal!

Im Dialog
Die Reise sollte gerade in Zeiten der großen Flüchtlingsströme und zunehmender Fremdenfeindlichkeit ein Anstoß zum besseren gegenseitigen Verständnis, auch und gerade in der Zivilgesellschaft sein. Erst, wenn man sich ein Bild von der Sicht der jeweils anderen Religion macht und deren Wurzeln versteht und einander zuhört, können Vorurteile, die man gegeneinander hegt, entkräftet werden. Denn wie Bischof Michael Bünker feststellte, „wissen wir einfach sehr wenig voneinander – was keine Überraschung ist“. Er sieht in der Reise auch eine Chance „dass man die eigene Position noch einmal überdenkt, dazulernt, manches auch verlernt, weil man drauf kommt: Ich habe immer etwas behauptet, das so vielleicht gar nicht stimmt.“ Das Hinterfragen der eigenen Religion und Glaubenssätze war also durchaus Teil des Ganzen.
Insgesamt war unsere Reise geprägt von intensiven Dialogen über Religion, Politik, Antisemitismus und Islamfeindlichkeit, von persönlichen Erlebnissen, Sichtweisen und Geschichten unserer Glaubensvertreter, aber auch der Mitreisenden. Einfach ein in allen Aspekten bereichernder Dialog über Gott und die Welt sowie ein Denkanstoß für ein respektvolles, tolerantes und friedliches Miteinander.
Natalie Eiffe-Kuhn