Titelthema
Auf ins Wirtschaftswunder!

Die 1950er Jahre waren besser als ihr Ruf. Mehr Arbeit, mehr Kaufkraft und Rockmusik sorgten für eine neue Zuversicht. Über Glück und Missgunst in den Aufschwungsjahren
Man ging immer am Kühlschrank vorbei, hat drübergestrichen und machte ihn auf. Und das glänzte, und die Butter lag drin und die Wurst, noch so, wie man sie vorgestern gekauft hat. Wissen Sie, ich denke, man hat in der schweren Zeit so viel Glücksgefühle, ich würde sagen, unwiederbringlich.“ So erinnerte sich Jutta Kaufmann 1957 an ihren ersten Kühlschrank, den sie zwei Jahre zuvor gekauft hatte, an all den Käse, die Wurst, die Butter, die sie dort unterbrachte, sicher bewahrt vor dem Verderben. Ihr Glück kann nur ermessen, wer sich die Hungerjahre nach dem Krieg vorstellt, als es rationierte Lebensmittel nur gegen Vorlage einer Karte gab, die genau vorschrieb, wie viel einem zustand, pro Tag beispielsweise eine Fingerkuppe Fett, meist eine Margarine zweifelhafter Herkunft. Die meisten Deutschen beantworteten in den frühen Nachkriegsjahren die Frage nach dem, was sie sich von der Zukunft erhofften, mit der Antwort „endlich mal wieder gute Butter“. Erst zehn Jahre nach Kriegsende, mitten im Wirtschaftswunder, kippt der Butterindex zum Guten: ihr durchschnittlicher Verbrauch in der Bundesrepublik überstieg 1955 erstmals wieder den der Margarine. Die Nachkriegszeit war zu Ende.
Vorsicht vor den Aufsteigern
Zwei Jahre später eröffnet in Köln in der Rheinlandhalle auf einem alten Fabrikgelände der erste deutsche Supermarkt nach amerikanischem Vorbild. Die Kunden, die ungläubig durch das Angebot stromern, ungehindert von einer Theke und einem Ladenbesitzer dahinter, erleben den Supermarkt wie einen Rausch. „Freiheit“ – dieser zunächst noch etwas abstrakt wirkende Zauberbegriff der neuen politischen Ordnung – erhält eine sinnliche Dimension als Wahlfreiheit beim Einkaufen, eingebettet in einen Aufschwung sondergleichen: Von 1948 bis 1967 wird Westdeutschland ein Wirtschaftswachstum von durchschnittlich acht Prozent jährlich erzielen. Entsprechend steigen die Löhne, die Konsumerwartungen, die Ratenkäufe, aber auch der Stress. Fabriken werben um Arbeitskräfte mit dem Versprechen, Überstunden ohne Ende machen zu können. Man reißt sich um Akkordschichten.
Wer schon alles hat, hatte dafür nur Verachtung. Statt den Wohlstand zu feiern, machte sich Deutschlands Oberschicht Sorgen wegen der Sorglosigkeit von denen da unten. Die geistige Elite blickte pikiert auf ein Volk, das in ihren Augen „seine Seele an den Konsum verkaufte“. Das Wort „Konsumterror“ machte die Runde, und zwar zunächst unter Konservativen. Erst in der zweiten Hälfte der 60er wechselte die Konsumkritik auf die linke Seite. Über allem liege „der Mief des Geldes“, klagte der Schriftsteller Ernst Glaeser 1960, „und dieses ganzen hohlen, aufgedonnerten Wohlstands, den, Gott sei meiner Seele gnädig, hoffentlich recht bald der Teufel hole“. Hans Magnus Enzensberger, an der Wohlstandsverachtung maßgeblich beteiligt, wunderte sich trotzdem 30 Jahre später darüber, wie nicht einmal eine Dekade nach den schlimmen Hungerwintern 1946 und 1947 die Vokabel „satt“ zum Schimpfwort avancieren konnte: „Der ,satte Bundesbürger‘ wurde zur Zielscheibe der Entrüstung, so, als wäre der Hunger eine positive moralische Kategorie.“
Wer glaubt, es sei vor allem die Scham aufgrund der NS-Verbrechen gewesen, der die Intellektuellen der 50er Jahre so wenig Freude am Wirtschaftswunder empfinden ließ, täuscht sich in ihrer Moralität. In dem Argwohn gegenüber der angeblich „niederen Wohlstandsmentalität“ steckte vor allem die Furcht, die im Zuge der sozialen Marktwirtschaft nach oben aufschließenden Massen könnten durch ihr gestiegenes Selbstbewusstsein die Achtung vor den geistigen Eliten und ihre demütige Erziehungsbereitschaft verlieren. „Aus dem Modergeruch des Proletariats, der Armut, des tristen Tagelöhnerdaseins“ sei der kleine Mann „zu einer Figur der Mitte geworden, deren Lebensgewohnheiten sich kaum noch wesentlich von denen der Oberschicht unterscheiden würden“, meinte besorgt im Nachtstudio des Südwestfunks der Publizist Kurt Seeberger 1960. Gut angezogen sei er zwar jetzt, aber dafür vorlaut und anmaßend, hieß es unter Journalisten, Pfarrern und Professoren. Besorgt beobachteten sie eine „wachsende Herrschaft der Halbbildung“ und eine „Zerbröckelung der Kulturpyramide“, auf der sie bislang doch so sicher ganz oben gestanden hatten.
Kulturell waren die Unterschiede zwischen den Schichten in der Adenauerzeit wesentlich gravierender als heute und die Abgrenzungen undurchlässiger – sie erodierten jedoch in der Entwicklung zur „nivellierten Mittelschichtsgesellschaft“ rasant. Es dauerte fast zwei Jahrzehnte, bis sich das Bürgertum daran gewöhnte, dass sich immer mehr Menschen durch Bildungswillen und Aufstiegsbereitschaft an ihre Lebensweise heranarbeiteten.
James Dean schlägt Söhnker
Eine zusätzliche Kränkung bot die Konsumgesellschaft, als sich das Publikum von den deutschen Kulturproduzenten ab- und denen der Besatzer zuwandte. Im Kulturkampf gegen „Schmutz und Schund“ aus Amerika (das roteste Tuch waren Comic-Hefte) betätigten sich zunächst die Konservativen als Vorreiter, bevor die Linke gegen die „Kulturindustrie“ zu Felde zog. Aber die Bundesrepublik orientierte sich unbeirrt nach Westen: Tennessee Williams, Henry Miller und Ernest Hemingway dominierten die Literatur, aus Frankreich kamen die 19-jährige Françoise Sagan mit ihrem melancholisch-libertären Bestseller Bonjour Tristesse, die existenzialistischen Philosophen Albert Camus und Jean-Paul Sartre und das absurde Theater Samuel Becketts und Eugène Ionescos. James Dean, Cary Grant und John Wayne übten auf die deutsche Seele weit mehr Einfluss aus als Hans-Jörg Felmy oder Hans Söhnker.
Ausgerechnet die Besatzungssender AFN und BFBS brachten den Musikstil zu Gehör, der im Reich Konrad Adenauers als rebellisch empfunden wurde. Hier fand ein breites Publikum eine hedonistische, lustbetonte Musik, die der beschwingten neuen Konsumkultur genau entsprach. Ohne es zu wollen, trieben die deutschen Radioanstalten die Jugend auf die Frequenzen der Soldatensender, indem sie sich englischsprachiger Musik konsequent verweigerten und eine Mischung aus Operettenmelodien, Marschmusik und Schlagern spielten, die so hölzern, albern und gefühllos klangen, dass schon Ausnahmen wie Heißer Sand (Mina) oder Wo meine Sonne scheint (Caterina Valente) als Juwelen der Liedkunst erschienen. Als Elvis Presley nach seiner in Deutschland verbrachten Militärzeit das Volkslied Muss i denn zum Städtele hinaus in einer zweisprachigen Version aufnahm, weigerten sich Radiosender der ARD die Version zu spielen, weil sie sich einer „ernsthaften Pflege des Volksliedguts verpflichtet“ fühlten.
Aufgrund solcher Engstirnigkeiten vom „Mief der 50er Jahre“ zu sprechen, wäre jedoch ganz falsch. Die 50er waren wesentlich kontroverser, nachdenklicher und lebensoffener, als es die rebellierende Jugend zehn Jahre später verständlicherweise darstellte – und es bis heute tut, um die Liberalisierung der Republik als Resultat ihres Aufstands zu feiern. Das wirksamste Kulturphänomen der Zeit war bezeichnenderweise sprachlos, so, wie es der verbreiteten Skepsis gegenüber großen Worten und politischem Pathos nach dem Krieg entsprach: Die abstrakte Malerei mit ihrer Verweigerung, irgendetwas anderes zu bedeuten oder darzustellen als den Malakt selbst, lieferte nach dem Krieg den emblematischen Look der jungen Bundesrepublik. Wer etwas auf sich hielt und sich zu den tonangebenden Leuten zählte, kaufte sich einen fröhlich lebensbejahenden Willi Baumeister oder hängte sich ein Plakat mit den Tröpfel- und Spritz-Eruptionen Jackson Pollocks über die Couch. Anwaltskanzleien, Banken, Agenturen und Regierungsbüros staffierten sich mit der „lyrischen Abstraktion“ aus, die es in Form von Tapetenmustern und Vorhangstoffen sogar bis in die Wohnzimmer der breiten Mittelschicht geschafft hatte.
Nierentisch und Neckermann
Die energischen Pinselschwünge der abstrakten Malerei verkörperten die Freiheit als Selbstwert und feierten lustvoll den Augenblick eines autonomen Schöpfungsakts. Sie traf derart genau das optimistische Selbstbild der BRD, dass sie bald in den Verruf einer neuen „Staatskunst“ geraten sollte.
Das berühmteste Relikt der Epoche ist der Nierentisch. Mit seiner wild gekurvten Platte, seinen spillerig abstehenden Beinen, die in zierlichen Messingschühchen steckten, bildete er die Antithese zum trutzigen Massivstil der NS-Zeit. Oft musste er sich in den beengten Wohnungen allerdings ganz allein gegen das düstere Mobiliar der Vorkriegszeit behaupten, weil das Geld zu mehr nicht gereicht hatte. Aber wenigstens mit dem Nierentisch wollte sein Besitzer schon mal teilhaben am neuen Schwung des Wirtschaftswunders, so albern es sich auch ausnahm im engen Muff der alten Dürftigkeit. Nach und nach würde er sich schon einstellen, der Glanz des Wirtschaftswunders, Stück für Stück bestellt aus dem Neckermann-Katalog.
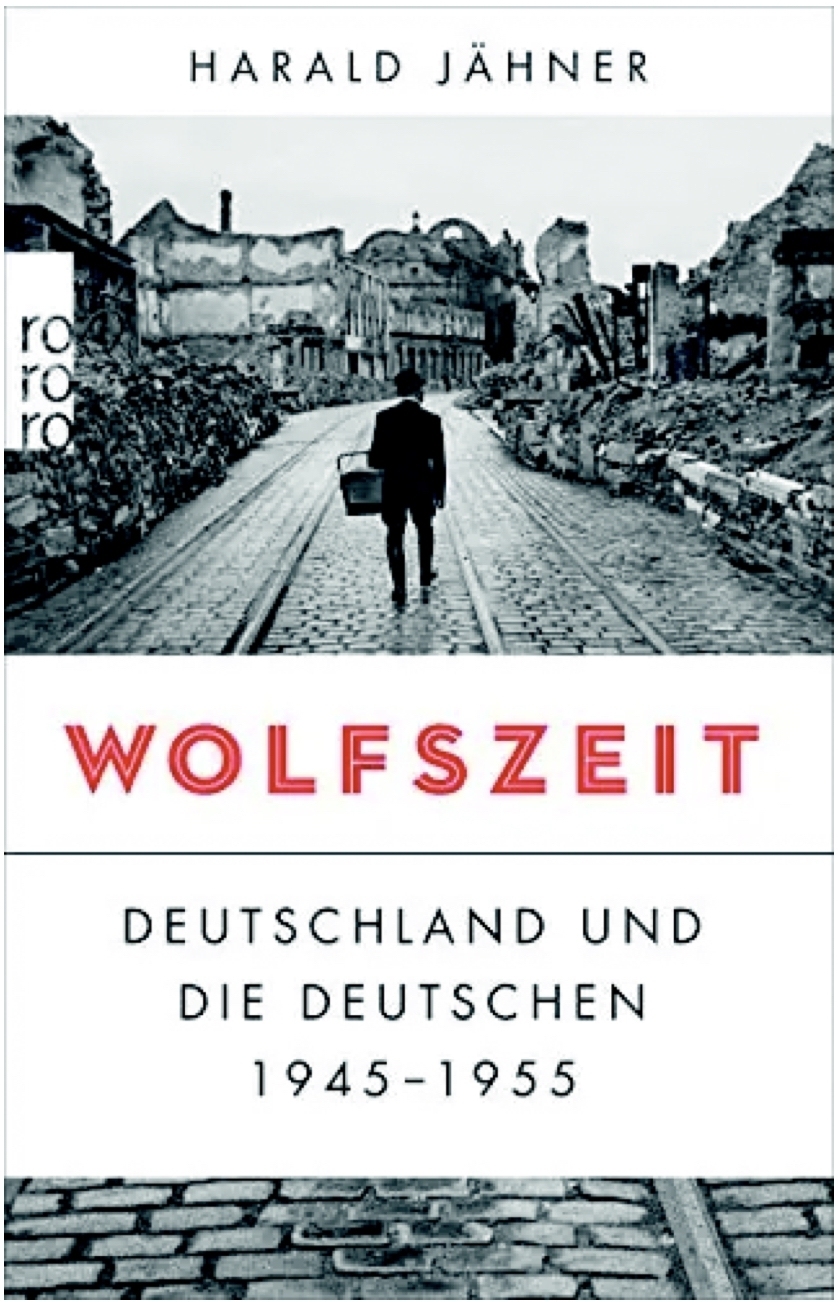
Harald Jähner
Wolfszeit: Deutschland und die Deutschen 1945–1955
Rowohlt 2020,
480 Seiten, 34 Euro

Harald Jähner war bis 2015 Feuilletonchef der „Berliner Zeitung“, zugleich Honorarprofessor für Kulturjournalismus an der Universität der Künste Berlin. Er ist Autor zahlreicher preisgekrönter kulturhistorischer Bücher.
© Barbara Dietl







