Interview
„Eine offizielle Bewertung gab es nie“
Im Gespräch mit Marcus Böick. Über den Auftrag der Treuhandanstalt, die Motive ihrer Mitarbeiter und die Ergebnisse ihrer Arbeit

© imago/Christian Thiel
Dr. Marcus Böick
ist Akademischer Rat auf Zeit im Bereich Zeitgeschichte am Historischen Institut der Ruhr-Universität Bochum.
Herr Böick, fast dreißig Jahre nach dem Fall der Mauer haben Sie eine umfangreiche Geschichte der Treuhand vorgelegt. Was unterscheidet Ihre Arbeit von den bisherigen Büchern zu diesem Thema?
Ich habe versucht, die Treuhand als Thema der Zeitgeschichte darzustellen und nicht – wie es in den bisherigen Büchern meistens geschieht – als eine Erfolgs- oder Skandalgeschichte. Ich habe die bisherigen Deutungen beiseitegelassen und stattdessen gefragt: Wie ist eigentlich die Idee entstanden, eine solche Treuhandanstalt einzurichten – eine möglichst unabhängige Agentur, die von überwiegend westdeutschen Managern geleitet wird, um den Transformationsprozess der ostdeutschen Planwirtschaft in die gesamtdeutsche Marktwirtschaft zu gestalten? Zweitens habe ich untersucht, wie man dann ab dem Herbst 1990 versucht hat, diese zunächst noch fixe Idee in die bald hochumstrittene Praxis umzusetzen. Der dritte Aspekt war die Untersuchung des Treuhandpersonals. Wen hat man rekrutiert? Welche Motive haben einen Manager aus dem Westen dazu bewogen, in den Osten zu gehen? Warum ist ein ostdeutscher Mitarbeiter zur Treuhandanstalt gegangen, die oft das Gegenteil von dem tat, was er jahrzehntelang zuvor in der Planwirtschaft gemacht hatte? Zu diesen und weiteren Fragen habe ich nicht nur die Akten studiert, sondern in zahlreichen Interviews auch frühere Akteure und Mitarbeiter befragt.
Wer oder was gab den Ausschlag für eine schnelle Transformation und die Einsetzung einer Agentur, die weitgehend unabhängig agieren konnte?
Seit dem unerwarteten Fall der Mauer stand die Bundesregierung unter massivem Druck, auf den Umbruch in der DDR zu reagieren. In Bonn hatte man Angst vor einer massiven Einwanderung in den Arbeitsmarkt, in den Wohnungsmarkt und in die Sozialsysteme. So entstand im Januar 1990 im Umfeld des Finanzministeriums die Idee einer schnellen Währungsunion. Der Gedanke war: Wir geben den Ostdeutschen die D-Mark, dafür bleiben sie zu Hause. Und wenn alles schnell geht, dann werden wir schon bald ein zweites Wirtschaftswunder erleben.
Damals kursierte unter den Verantwortlichen ein griffiger Text von Ludwig Erhard aus den 50er Jahren über die Frage: Was machen wir eigentlich, wenn die Sowjetzone zusammenbricht? Erhards Antwort war: Auf keinen Fall darf eine solche Situation durch Beamte gesteuert werden, vielmehr müssen möglichst schnell private Unternehmer gefunden und Marktkräfte aktiviert werden. Unter dem Einfluss dieses Erhard-Textes verlegten sich die führenden Beamten des Finanzministeriums auf das Modell einer schnellen Wirtschafts-, Währungs- und Sozialunion. Von politischer Seite sollte damit auch die DDR-Regierung unter Druck gesetzt und Einfluss auf den Wahlkampf zur ersten freien Volkskammerwahl zugunsten der liberalkonservativen Parteien genommen werden – letztlich mit ganz überwältigendem Erfolg.
Ist es nicht erstaunlich, dass sich die Überlegungen zur Lösung eines Problems im Jahre 1990 auf einen Text von Ludwig Erhard aus den 50er Jahren stützten?
Ich glaube, dass alle Akteure mit dieser unerwarteten Situation überfordert waren. In den 50er, 60er Jahren gab es noch ganze Forschungsinstitute, die sich intensiv mit Fragen zur Wiedervereinigung beschäftigt hatten, die jedoch ab den 70er Jahren im Zuge der Entspannungspolitik geschlossen wurden. So wusste man im Westen im Herbst 1989 de facto kaum etwas über die DDR-Wirtschaft. Insofern waren die Akteure durchaus dankbar, dass es diesen Text von Erhard gab und der Vater der Sozialen Marktwirtschaft sozusagen aus dem Grab noch einmal ein Schnellrezept für den ökonomischen Einigungsprozess lieferte. Man glaubte vielleicht auch zu sehr der DDR-Propaganda, die zehntgrößte Industrienation der Welt zu sein. Als dann im Juli 1990 die ersten Treuhandmanager in Ostberlin ihre Arbeit aufnahmen, merkten diese aber schnell, dass sie keinerlei Informationen über die Betriebe hatten, die sie nun rasch in die Marktwirtschaft führen sollten.
Woher kamen diese Manager? Und was trieb sie an?
Zunächst sprach Detlev Karsten Rohwedder insbesondere erfahrene Industriemanager aus dem Westen an und sagte: Ihr könnt hier nochmal richtig was bewegen – für Euch, aber auch für Deutschland. Als dann im Herbst 1990 klar wurde, dass das benötigte Personal nicht in Scharen kam, intervenierte Helmut Kohl beim BDI, der daraufhin eine Management-Transferaktion organisierte, die über hundert erfahrene Industriemanager von Bayer, Siemens, Daimler usw. zur Treuhand lotste. Diese Leute wurden dann die Direktoren, Niederlassungsleiter und Abteilungsleiter der Organisation.
Die zweite große Gruppe waren junge westdeutsche Nachwuchskräfte, meistens Betriebswirte oder Juristen, die direkt von den Universitäten rekrutiert wurden. Das waren im Großen und Ganzen die Abteilungs- oder Referatsleiter. Für sie bot sich die Möglichkeit, schon früh Verantwortung zu übernehmen. Da sie oftmals mit der Situation in Ostdeutschland überfordert waren, entstand schnell das Bild vom hochnäsigen Westdeutschen, der einfach den Daumen senkt, selbst schnell Kohle macht und sich gar nicht für die Menschen und ihre Schicksale interessiert. Während die älteren Manager oftmals von patriotischen Motiven geleitet wurden, spielte das für die jüngeren Westdeutschen kaum noch eine Rolle. Für sie war es vor allem ein lukrativer Job, ein Karrieresprungbrett.
Die dritte große Gruppe waren schließlich die ostdeutschen Mitarbeiter. Die stellten die Mehrheit des Personals. Meistens kamen sie aus den staatlichen Plankommissionen sowie aus den Branchenministerien der DDR. Diese Mitarbeiter kannten die Betriebe, wussten, welche Produkte dort verfertigt wurden, welche Handelsbeziehungen nach Osteuropa sie hatten und wo die Probleme vor Ort lagen. Die Verpflichtung dieser Gruppe war nicht unumstritten, ein Teil der Presse kritisierte sie als ehemalige Stasi-Seilschaften oder als rote SED-Bonzen, die nun wieder ihre Netze spinnen und dafür sorgen konnten, dass der ganze Prozess nicht richtig lief. Tatsächlich arbeiteten diese Mitarbeiter mit ihrem Wissen den Entscheidern auf den höheren Ebenen lediglich zu.
Hatten die Akteure aus dem Westen das richtige Gespür für die gesellschaftliche Dimension ihres Handelns? So mag die Schließung eines unrentablen Kombinates betriebswirtschaftlich sinnvoll gewesen sein, in der Konsequenz bedeutete ein solcher Schritt jedoch oftmals die Abschaltung ganzer Orte.
Damit haben Sie durchaus Recht. Wobei wir uns vor Verallgemeinerungen hüten sollten. Grundsätzlich hatten die politisch Verantwortlichen ja ganz bewusst erfahrene Praktiker geholt, die wie Unternehmer entscheiden sollten und eben nicht nach strukturpolitischen Prinzipien – und die entsprechend handelten.
Richtig ist, dass der sozialistische Betrieb etwas völlig anderes war als ein marktwirtschaftliches Unternehmen. Die staatlichen Kombinate hatten zum Beispiel eigene Kindergärten oder Ferienwohnheime betrieben. Die Treuhandmanager konnten mit all dem natürlich nichts anfangen, da dieser Ballast die Privatisierungen erschwerte. Deshalb verkauften oder schlossen sie alles, was nach ihrem Verständnis nicht zu einem Unternehmen gehörte. Die Rationalisierungsmaßnahmen führten somit nicht nur zum materiellen Verlust zahlreicher Arbeitsplätze, sondern auch zur Abwicklung gewachsener Sozialstrukturen – und entsprechenden kulturellen Verlust- und Abstiegserfahrungen.
Wie hat sich die Politik zu dem anwachsenden Unmut über die Treuhand verhalten?
Die politischen Entscheider haben sich im Hintergrund bedeckt gehalten. Für sie war die Treuhand dank ihrer weitgehenden Autonomie ein idealer Sündenbock, der einen Großteil des Frusts in der Bevölkerung auf sich zog. Eine Rückkoppelung zwischen ökonomischen Entscheidungen und politischer Verantwortung gab es gerade in der Frühzeit kaum. Und so wird das Schicksal von zehn- bis zwölftausend Betrieben gerade in den Jahren 1991/92 ohne öffentliche Kontrolle verhandelt. Zur Ehrenrettung der Politik muss man sagen, dass es neben den wirtschaftlichen Problemen auch noch eine ganze Reihe anderer Themen gab, zum Beispiel den Umgang mit der Stasi oder den Irak-Krieg, der das vereinigte Deutschland auch außenpolitisch forderte.
Zur Geschichte der Treuhand gehören auch zahlreiche Skandale, zum Beispiel der Verkauf von Unternehmen weit unter ihrem Wert.
Skandale hat es natürlich gegeben, und die Medien haben sich regelmäßig auf sie gestürzt. Aber gerade hier sollte man immer den Einzelfall betrachten. Natürlich hat ein solch dramatischer Umbruch wie in den Jahren nach 1990 auch zahlreiche Glücksritter, halbseidene Betrüger und skrupellose Profiteure angezogen. Doch was davon kann man wirklich der Treuhand als Organisation und ihren Mitarbeitern anlasten? Und was heißt in diesem Zusammenhang „viel“?
Welche Fälle wurden besonders diskutiert?
Ich will nur einen Fall hervorheben, der aus meiner Sicht für die Treuhandgeschichte, das Personal und die Organisationsgeschichte sehr wichtig ist: die Niederlassung in Halle. Dort hat sich eine Art Netzwerk gebildet, das – anscheinend ohne Wissen des Vorstands und des Niederlassungsleiters – gemeinsam mit einem schwäbischen Unternehmer, quasi über zwanzig Unternehmen verschoben hat. Dieser schwäbische Unternehmer war praktisch insolvent und hat gemeinsam mit einigen Ostdeutschen ein regelrechtes Kartell gebildet. Hier fiel der Treuhand vor die Füße, dass sie ihre Niederlassungen in den 15 Bezirksstädten anfänglich sehr eigenständig agieren ließ, zu zügigen Privatisierungen drängte und deren Arbeit kaum kontrollierte.
Als die Vorgänge in Halle im Jahr 1993 ans Licht kamen, hat dies eine Welle der öffentlichen Entrüstung ausgelöst und den Eindruck verstärkt, dass die Treuhandanstalt ein durch und durch korrupter Laden war. Ende 1993 wurde dann der Treuhanduntersuchungsausschuss unter Otto Schily eingesetzt. Alles in allem müssen wir feststellen, dass die Zahl der Skandalfälle in die Hunderte geht. Aber sind hunderte schlechte Fälle unter über zehntausend Vorgängen viel oder wenig? Das ist eine Frage der Deutung.
Oft kritisiert wird auch der Grundsatz „Rückgabe vor Entschädigung“, also die Rückgabe von Betrieben an die Alteigentümer. Doch wenn man sich die Medienberichte ansieht, liest man eigentlich immer nur von Verkäufen an Investoren. Wie viele Betriebe sind denn tatsächlich an die Alteigentümer zurückgegeben worden?
Das ist ein großes Themenfeld, über das wir noch zu wenig wissen. Gerade für Rohwedder und die ersten Treuhandmanager war diese Vorgabe eine politischen Zumutung. Sie sagten: Wir sind in den Osten gegangen, um möglichst schnell über Privatisierungen zu entscheiden, jetzt sollen auf einmal Rückerstattungsansprüche abgewartet werden? Wir können keinen einzigen Betrieb verkaufen, dessen Eigentumsverhältnisse unklar sind. Deshalb warb Rohwedder über seine politischen Kontakte dafür, das Prinzip Rückgabe vor Entschädigung in der Praxis zu unterlaufen.
Später änderte sich die Haltung der Treuhand zu diesem Thema. Da richtete sie sogar eigene Arbeitsbereiche für die Reprivatisierung ein. Das war, als der Verkauf der attraktivsten Staatsbetriebe beendet war und die Treuhandanstalt zunehmend aktiv Investoren auch im Ausland suchen musste. Da sagte man: Auch eine Rückgabe ist eine Privatisierung. Am Ende wurde jedoch nur ein vergleichsweise geringer Anteil an meist kleineren oder mittleren Staatsbetrieben tatsächlich reprivatisiert.
Mussten die Treuhand-Verantwortlichen jemals Rechenschaft ablegen?
Auch diese Frage ist sehr spannend. Wie bereits geschildert, handelte die Treuhandanstalt zwar im Auftrag des Bundesfinanzministeriums, war aber in ihrer Arbeit relativ eigenständig. Gerade in der Anfangszeit 1990/91 war das Treuhand-Spitzenpersonal von grober Fahrlässigkeit freigestellt, später dann nur noch von leichter Fahrlässigkeit. Das verdeutlicht, wie sehr man die Frage der Verantwortlichkeit zunächst bewusst zurückstellt, um möglichst schnell den Privatisierungsprozess zum Laufen zu bringen. Nach dem Bekanntwerden der ersten Skandale wurde die Treuhand dann stärker kontrolliert. In meinen Gesprächen unterschieden die Befragten stets zwischen einer „goldenen“ Anfangszeit, als sie quasi auf Zuruf große Privatisierungen entscheiden konnten und wo ein Vertrag nur ein paar Seiten hatte, und einer bürokratischen Schlussphase, wo sie sich überall abstimmen mussten, wo es Innenrevisionen gab und wo die Privatisierungsvorlagen hunderte, ja tausende Seiten hatten.
Eine offizielle Bewertung der Treuhandarbeit gab es nie. Das führt dazu, dass die Debatte zwischen Kritikern und Verteidigern wie auch jüngst immer wieder auflodert. Was wir brauchen ist eine wissenschaftliche Aufarbeitung, die verschiedene Fälle, Branchen und Konstellationen im Detail betrachtet. Eine solche Untersuchung wäre sicherlich ein Beitrag, die Debatten über die Treuhand empirisch zu versachlichen.
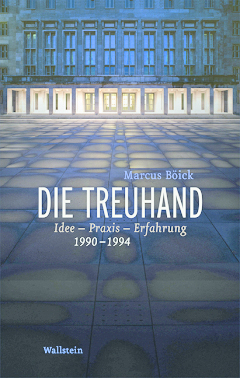
© PR
Buchtipp
Marcus Böick
Die Treuhand. Idee – Praxis – Erfahrung 1990–1994
Wallstein Verlag
760 Seiten, gebunden
79,- Euro.







