Titelthema
Sichtbare Einheit

Mit der DDR ist ein zwar unerfülltes, aber dennoch real wirksames Demokratieversprechen untergegangen. Das wirkt nach. Im Osten gibt es teilweise ein anderes Demokratieverständnis als im Westen
Zum ersten Mal in ihrem Leben sei sie freiwillig zu einer Demonstration gegangen. Über 4000 waren es gewesen an jenem Samstag im Januar 2024 in Frankfurt an der Oder. Die pensionierte Erzieherin hat ihr gesamtes Erwachsenenleben in dieser Stadt verbracht. Vor 1989 war sie oft auf den staatlich orchestrierten Aufmärschen auf der Magistrale und vor der Friedensglocke am Ufer der Oder dabei. Weil man das eben so machte in der sogenannten Deutschen Demokratischen Republik: Betriebspflicht. Im Revolutionsherbst 1989 gehörte sie nicht zu jenen, die eigensinnig, also ziemlich mutig, durch die Straßen zogen und mit ihren Protesten die eingeübte Aufmarschpraxis durchbrachen. Gegen die gültige Ordnung und für die Freiheit zu demonstrieren: Irgendwie sei ihr das damals gar nicht in den Sinn gekommen.

Hören Sie hier den Artikel als Audio!
Einfach anklicken, auswählen und anhören!
Diese Momentaufnahme sagt so viel aus über die Gegenwart der deutschen Demokratie wie über ihre Geschichte. Die Deutschen und ihr Verhältnis zur Demokratie ist ein Thema, das das Land seit einigen Jahren so intensiv umtreibt wie niemals zuvor. Mit dem Aufstieg des Rechtspopulismus waren es zunächst das politische Feuilleton, die als „Altparteien“ bedrängten anderen Parteien sowie die Staats- und Regierungsverantwortlichen, die sich der radikalnationalistischen Ermächtigung in den Weg zu stellen suchten – mit Texten und Sonntagsreden, Demokratie-Förderprogrammen und Demokratie-Erinnerungsinitiativen.
Von bundesweitem Interesse
Doch in diesem Jahr hat sich in Ost wie West, Nord wie Süd die sogenannte gesellschaftliche Mitte gerührt. Die Mobilisierung der so leicht beschworenen wie schwer fassbaren Zivilgesellschaft geschah in einer Weise, die das Gesicht der Berliner Republik – zumindest vorübergehend – in ein neues Licht getaucht hat. Bundesweit bastelten die Leute Plakate für die „Erhaltung der Demokratie“, stehen für „Toleranz und Vielfalt“ im Regen und pfiffen gegen die „Brandstifter-AfD“. Auch wenn die Demos vorüber sind und das vielerorts dennoch anhaltende Engagement stillere Formen angenommen hat, war dies der erste Moment seit der deutschen Einheit, in dem das gesamte Land als Bundesrepublik sichtbar wurde.
Folgen lange zurückliegender Geschichte

Beides – der Aufstieg des Rechtspopulismus und die demokratische Mobilisierung der Mitte – sind Folgen einer deutsch-deutschen, also im doppelten Sinne geteilten Geschichte der Demokratie, die nicht erst 1990 begann, sondern bis 1949 und – in längerer Sicht – gar bis tief ins 19. Jahrhundert zurückreicht. Ich meine, dass man beide Entwicklungen besser verstehen und politisch klüger darauf reagieren kann, wenn man diese geteilte Demokratiegeschichte der „longue durée“ stärker berücksichtigt – ja sie überhaupt als solche begreift.
Wir sind es gewohnt, die deutsche Nachkriegsgeschichte vor allem als Kontrastgeschichte zu sehen – und führen seit 1990 die sogenannte Ost-West-Debatte in der exakt gleichen Schemenhaftigkeit: Hier die westdeutsche Demokratiegeschichte, dort die ostdeutsche Diktaturgeschichte. Hier die gewachsene Zivilgesellschaft, dort die apathische Nischengesellschaft. Hier gelungene Emanzipation, dort weitreichende Stagnation. Dabei trugen nach dem verheerenden Ende des „Dritten Reiches“ 1945 beide Teilstaaten die Republik im Namen, beriefen sich beide auf die Demokratie – hier die parlamentarische, dort die sozialistische. Und beide Nachkriegsordnungen versprachen der Bevölkerung staatsbürgerliche Teilhabe und Mitwirkung.
Nominelle Teilhabe statt wahre Demokratie
Wahrhaft demokratische Prinzipien – politische Gleichheit, freie und geheime Wahlen, Rechtsstaatlichkeit und Gewaltenteilung – gab es freilich nur in der Bundesrepublik. Die DDR war hingegen in Wahrheit eine Diktatur. Eine „Konsensdiktatur“, wie es Martin Sabrow formuliert hat: Einerseits wurden dort Menschen- und Bürgerrechte tagtäglich mit Füßen getreten, andererseits einem „identitären“ Herrschaftsverständnis folgend die ständige Übereinstimmung zwischen einem vermeintlich einheitlichen „Volkswillen“ und der alleinherrschenden „Einheitspartei“ so penetrant eingefordert wie postuliert.
Doch das Diktaturparadigma sollte nicht den Blick darauf verstellen, dass die DDR (wie andere kommunistische Regime auch) für sich beanspruchte, ebenfalls die Demokratie zu verwirklichen – und zwar nicht die vermeintliche „Klassenstaatdemokratie“ der bürgerlich-kapitalistischen Sorte, in der die ungleichen Eigentumsverhältnisse unter dem Deckmantel der liberalen Demokratie die ungleichen Herrschaftsverhältnisse nur betonierten. Vielmehr behauptete die SED, im Osten Deutschlands die „wahre“, die sozialistische, die „Volksdemokratie“ zu verwirklichen. Demokratie war in der DDR eine Frage von nomineller Teilnahme, nicht von substanzieller Teilhabe.
Verschiedene Perspektiven
Auch wenn also mit Blick auf diesen Staat von einer Demokratiegeschichte im engeren Sinne keineswegs die Rede sein kann, ist es essenziell, sie als Demokratieanspruchsgeschichte zu verstehen und zu beschreiben. Der strategische, symbolische, propagandistische – oder schlicht: simulative – Bezug auf die Demokratie spielte in der DDR eine zentrale Rolle. Sie kann sich folglich nicht in ihrer Beschreibung als Diktatur erschöpfen. Vielmehr ist mit diesem Staat auch ein zwar unerfülltes, aber dennoch real wirksames Demokratieversprechen untergegangen.
In längerer demokratiegeschichtlicher Perspektive rücken damit beide deutschen Nachkriegsstaaten als „parallel verflochtene“ (Christoph Kleßmann) Ordnungsentwürfe nach dem Nationalsozialismus in den Blick. Die beiden Staaten brachten zwei spezifische Demokratie- beziehungsweise Demokratieanspruchstraditionen hervor, die 1989/90 folgenreich konvergierten, ohne ineinander aufzugehen, was unsere politische Kultur bis heute prägt.
Diesen beiden Traditionen vor 1989 und ihren Konvergenzen nach der Zäsur bin ich in meinem Buch Tausend Aufbrüche anhand Tausender Bürgerbriefe, Petitionen, Konzeptpapieren und Flugblättern aus Ost und West nachgegangen. Diese Quellen geben Aufschluss über subjektive Sichtweisen auf ein politisches System. Sie berichten darüber, wie Menschen als Individuen und in Gruppen über die politische Ordnung, in der sie leben, denken und wie sie sich dazu verhalten. Rein quantitative Erhebungen wie Wahl- und Meinungsumfragen reichen für ein Verständnis von politischer Ordnung und Kultur nicht aus – erst recht nicht, wenn man deren Persistenz und Wandel erklären will.
Wie die Auswertung zeigt, wurde die Demokratie im Westen als staatliche Ordnung und alltägliche Praxis verhandelt. Im Osten hingegen war sie staatliches Postulat und alltägliche Utopie. Entsprechend blickten Bürgerinnen und Bürger auf ihren jeweiligen Staat und das mit ihm verbundene (vermeintlich) demokratische Gemeinwesen: als gestaltungsbedürftige, aber auch gestaltungsoffene Daueraufgabe im Westen und als schicksalhafte, zwischen Verheißung und Verzweiflung changierende Herausforderung im Osten.
Politik als Lebensaufgabe
Entscheidend in Bezug auf die Demokratiebewegung vom Herbst 1989 ist, dass dabei überwiegend nicht primär die repräsentativ-parlamentarische Demokratie verhandelt wurde, sondern die Idee der direkten oder Basisdemokratie. Tausende bislang kaum erforschte Bürgerbriefe, Petitionen und Konzeptpapiere aus den Monaten rund um den Mauerfall belegen dies eindrücklich. Darin formulierten die Absender aus allen Ecken der DDR die gesellschaftliche Antwort auf das hohle SED-Volksvertretungsversprechen – endlich sollte „wirklich“ das Volk herrschen, und dies war nur mit „echter“, „unmittelbarer“ Bürgerbeteiligung denkbar; gegen oder zumindest fernab der einen Partei und der ihr hörigen staatlichen Institutionen.
Diese Demokratiebewegung wirkte weit über 1989/90 hinaus, und zwar auf zweierlei Weise. Einerseits prägte sie die politische Kultur des vereinigten Deutschlands konstruktiv: Sehr viele damals politisierte und „bürgerbewegte“ Menschen wandten sich dauerhaft der Politik zu, nahmen sie als Lebensaufgabe an. Die Statistiken zur ostdeutschen Elitenrepräsentation belegen das: Nur und gerade im „staatspolitischen Sektor“ waren Ostdeutsche seither leicht überrepräsentiert, was in den diesbezüglichen Debatten bislang kaum eine Rolle spielt. Diese Statistik erklärt auch, warum die zeitweilige Doppelspitze in der Führung des Landes unter Angela Merkel und Joachim Gauck keineswegs als Ausnahme von der Regel abgetan werden kann. Vielmehr ist sie Ausdruck einer insgesamt gelungenen Ankunft der Ostdeutschen in der bundesrepublikanischen Demokratie.
Dankbarer Resonanzboden
Andererseits wirkt der demokratische Umbruch aber auch eigensinnig-destabilisierend im politischen System der erweiterten Republik fort. Mit dem Aufstieg von Pegida und AfD als vermeintlich bürgerlicher „Sammlungsbewegung“ und „Alternative“ zum bisherigen bundesrepublikanischen Parteiensystem griffen die Rechtspopulisten (mehr oder weniger kalkuliert) die direkt- und straßendemokratischen Impulse der 1989er Revolution auf. Slogans von der Wiederherstellung der „wahren“ Volkssouveränität, von der „Vollendung der Wende“ und einer Politik „von unten nach oben“ schlagen genau in diese Kerbe. Natürlich steht die repräsentative Demokratie auch im Westen Deutschlands und darüber hinaus unter Druck; rechts- und linkspopulistische Parteien haben vielerorts Konjunktur. Doch aus den genannten Gründen stoßen populistische Forderungen in Ostdeutschland auf besonders große Resonanz.
Zwischen diesen beiden Polen – den konstruktiven und den destruktiven Impulsen der 1989er Revolution – liegt nun nicht so sehr die schweigende, sondern gewissermaßen die „gebrannte“ Mitte der ostdeutschen Gesellschaft, die auf die doppelte Diktaturmobilisierungserfahrung des 20. Jahrhunderts lange vor allem mit hartnäckiger staatsbürgerlicher Zurückhaltung reagiert hat: geringere Wahlbeteiligung, geringere Parteienmitgliedschaft und -bindung, weniger gewerkschaftliche und vereinspolitische Organisation und so weiter. Diese Mitte hat aber in ihrer übergroßen Mehrheit die Übernahme der Grundgesetz-Ordnung und die deutsche Einheit nie infrage gestellt. Sie stimmt laut Umfragen der Demokratie als Staatsform ebenso sehr zu wie der westdeutsch sozialisierte Teil des Landes. Es ist essenziell, sich dabei zu vergegenwärtigen, dass sich die Ostdeutschen die liberale Demokratie nach 1990 nicht etwa gerahmt von einem „Wirtschaftswunder“ aneignen konnten wie die Bundesbürger nach 1949. Es prägten vielmehr existenzielle Überlebenskämpfe die harte Transformationszeit.
Anlass zur Hoffnung?
Nicht nur gemessen an der Gesamtbevölkerung einer mittelgroßen Stadt in Brandenburg, sondern gerade angesichts dieser besonderen Vorgeschichte, waren die eingangs erwähnten 4000 Frankfurter Demonstranten an jenem Samstag im Januar eine beeindruckende Zahl. Vielleicht waren diese Demonstrationen mehr als ein Ausdruck spontaner Empörung über den von der AfD avisierten Umgang mit zugewanderten Mitbürgerinnen und Mitbürgern. Vielleicht bietet dieser Moment, in dem erstmals seit 1990 das gesamte Land als Bundesrepublik sichtbar geworden ist, Anlass zur Hoffnung. Hoffnung darauf, dass die Demokratie im Osten noch stärker und im Westen wieder stärker als gestaltungsbedürftige Ordnung verstanden wird. Demokratie ist kein Zustand, sondern ein Prozess. Sie ist auf die individuelle Zuwendung möglichst vieler in der Bevölkerung angewiesen – auch und gerade die der Skeptiker oder jener, die noch nicht seit Generationen in diesem Land leben. Oder eben auch jener, die sich in der DDR, auf welcher Seite auch immer, am verlogenen Demokratieideal der SED aufgerieben haben.
Die Geschichte der Demokratie in Deutschland gilt es in diesem Sinne fortzuschreiben: als Ringen um das Verhältnis von Anspruch und Wirklichkeit. An reichhaltigen Erfahrungen mangelt es jedenfalls nicht.
Eine längere Version dieses Textes erschien in der „Neuen Gesellschaft/Frankfurter Hefte“, 3 (2024), S. 2–7.
Buchtipp
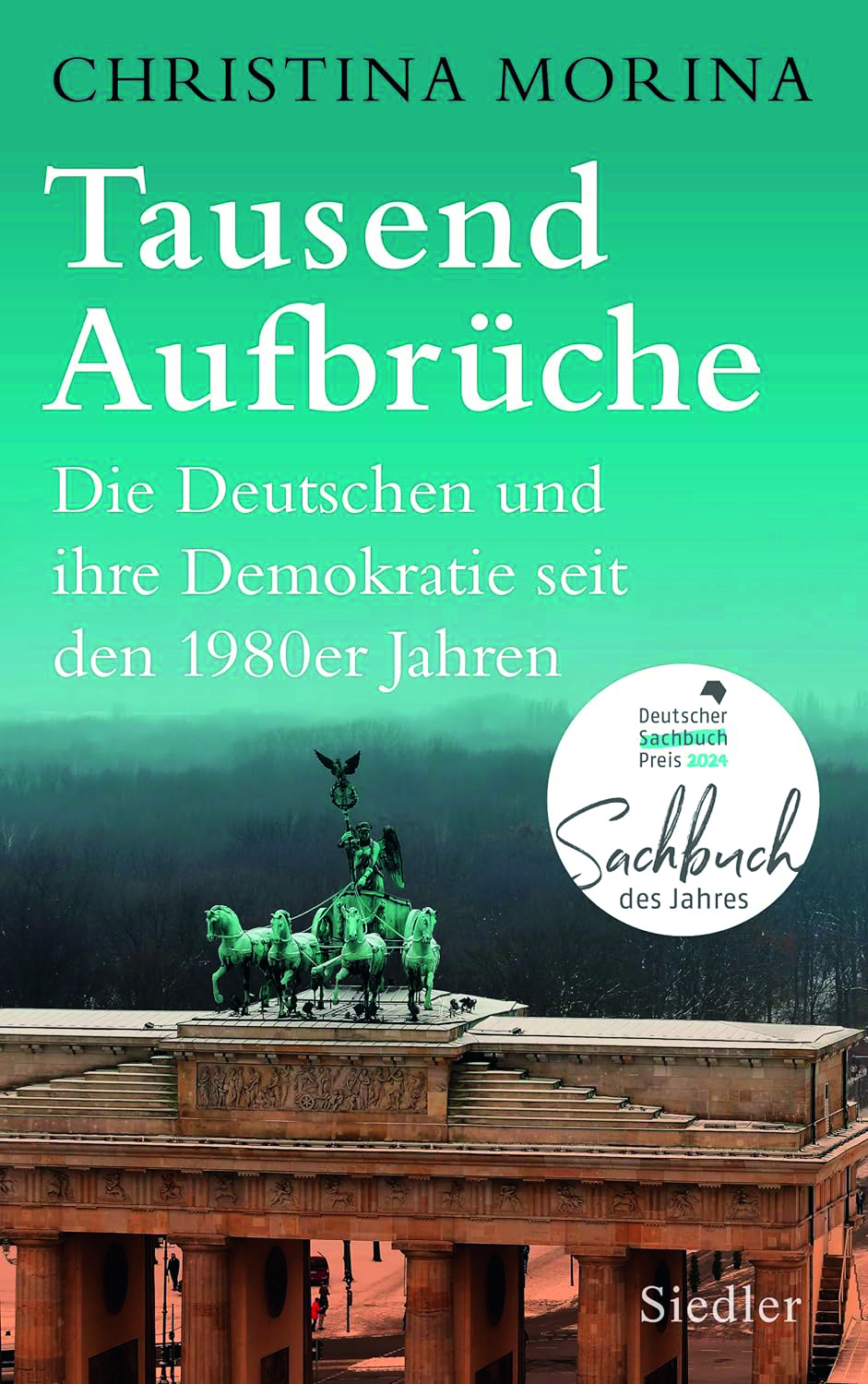
Christina Morina
Tausend Aufbrüche: Die Deutschen und ihre Demokratie seit den 1980er Jahren
Siedler Verlag 2023,
400 Seiten, 28 Euro

Prof. Dr. Christina Morina ist seit 2019 Professorin für Allgemeine Geschichte an der Universität Bielefeld. Ihre Forschungsschwerpunkte liegen in der Gesellschaftsund Erinnerungsgeschichte des Nationalsozialismus, in der politischen Kulturgeschichte des geteilten und vereinigten Deutschlands sowie im Verhältnis von Geschichte und Gedächtnis.







