Forum
Klima oder Arten?

Die Krise der Biodiversität ist auch eine Krise des bisherigen Umweltschutzes. Dass dessen Fokus lange auf dem Klimawandel lag, wirkt sich fatal aus.
Seit Langem führen wir Menschen regelrecht Krieg gegen die Natur. Wir greifen dabei keineswegs nur in die Geosphäre des Planeten ein, dessen Temperatur wir durch die Nutzung fossiler Brennstoffe erhöhen. Vielmehr dominieren wir aufgrund unseres Bevölkerungswachstums und Ressourcenverbrauchs auch die Biosphäre. Was wir uns zu selten klarmachen: Hinter dem Wachstum der Wirtschaft, hinter Wohlstand und Wohlergehen von immer mehr Menschen weltweit, so begrüßenswert beides ist, lauert der Niedergang der Natur. Wir stehen daher vor einem naturhistorisch einschneidenden Massenaussterben der Tier- und Pflanzenwelt – einer biologischen Zeitenwende, wie es sie zuletzt vor rund 10.000 Jahren mit dem Aufkommen von Acker- und Viehwirtschaft gegeben hat, das die Menschheit auf den fatalen Pfad übermäßiger Ausbeutung und Ausbreitung gebracht hat.

Hören Sie hier den Artikel als Audio!
Einfach anklicken, auswählen und anhören!
Tatsächlich ist die Lage der Natur inzwischen dramatisch: In den vergangenen Jahrzehnten haben wir die Bestände von Säugern, Vögeln, Reptilien, Amphibien und Fischen weltweit um durchschnittlich mehr als 70 Prozent dezimiert, so der jüngste Living Planet Report des World Wildlife Fund (WWF). Mindestens eine Million Tier- und Pflanzenarten sind vom Aussterben bedroht, warnt der Weltbiodiversitätsrat (IPBES).
Allerdings basieren diese Zahlen auf einer vergleichsweise kleinen Auswahl an Arten, da wir meist nur für Vögel und Säugetiere überhaupt ausreichend Daten haben. Dass aber mehr als zwei Drittel der daraufhin untersuchten Populationen dramatische Bestandsrückgänge zeigen, ist nicht nur bei den sogenannten Flaggschiffarten des Naturschutzes der Fall, also bei jenen ikonischen Arten wie etwa Tiger, Elefant oder Nashorn. Bereits jetzt spielen diese in den jeweiligen Lebensräumen ihres einstigen Vorkommens kaum noch eine ökologische Rolle, von Nationalparks einmal abgesehen. Das gleiche gilt für zahllose weitere Arten – sie überleben mittlerweile nur noch in zu kleinen Populationen in den wenigen Restlebensräumen isoliert voneinander. Zwar sind sie bisher noch nicht gänzlich aus der Wildnis verschwunden, doch ihre Bestände sind derart zusammengeschmolzen, dass sie vielfach ihre biologische Rolle im Ökosystem nicht mehr wahrnehmen können, weshalb sie gleichsam funktionell bereits ausgestorben sind, lange bevor sie in den einschlägigen Roten Listen der IUCN (International Union for the Conservation of Nature) als tatsächlich "extinct in the wild" aufgeführt werden.
Beim Artensterben geht es im Kern also nicht nur um das Verschwinden einzelner Arten, sondern um die damit verbundene Zerstörung des ökologischen Funktionierens ihrer Lebensräume. Es geht um den Verlust genetischer Variabilität und biologischer Vielfalt gewissermaßen als natürliches Reservoir für Resilienz, aus dem die Natur im Zuge allgegenwärtiger Anpassungen schöpft, mithin um einen biologischen Puffer bei Veränderungen der Umwelt. Wir verlieren dadurch immer mehr jenes biologische Kapital, aus dem wir aber als Menschheit auch zukünftig schöpfen wollen. Es geht um saubere Luft, um gesunde Böden, um die Bestäubung unserer Nahrungs- und Nutzpflanzen – damit also letztlich um unsere Lebensgrundlagen.

Klima ist nicht alles
Derzeit bestimmen Klimawandel und Energiewende die öffentliche Debatte, und wir zerstören viel Natur in der wohlgemeinten Absicht, aber irrigen Ansicht, unsere Umwelt zu retten. Doch Natur ist nicht nur Klima-Nutzen, ihr Erhalt darf nicht einfach neuen Energieformen geopfert werden, Wälder und Wiesen sind nicht allein Dienstleister der Dekarbonisierung oder Hausburschen der Kohlenstoffbilanz.
Vielmehr müssen wir in der Klima- und Umweltpolitik umdenken, da die geforderte Klimaneutralität um jeden Preis nicht automatisch umweltfreundlich ist. Natürlich müssen wir die bereits spürbaren Auswirkungen des Klimawandels abschwächen, wo es nur geht. Wir müssen dazu unsere Wirtschaft umbauen und grüne Technologien ausbauen. Doch die Dekarbonisierung darf nicht auf Kosten der Natur gehen und etwa der angestrebte Ausbau der Wind- und Solarkraft ebenso wie der Wasserkraft nicht zum Angriff auf den Artenerhalt werden. Bedingungslos allein auf den Schutz des Klimas zu setzen, dafür aber überall die Natur preiszugeben, wo es sie noch gibt, ist ökologisch geradezu selbstmörderisch. Denn damit sich Ökosysteme an den klimatischen Wandel anpassen können, brauchen wir resiliente Lebensräume mit reicher Artenvielfalt. Dafür aber müssen wir eine bessere Balance zwischen Biodiversität und Klima finden. Während der Klimawandel im Wesentlichen ein globales Phänomen ist, das sich angesichts des Zwei-Grad-Ziels und der Klimaneutralität wirksam nur international angehen lässt, können und müssen wir die Biodiversität auch unmittelbar lokal, regional und national erhalten, indem wir selbst jeweils vor Ort sehr viel mehr dazu beitragen.
Naturschutz versagt oft
Bereits jetzt ist das Sterben der Natur weitaus verbreiteter als es sich etwa aus den Roten Listen gefährdeter Arten ablesen lässt. Als universell eingesetztes Instrument haben diese Kataloge dem Naturschutz bisher eher einen Bärendienst erwiesen. Zwar wird das Sterberegister der Natur von Jahr zu Jahr länger und die erwähnten Roten Listen der IUCN füllen sich kontinuierlich mit immer mehr erfassten gefährdeten Arten. Dennoch tragen diese Listen dazu bei, nicht nur das Aussterberisiko für einzelne Artengruppen, sondern insgesamt das globale Artensterben ganz erheblich zu unterschätzen. Denn sie erfassen lediglich einen kleinen Ausschnitt der belebten Welt. Mit diesem verengten Fokus aber, der eben gerade nicht auf den schwindenden Lebensraum abzielt, lassen wir eine wichtige biologische Erkenntnis außer Acht: Für funktionierende Ökosysteme sind sämtliche Organismen wichtig und verdienen unseren Schutz. So wichtig der Erhalt einzelner Tiere und ausgewählter Arten ist, so wichtig ist der Schutz der gesamten Natur im Raum.
Diesen Naturschutz aber betreiben wir auf teilweise winzigen Restflächen, die sich wie ein löchriger Flickenteppich über das Land legen, auf denen sich die Natur nicht wirklich schützen lässt. Wir wissen aus jüngsten Studien, dass ein in der Fläche betriebener Natur- und Artenschutz in der Vergangenheit am wirkungsvollsten von allen Maßnahmen war. Demnach muss es unser Ziel sein, dem Verlust von Lebensraum durch die Einrichtung von Schutzgebieten entgegenzuwirken. Gerade weil die Haupttreiber der Artenverluste allerorts unsere Landbewirtschaftung und unser Landverbrauch sind, muss unsere Antwort ein erweiterter Flächenschutz sein. Das heißt: mehr, größere und erweiterte Schutzgebiete. Das heißt aber auch jeweils mit einem erhöhten Schutzstatus.

Das 30x30-Ziel von Montreal
Dazu aber braucht es ein klar formuliertes Ziel des Umwelt- und Naturschutzes, an dem es bei der Artenkrise lange krankte. Endlich wurde deshalb auf der UN-Biodiversitätskonferenz im Dezember 2022 in Montreal verabredet, dass bis 2050 kein Gebiet mit besonders bedeutsamer Biodiversität mehr verloren gehen soll. Konkret sei sicherzustellen, "dass bis 2030 mindestens 30 Prozent der Gebiete mit geschädigten Ökosystemen wirksam wiederhergestellt werden, um die Artenvielfalt und Ökosystemfunktionen sowie die ökologische Integrität zu verbessern" und zu ermöglichen, "dass bis 2030 mindestens 30 Prozent der Gebiete von besonderer Bedeutung für die Artenvielfalt und Ökosystem-Funktionen und -Dienstleistungen wirksam erhalten und verwaltet werden".
Zwar bleibt auch dieses Abkommen mit seinem wahrlich monumentalen Anspruch in allzu vielen Punkten vage; dennoch ist die Botschaft glasklar und deutlich: Die Natur ist kostbar, und wir Menschen dürfen ihr nicht überall den Raum streitig machen. Mit dem 30x30-Vorhaben ist ein eindeutiges, wenngleich ambitioniertes Ziel erklärt und fest in den Blick genommen. Es ist ohne Frage der Beginn eines langen Weges, und wir leben, auch was die Biodiversität betrifft, in einem kritischen Jahrzehnt. Doch nur wenn diese Vereinbarungen tatsächlich greifen, können wir überhaupt hoffen, wenigstens einen Teil der Artenvielfalt wirksam zu erhalten. Mit Montreal hat nun auch die Politik erkannt, dass die Artenkrise der nächste große Kampf und mindestens so dramatisch wie die Klimakrise ist.
Artenkrise abwenden
Nicht nur bei uns hat die Intensivierung der Land- und Forstwirtschaft während der vergangenen Jahrzehnte – in denen korreliert damit die Artenvielfalt zurückgegangen ist – zu dramatischen Eingriffen in die Lebensräume von Tieren und Pflanzen geführt. Die Landschaft wurde regelrecht ausgeräumt, vermeintlich störende Hecken, Bäume und Sträucher wurden gerodet, Brachflächen unter den Pflug genommen oder in Intensivgrünland umgewandelt. Trotz sinkender Bevölkerungszahlen zersiedeln wir weiterhin unsere Landschaft, schaffen immer neue Siedlungen, Industrieflächen und Straßen – wir zerfetzen dabei regelrecht die letzten Reste der Natur. Unser neuerdings gerade auch durch erneuerbare Energien und die damit einhergehende Transformation angetriebener Ressourcenverbrauch gefährdet ebenso wie die bisherige Landwirtschaftspolitik die Natur und das Überleben von immer mehr Arten. Diesen Trend müssen wir dringend umkehren und wieder mehr zusammenhängende, nicht zerschnittene Landschaftsräume schaffen.
Zumindest in der Europäischen Gemeinschaft wurde jüngst beschlossen, Natur auch außerhalb von Schutzgebieten wiederherzustellen. Zwar blieben im EU-Renaturierungsgesetz statt der ursprünglich avisierten 30 nur noch 20 Prozent als Zielmarke übrig; doch sollen auf dieser Fläche die vor allem durch die Landwirtschaft degradierten Lebensräume aller Mitgliedsstaaten nun renaturiert werden. Es wird darum gehen, etwa Waldflächen wiederaufzuforsten und Moore wieder zu vernässen, Flüsse in ihren natürlichen Zustand zurückzuversetzen. Dazu gehört auch, wichtige Strukturen der Landschaft und die Lebensräume vieler Tier- und Pflanzenarten wie Hecken, Raine und Kleingewässer wiederherzustellen. Durch gezielte Maßnahmen ließe sich so ein Biotopverbundsystem aufspannen, das durch Korridore die zuvor fragmentierten Naturflächen wieder vernetzt, sodass sich die Natur erholen kann und Arten auch in unserer Kulturlandschaft überleben.
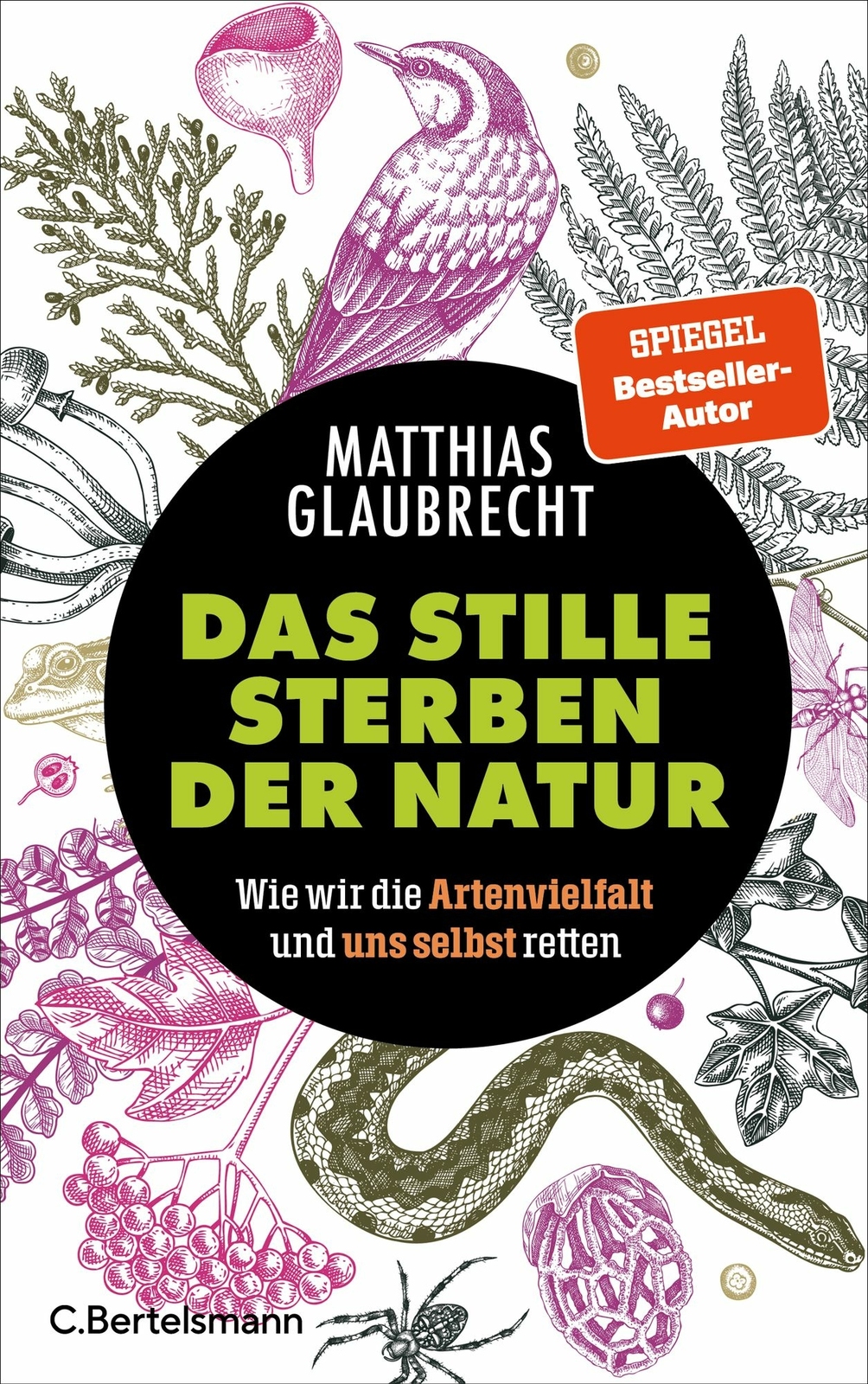
Wenn wir also das Richtige für den Planeten tun wollen, dann versuchen wir auf diese Weise zu retten, was uns in unserer Umwelt wirklich das Wichtigste sein sollte – und das ist jedes Stück Natur und jeder Teil der bedrohten Artenvielfalt. Um die Biodiversität zu bewahren, müssen wir der Natur insgesamt einen höheren Stellenwert einräumen. Wenn uns dies im laufenden Jahrzehnt und darüber hinaus nicht gelingt, wird das Leben auf der Erde andere Wege einschlagen.
Matthias Glaubrecht: Das stille Sterben der Natur. Wie wir die Artenvielfalt und uns selbst retten, Bertelsmann/Penguin Random House 2025, 224 Seiten, 22 Euro

Copyright: Sebastian Engels
Weitere Artikel des Autors
2/2023
Vom Ende der Evolution
9/2019
Nicht alles ist Humboldt
Mehr zum Autor







