Aktuell
„Wir haben die Digital Natives allein gelassen“

In seinem neuen Buch warnt Frank Meik vor den Gefahren von Künstlicher Intelligenz und Social Media. Gerade junge Menschen müssten lernen, zwischen Emotionen und Informationen zu unterscheiden, ist er überzeugt. Ein Interview
Der Historiker Yuval Noah Harari zeichnet in seinem Buch "Nexus" ein düsteres Bild von der Künstlichen Intelligenz. Auch Sie warnen in Ihrem jüngsten Buch "Mensch und Maschine". Warum so pessimistisch?
Harari befürchtet, dass KI die Menschheit ablöst. Ich dagegen bin optimistisch, dass wir die Digitalisierung und die künstliche Intelligenz für uns nutzen werden, nicht gegen uns. Es liegt ja nur daran, welche Grenzen wir der KI setzen. Was der KI fehlt, ist ein Bewusstsein und die Fähigkeit, die zum Teil widersprüchlichen Entscheidungen zwischen Emotion und Verstand menschlich zu treffen. Der Rechner arbeitet nach dem Prinzip der Mustererkennung mit Hilfe einer enormen Anzahl an Daten. Dadurch ist KI rasend schnell und sehr lernfähig – wird aber nie ein Bauchgefühl haben. Vor den Gefahren zu warnen ist wichtig, und den richtigen Umgang mit Social Media und KI zu finden, ist eine Herausforderung.
Seit einigen Jahren liest man immer wieder, dass Social Media unsere Demokratie gefährde. Worin liegt das Problem, wenn sich die Menschen in kurzweiligen Videos auf TikTok oder Instagram über das Weltgeschehen informieren?
In unserer Gesellschaft war die Medienwelt zunächst sehr einfach. Es gab nur wenige Fernsehsender und die waren öffentlich-rechtlich organisiert, garantierten also eine gewisse Nachrichtenqualität. Wir haben von daher ein großes Vertrauen in Informationen, die uns über den Bildschirm übermittelt werden. Die Social-Media-Anbieter – eigentlich müssten wir von asozialen Medien sprechen, weil sie zur Vereinsamung führen – haben nur ein Interesse: eine möglichst lange Verweildauer zu erreichen und so Geld durch Werbeeinnahmen zu erzielen. Sie sind zur Unterhaltung da und nicht zur Information. Jeder kann hier etwas posten oder einstellen, ob Fake News oder anderes, wichtig ist vor allen Dingen der Unterhaltungscharakter und wie oft ein Video angeklickt wird. Social Media haben mit sachlicher Information und seriöser Recherche wenig zu tun.
Elon Musk und Facebook-Chef Mark Zuckerberg haben mit ihrer Ankündigung für Aufregung gesorgt, Faktenchecks weitgehend abzuschaffen. Ist die Aufregung berechtigt?
Schon heute fehlt uns doch Kontrolle über das, was die sozialen Medien verbreiten. Fällt der Faktencheck weg, sind Fake News Tür und Tor geöffnet. Es hätte schon vor Jahren einer Regulierung bedurft, um Portale so zu regulieren wie andere Werbeträger und Medien. Stattdessen haben wir Facebook & Co. wie reine Anbieter technischer Plattformen behandelt. Eine Inhaltskontrolle, die Verantwortlichkeit für die verbreiteten Informationen, Datenschutz oder Schutz der Persönlichkeit fehlen. Auch das Kartellrecht muss sich endlich mit der Macht der Konzerne befassen.
Moment! Meinungsfreiheit ist ein demokratisches Grundprinzip. Mit dem Auftauchen des Internets schienen wir ihr nahe. Staatliche Zensur, so dachte man, würde obsolet und die Äußerung der eigenen Meinung vollkommen. Und jetzt fordern Sie mehr staatliche Kontrolle?
Meinungsfreiheit ist ein demokratisches Grundprinzip. Die Hoffnung, dass wir mit dem Internet mehr Meinungsfreiheit erreichen, war aber trügerisch. Es wurde dabei nicht bedacht, was es letztlich bedeutet, einen Raum für Inhalte, Texte, Bilder und Videos zu schaffen, der von jedem genutzt werden kann. Schon früh haben sich hier mächtige Webkraken positioniert. Längst haben die großen Plattformen und Social-Media-Anbieter den Werbemarkt in Deutschland im Griff. Schon heute erhalten die US-Internetgiganten die Hälfte der deutschen Medienetats, circa 150 Milliarden Euro. Darunter leiden insbesondere die privatwirtschaftlich organisierten Medienhäuser mit ihren Zeitungen, Zeitschriften oder Büchern. Wir müssen lernen, dass die Webkonzerne das Internet als Vermarktungsplattform mit Geschäftsmodellen nutzen, von denen vor allem die partizipieren, die die Reichweite und Macht besitzen. Daneben wird auch noch Meinung gemacht, weil die Kommunikationsströme durch Algorithmen gelenkt werden. Schon in meinem ersten Buch "Wir klicken uns um Freiheit und Verstand" im Jahr 2012 habe ich gefordert, die Webkraken als Medien zu behandeln.
Bei den Landtagswahlen im Osten und bei der Bundestagswahl haben junge Menschen verstärkt die politischen Ränder gewählt. Aus freien Stücken, also sehr demokratisch. Das muss eine funktionierende Demokratie aushalten, oder?
Die Wahlentscheidung ist für die Bürger eine der wichtigsten Freiheiten, die der Staat garantiert. Jeder darf wählen, was er will, und das ist auch richtig und gut so. Trotzdem muss man sich fragen, warum die jungen Menschen die Extremen und Populisten gewählt haben am rechten und am linken Rand. Dazu muss man sich die Social-Media-Aktivitäten und das Nutzungsverhalten der Jugendlichen bei Medien genauer ansehen. Große Kampagnen auf TikTok, Youtube und dem Meta Konzern – WhatsApp, Instagram und Facebook – haben Themen nach vorne gerückt in einer Sprache und Einfachheit, die jungen Menschen gefällt und sie emotional anspricht. Auch das ist in einer Demokratie völlig in Ordnung, nur dürfen die jungen Menschen nicht meinen, damit Informationen zu erhalten und daraus ihre eigene Meinung zu bilden. Sie müssen lernen, zwischen Stimmungen, Emotionen und Informationen zu unterscheiden.
Woran denken Sie? An die Einführung des Schulfachs "Medienkompetenz"?
Es ist sicherlich ein wichtiger Ansatz. Wobei der Begriff oft falsch verstanden wird. Wir hatten doch schon einmal einen Medienführerschein. Es geht im Wesentlichen darum, Kindern und Jugendlichen zu vermitteln, was seriöse Informationen sind und in welchen Quellen sie diese erhalten. Ferner muss ihnen klar gemacht werden, dass Social Media zur Unterhaltung und Kommunikation da ist und in erster Linie viel Geld verdienen will. Es geht aber auch nicht nur um die Schule. Wichtig ist auch die elterliche Erziehung über den Umgang etwa mit dem eigenen Smartphone oder Computer.
Mancherorts in Kanada und in Lettland gibt es ein Handyverbot an Grundschulen. Einige deutsche Schulen handhaben das ebenso. Ist das der richtige Weg?
Dies ist sicherlich eine von mehreren möglichen ersten Maßnahmen, um sicherzustellen, dass junge Menschen den Unterschied zwischen Wirklichkeit und virtueller Welt verstehen und wahrnehmen können. Das Problem ist doch, dass Kinder und Jugendliche sich von der Faszination der schönen Bilder, Filme und Musik schnell gefangen nehmen lassen. Dagegen ist die Wirklichkeit oft spröde, langweilig und unbequem. Der Umgang mit dem Handy und sein Einsatz ist ein wichtiger Faktor. Ein verantwortungsvoller Umgang mit dem Werkzeug, das den Weg in die virtuelle Welt öffnet, ist essenziell. Er muss aber erlernt werden.
Sie sagten es eben: Ist das nicht vor allem die Aufgabe der Eltern? Mama und Papa erkaufen sich oft ein bisschen Ruhe, in dem sie ihren Kindern viel zu früh, viel zu oft und viel zu lange ein Handy in die Hand drücken.
Natürlich ist es auch eine Aufgabe der Erziehung, Grenzen zu setzen. Und vielleicht ist sie im digitalen Zeitalter in bestimmten Bereichen herausfordernder geworden. Erziehung war aber schon immer schwierig. Man muss Kinder ernst nehmen, ihnen Regeln setzen, sich mit ihnen beschäftigen und Dinge erklären. Das kostet Zeit und Kraft. Umso wichtiger ist es, sich mit den Kindern auseinanderzusetzen und ihnen Hilfe und Anleitung zu geben.
Welche Gefahren für Demokratien sehen Sie durch die unkontrollierte Nutzung von Social Media?
Wir haben bereits in mehreren Fällen erfahren, wie manipulativ über Werbekampagnen und Fake News die Meinung der Bevölkerung in Demokratien über Social Media beeinflusst werden kann. Wir erleben auch heute, wie versucht wird, unsere Demokratie mit Fake News zu beeinflussen. Es geht dabei um Destabilisierung. Autokratien haben es da leichter. Dort wird bestimmt, was richtig ist. In Demokratien sind Lösungen oft komplex und schwierig. Sie entstehen durch langwierige, aber wichtige Diskussionen und Abstimmungsprozesse. Soziale Medien können insbesondere den emotionalen Bereich sehr gut ansprechen. Dies sichert ihnen viel Aufmerksamkeit. Deshalb ist es für Populisten viel leichter, die Meinung über Social Media zu beeinflussen. Dort sind weniger Fakten gefragt, sondern Stimmungen und einfache Parolen. In Deutschland legen wir Wert auf Datenschutz. Vor allem halten sich daran Einrichtungen, die in Deutschland ihren Sitz haben. Die EU hat mit ihrer Neuregelung des Datenschutzes auch Unternehmen im Ausland hierzu verpflichtet und entsprechende Sanktionen bei Nichtbefolgung festgesetzt. Trump lehnt diese Regelungen aber nun ab, sodass wir uns alle fragen müssen: Gibt es überhaupt noch einen Datenschutz?
In Ihrem Buch beschäftigen Sie sich intensiv mit den Auswirkungen der digitalen Revolution auf die junge Generation. Ist die "Generation Z" gewappnet?
Das ist sie leider nicht. Die Generationen Z und Alpha sind mit der virtuellen Welt groß geworden. Es ist ein Versäumnis von uns allen. Wir haben die Digital Natives allein gelassen. Wir haben ihnen nicht erklärt, was Qualitätsinformationen sind und sie ihrer Faszination für das Digitale überlassen. Dadurch ist diese Generation oft ängstlich und sucht nach Orientierung und Führung. Im Grunde brauchen die jungen Leute Ansprechpartner in Betrieben. Viele wechseln ihre Anstellung oder Ausbildung nach kurzer Zeit und fühlen sich ständig überfordert. Wenn man sein halbes Leben damit verbracht hat, vor dem Bildschirm zu sitzen und sich dort gut darzustellen, dann fehlt oft die Orientierung im wirklichen Leben.
Aber das ist doch die Generation, die mit den sozialen Medien aufwächst. Und jetzt sollen ihr ausgerechnet die Boomer die Spielregeln erklären?
Das ist gerade das Problem, dass wir uns nicht mit den neuen Techniken so beschäftigt haben und selbst keinen verantwortungsvollen Umgang vorgelebt haben. Das große Missverständnis der Gesellschaft war, dass man nur die Geräte zur Verfügung stellen muss, auch den Schülern, Kindern und Jugendlichen. Danach haben wir sie allein gelassen. Wir hätten ihnen erklären müssen, was Qualitätsinformationen sind, sie nicht einfach der Faszination über das Digitale überlassen dürfen.
Die Generation über 30 ist die letzte, die ohne Social Media aufgewachsen ist und am besten beurteilen kann, wie die Dinge sich verschoben haben. Wir betrachten die Demokratie mittlerweile als selbstverständlich. Dies ist sie aber nicht. Sie muss ebenso wie die Freiheit immer wieder hart erarbeitet werden und gegen alle Anfeindungen von Diktatoren oder Autokraten geschützt werden. Ohne eigenständiges Denken, dazu gehört auch das Lesen, die Aufnahme und Verarbeitung von Information, bildet sich keine eigene Meinung. Diese ist aber Voraussetzung für eine wirksame Demokratie.
Welche Rolle kommt Rotary dabei zu?
Lesen ist eine wichtige Grundvoraussetzung für das Aufnehmen und Verstehen. Bildungsprogramme wie 4L sind zu unterstützen. Sie genügen aber nicht. Vielmehr muss sich Rotary intensiv damit beschäftigen, wie junge Menschen politische und gesellschaftliche Inhalte mit Qualität aufnehmen. Hier geht es gar nicht um das Ob, sondern um das Wie. Vielleicht gehört auch dazu, bei Rotary klarzumachen, "dass morgen heute gemacht wird". Hier gibt es sehr viele spannende Zukunftsaufgaben. Gerade Rotarier können es sich zur Aufgabe machen, wichtige Grundlagen für die Demokratie zu sichern und zu vermitteln. Dazu gehört die Aufklärung bei der Jugendarbeit ebenso wie bei der beruflichen Weiterbildung und auch die Unterstützung an Kindergärten und Schulen.
Wie finden wir in unserer Gesellschaft, die kaum noch miteinander, sondern zunehmend untereinander kommuniziert – vorzugsweise in Messenger-Diensten – zurück zum Dialog?
Theoretisch ist die Frage leicht zu beantworten. Die Menschen müssen es ertragen, dass andere Meinungen geäußert werden und sich nicht abwenden. Vielmehr müssen sie lernen, in der Diskussion ihre eigene Meinung kundzutun und nicht nur Gefühle zu äußern. KI wird die Möglichkeiten der Social Media sicher weiter verändern und dadurch deren Einfluss noch vergrößern. Wir alle müssen neugierig, kritisch und lernwillig die neuen Techniken verstehen und sie nicht einfach nur konsumieren. Praktisch wird es nur funktionieren, wenn man die Verwöhnungstools als solche demaskiert und klarmacht, dass die Kommunikation auf den virtuellen Kanälen eben keine Freundschaften begründet oder Sozialkontakte ermöglicht, sondern nur der Eigenbestätigung dient. 100.000 Follower sind eben weniger als ein Freund.
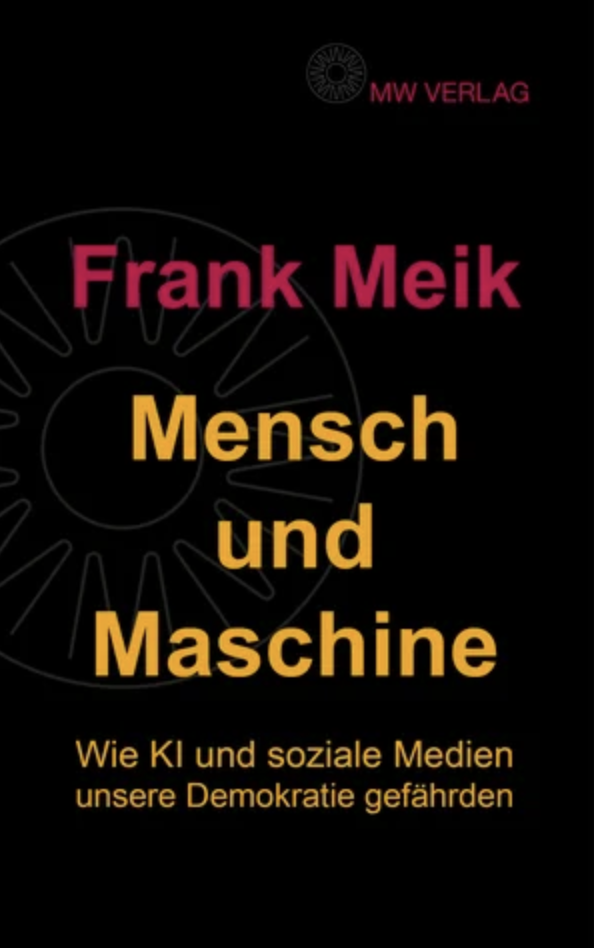
Das Gespräch führte Björn Lange.
Frank Meik (RC München-Harlaching) ist promovierter Jurist und seit 2005 geschäftsführender Gesellschafter des MW Verlags. Zuvor war er unter anderem Vorsitzender der Geschäftsführung der Frankfurter Allgemeine Zeitung GmbH und Verlagsgeschäftsführer des Münchner Zeitungsverlages.
Frank Meik
Mensch und Maschine: Wie KI und soziale Medien unsere Demokratie gefährden, MW Verlagsgesellschaft 2024, 145 Seiten, 20 Euro







