Titelthema
Zwei verschenkte Jahre
Russland kämpft nicht nur gegen die Ukraine, sondern gegen den ganzen Westen. Deutschland muss dringend verteidigungsfähig werden.
Es sind Bilder von einem Regierungschef, die in Deutschland über Jahrzehnte nahezu unvorstellbar waren. Bundeskanzler Olaf Scholz steht in einer Produktionshalle des Rüstungsunternehmens Rheinmetall in Unterlüss, vor ihm eine Batterie verschiedener Artilleriegeschosse, neben ihm Konzernchef Armin Papperger, die dänische Ministerpräsidentin Mette Frederiksen und Verteidigungsminister Boris Pistorius. Nicht nur, dass sich der Kanzler mit den drei so fotografieren lässt, ist eine Art politische Zeitenwende.
Scholz berührt sogar eine der Granaten an der Geschossspitze, womit er vermutlich ausdrücken will, dass Kriegsmaterial heute nicht mehr verpönt sein sollte in Deutschland. Kurz darauf formuliert er das auch in Worte: Es gehe darum, die Bundeswehr zur stärksten konventionellen Streitkraft Europas zu machen. "So hart diese Realität ist, aber wir leben nicht in Friedenszeiten."
Dieser Spatenstich für ein Munitionswerk von Rheinmetall im Februar in der Lüneburger Heide ist ein mediales Ereignis. Alle großen Sender und Zeitungen berichten, auch im Ausland. Als Angela Merkel noch Kanzlerin und Ursula von der Leyen noch Verteidigungsministerin war, schienen solche Bilder unmöglich. Seit dem Mauerfall wollten die meisten Spitzenpolitiker in Deutschland nicht mit Rüstung, nicht mit Waffen, nicht mit dem Militär und schon gar nicht mit dem Krieg verbunden werden.
Das hat sich seit dem groß angelegten russischen Überfall auf die Ukraine am 24. Februar 2022 geändert. Drei Tage später räumte Scholz in seiner "Zeitenwende"-Rede ein, dass Deutschlands Armee zur Verteidigung des Landes nicht mehr tauge. Er kündigte ein "Sondervermögen" an, 100 Milliarden Euro, finanziert über Kredite. Geld als Antwort auf die größte Bedrohung für die deutsche Sicherheit seit Jahrzehnten – das war einstweilen alles, was der Kanzler als Vision von der neuen Verteidigungsfähigkeit zu bieten hatte.
Heute, mehr als zwei Jahre später, ist Deutschland noch nicht viel weiter. Da nimmt die Politik den Spatenstich für ein Munitionswerk vor, das in frühestens einem Jahr Granaten produzieren soll, die die Ukraine aber jetzt dringend braucht. Da verliert die Ukraine im Kampf gegen die russischen Invasoren an Boden, weil die westliche Militärhilfe schwächelt. Da steht die Bundeswehr nicht "mehr oder weniger blank" da, wie es der Heereschef Alfons Mais vor zwei Jahren formulierte, sondern sie steht endgültig blank da. Und da ist die deutsche Gesellschaft genauso wenig verteidigungs- und kriegsfähig, wie sie es vor dem 24. Februar 2022 war.
Wiederholt zeigen Umfragen, dass die Deutschen nur in sehr geringem Maße bereit sind, einem östlichen Nato-Verbündeten militärisch zu helfen. Vor zwei Jahren, als Putins Truppen die ganze Ukraine angriffen, sprachen sich in einer Studie der Körber-Stiftung gut zwei Drittel der Befragten für ein langfristiges Engagement Deutschlands bei internationalen Krisen aus. Ende vergangenen Jahres befürwortete mit 54 Prozent eine Mehrheit der Deutschen indes schon wieder eine stärkere Zurückhaltung ihres Landes.
In Berliner Politzirkeln kursiert seit vorigem Herbst ein Szenario. Nach seiner erneuten Wahl zum US-Präsidenten wird demnach Donald Trump einen Deal mit Wladimir Putin schließen, in dem Europa unter Russen und Amerikanern wieder in Interessenzonen aufgeteilt wird. Die Grenze zwischen den beiden Machtblöcken läge diesen Überlegungen zufolge zwischen Polen und Deutschland. Die Bundesrepublik als Frontstaat wie zur Zeit des Kalten Krieges – das ist die Quintessenz dieses Szenarios.
Verwaltungsarmee ohne Kampfkraft
Es ist nicht so, dass die Bürger in der Bundesrepublik nicht bereit wären, sich ihre Verteidigung etwas kosten zu lassen. Bei der jüngsten Befragung der Körber-Stiftung aus dem November 2023 stimmten 72 Prozent von ihnen zu, mindestens zwei Prozent des Bruttoinlandsprodukts (BIP) für die Bundeswehr auszugeben. 26 Prozent hielten dies sogar für zu niedrig. Noch im Jahr 2017 sprachen sich 51 Prozent der Deutschen dagegen aus, den Anteil der Militärausgaben von damals 1,2 Prozent überhaupt auch nur minimal zu erhöhen. Es gibt heute sogar eine Mehrheit in der Bevölkerung für die Einführung einer allgemeinen Dienstpflicht für Männer und Frauen. Auch das wäre vor dem 24. Februar 2022 unvorstellbar gewesen.
Doch mehr Geld und in Umfragen geäußerte Verteidigungsbereitschaft machen noch lange keine Kriegsfähigkeit aus, wie sie Verteidigungsminister Pistorius fordert. Vor allem die Bundeswehr befindet sich nach wie vor in einem heruntergewirtschafteten, wenig kampftauglichen Zustand. Das beginnt bei der Truppe. Von den knapp 182.000 Soldaten sind mehr als 210 Generale und Admirale, gut 39.000 Offiziere, 95.000 Unteroffiziere und 46.000 Soldaten mit Mannschaftsdienstgraden. Noch nie hatten die bundesdeutschen Streitkräfte so wenig Soldaten und gleichzeitig so viele Organisationsbereiche, Stäbe, Kommandos und Behörden wie heute.
Vorstoß, Rückzug, in Bewegung bleiben
Diese Kopflastigkeit sorgt für viel zu viele Schnittstellen und erschwert es, Verantwortung zuzuordnen und wahrzunehmen. Das ist ein typisches Kennzeichen für eine friedensgewöhnte Armee. Sie bringt Bürokraten hervor und fördert sie. Verteidigungsminister Pistorius hat angekündigt, das zu ändern. Er will die Bundeswehr wieder auf ihren wesentlichen Kern ausrichten, den Kampf gegen einen Gegner, der konventionell (also nicht atomar) vorgeht.
Große Teile der Strukturen, die aufgebaut wurden, damit die Bundeswehr zu Friedenseinsätzen in Afghanistan oder Mali eingesetzt werden kann, sollen zurückgebaut werden. Dazu zählen Organisationsbereiche wie der Sanitätsdienst und die Logistik-Dienstleister der Streitkräftebasis (SKB). Sie werden wieder in die klassischen Teilstreitkräfte Heer, Luftwaffe und Marine eingegliedert.
Doch das ändert nichts daran, dass die Bundeswehr eine Verwaltungsarmee ist. Dafür sorgen nicht nur 80.000 Zivilbeschäftigte, sondern auch Zehntausende Soldaten, deren Tätigkeiten eher denen in großen Behörden gleichen denn denen einer Truppe, die den Ernstfall trainiert. Kampfkraft erzeugen diese Verwaltungssoldaten nicht. Sie sitzen im Kriegsfall nicht in Gräben und Stellungen, Kampf- und Schützenpanzern, Schiffen- und U-Booten, kosten aber viel Geld.
Die Bundeswehr gibt inzwischen von gut 52 Milliarden Euro regulären Budgets (Einzelplan 14) etwa 21 Milliarden für Personal einschließlich Pensionen aus. Doch eine Armee mit zu vielen "Häuptlingen" für zu wenig "Indianer" ist mit der heutigen Konfrontation in Europa überfordert. Der Krieg in der Ukraine zeigt, worauf es in einem Konflikt an der Nato-Ostflanke ankommen dürfte.
Die Truppen müssen sich zerstreuen, sich verstecken und immer in Bewegung bleiben. Künstliche Intelligenz an Bord einer Drohne oder in Einsatzzentralen kann heute Ziele mit nie da gewesener Schnelligkeit, Finesse und Präzision identifizieren, nach Prioritäten ordnen und zerstören. Auch Hauptquartiere im rückwärtigen Bereich müssen kleiner und weniger identifizierbar werden, häufig den Standort wechseln und ihre Funksprüche tarnen. Sonst sind sie leichtes Ziel für Präzisionswaffen.
Das Problem ist, dass für Kämpfer in der Bundeswehr von heute zu wenig Platz ist. Militärhandwerk, wie es in der Ukraine zu sehen ist, gehört nicht (mehr) zu ihrem Markenkern. Sie kann sich gut selbst verwalten und braucht dafür viel Personal. Statt Strukturen zu verschlanken, wie es immer wieder vorgeschlagen wurde, hat die deutsche Armee mit dem Territorialen Führungskommando im vorvergangenen Jahr noch ein weiteres Kommando geschaffen. So werden Dienstposten für immer mehr betagte Offiziere geschaffen, die für den Fronteinsatz nicht mehr geeignet sind.
Die Bundeswehr müsste wieder vom Kopf auf die Füsse gestellt werden. Weniger Ebenen, Verantwortungsdiffusion und Offiziere, dafür effizientere Strukturen, mehr Unteroffiziere und Mannschaften sowie Reservisten, notfalls auch unter Einführung einer allgemeinen Dienstpflicht. Das alles ist bekannt, vielfach untersucht und findet sich in Teilen im Koalitionsvertrag der derzeitigen Regierung. Der Bundeswehr mangelt es nicht an Erkenntnis. Sie hat ein Umsetzungsproblem.
Das gilt auch für den Munitionsmangel. Auch zwei Jahre nach dem russischen Überfall auf die Ukraine sind die Depots weitgehend leer. Selbst Munition, die an die Ukraine gegeben wurde, ist noch längst nicht ersetzt worden. Trotz der Ankündigung von Pistorius, die Beschaffung von Munition zur Chefsache zu machen, wurden große Teile des vom Bundestag genehmigten Geldes im Vorjahr nicht ausgegeben. Der Haushaltsfachmann der CDU, Ingo Gädechens, hat errechnet, dass die Bundeswehr im vergangenen Jahr kaufkraftbereinigt sogar weniger Munition beschafft hat als 2022.
Auch für die kommenden Jahre sieht es Gädechens zufolge nicht besser aus. Das Haushaltsgesetz erlaubte dem Verteidigungsministerium im Vorjahr, Verträge für die kommenden Jahre mit einem Gesamtvolumen von bis zu 1,8 Milliarden Euro abzuschliessen. Gebunden aber habe das Haus von Pistorius nur gut 630 Millionen Euro. 1,2 Milliarden Euro sind demnach verfallen.
Das Problem ist, dass die Produktion von Munition, vor allem die von der Ukraine gerade dringend benötigten Artilleriegranaten und Flugabwehrraketen, nicht über Nacht hochzufahren ist. Die Hersteller brauchen Planungssicherheit in Form von Verträgen und Vertrauen in die Politik, dass die Zeitenwende nicht nur ein Lippenbekenntnis ist. Schließlich sind die notwendigen Investitionen teuer.
So hat ein vergleichsweise kleiner Mittelständler wie Junghans Microtec in Baden-Württemberg in den zurückliegenden zwei Jahren etwa 100 Millionen Euro in die Hand nehmen müssen, um die Produktion von Zündern signifikant hochfahren zu können. Wenn die Fabrik in Unterlüss im kommenden Jahr gebaut ist, wird Rheinmetall mehr als eine Milliarde Euro allein nur in den Aufbau größerer Produktionskapazitäten für Artilleriemunition investiert haben.
Streitkräfte genügen Verfassungsauftrag nicht
Doch die Skepsis in der Industrie ist groß. Zwar hat sich die Bundesregierung auf lange Sicht verpflichtet, zwei Prozent und mehr des Bruttoinlandsprodukts in die Bundeswehr zu stecken. Doch sie sagt nicht, wie sie das finanzieren will. Wenn das Sondervermögen im Jahr 2027 aufgebraucht ist, muss der reguläre Wehretat von heute 52 Milliarden Euro auf dann mindestens 80 Milliarden erhöht werden. In der rot-grün-gelben Bundesregierung wird bereits ein zweites, ebenfalls schuldenfinanziertes Sondervermögen erwogen. Die Rede ist von weiteren 200 Milliarden Euro.
Als Bundeskanzler Scholz vor zwei Jahren in seiner Zeitenwende-Rede von einem 100-Milliarden-Sondervermögen für die Bundeswehr sprach, war die Zustimmung in breiten Schichten der deutschen Bevölkerung groß. Heute sieht es so aus, als ob das Sondervermögen nicht in Folge der Zeitenwende entstand, sondern anstelle der Zeitenwende. Die Bürger sollen den Eindruck haben, dass sich alles kaufen lässt, sich für sie aber nichts wirklich ändert. So als sei Deutschland gar nicht im Krieg.
Früher funktionierte das. Helmut Kohl stellte milliardenschwere Schecks aus, um Deutschland aus dem Golfkrieg Anfang der 1990er Jahre herauszuhalten. Nun aber findet seit Jahren ein Krieg Russlands gegen die liberalen Demokratien statt, und damit auch gegen Deutschland. Um das zu wissen, muss Wladimir Putin keine diplomatischen Noten überreicht haben, wie das früher bei Kriegserklärungen der Fall war. Man muss nur die Reden des Kremlherrn dazu hören. Russland wähnt sich in einem langwährenden Konflikt mit "dem Westen". Noch wird er in der Ukraine geführt. Wo und wie er in einigen Jahren stattfindet, weiß vielleicht nicht einmal Putin gerade.
Deutschland ringt mit sich, wie es auf diese Unsicherheiten reagiert. Verteidigungsminister Pistorius analysiert zum Beispiel derzeit verschiedene Wehrpflichtmodelle. Wie es aussieht, wird Deutschland nicht darum herumkommen, seine Bürger wieder zum Militärdienst zu verpflichten, um die nötige Verteidigungsfähigkeit auch mit Reserven wiederherzustellen. Genügend Soldaten findet die Armee schon seit Jahren nicht mehr.
Die Gewährleistung der äußeren Sicherheit ist die vielleicht vornehmste Aufgabe des Staates. Ohne äußere Sicherheit gibt es keinen Staat. Einem politischen Gemeinwesen, dass seine innere Ordnung nicht nach außen verteidigen kann, droht über kurz oder lang die Erosion und das Ende. "Der Bund stellt Streitkräfte zur Verteidigung auf." So heißt es im deutschen Grundgesetz. Schaut man auf die heutige Bedrohungslage und zugleich auf die Organisation, Größe und Ausstattung der Bundeswehr, dann bleibt nur eine Feststellung: Die Streitkräfte genügen nicht dem verfassungsgemäßen Auftrag.
Auch zwei Jahre nach der Zeitenwende hat sich an Deutschlands Verteidigungsfähigkeit nichts grundlegend gebessert. Ranghohe Nato-Vertreter warnen, in fünf bis maximal zehn Jahren sei Russland soweit, gegen Mitglieder der Allianz vorzugehen. Der Krieg in der Ukraine sei dafür lediglich das Vorgeplänkel. Deutschland muss also Tempo machen, um sich wieder verteidigen zu können.
Zumindest wenn es Selbstbehauptungswillen hat. Weil aber seit Kriegsbeginn zwei Jahre vergehen müssen, bis auch nur der Spatenstich für eine seit dem 24. Februar 2022 dringend benötigte Munitionsfabrik in der Lüneburger Heide gesetzt ist, muss man zweifeln, dass dieser Wille besteht.
Buchtipp
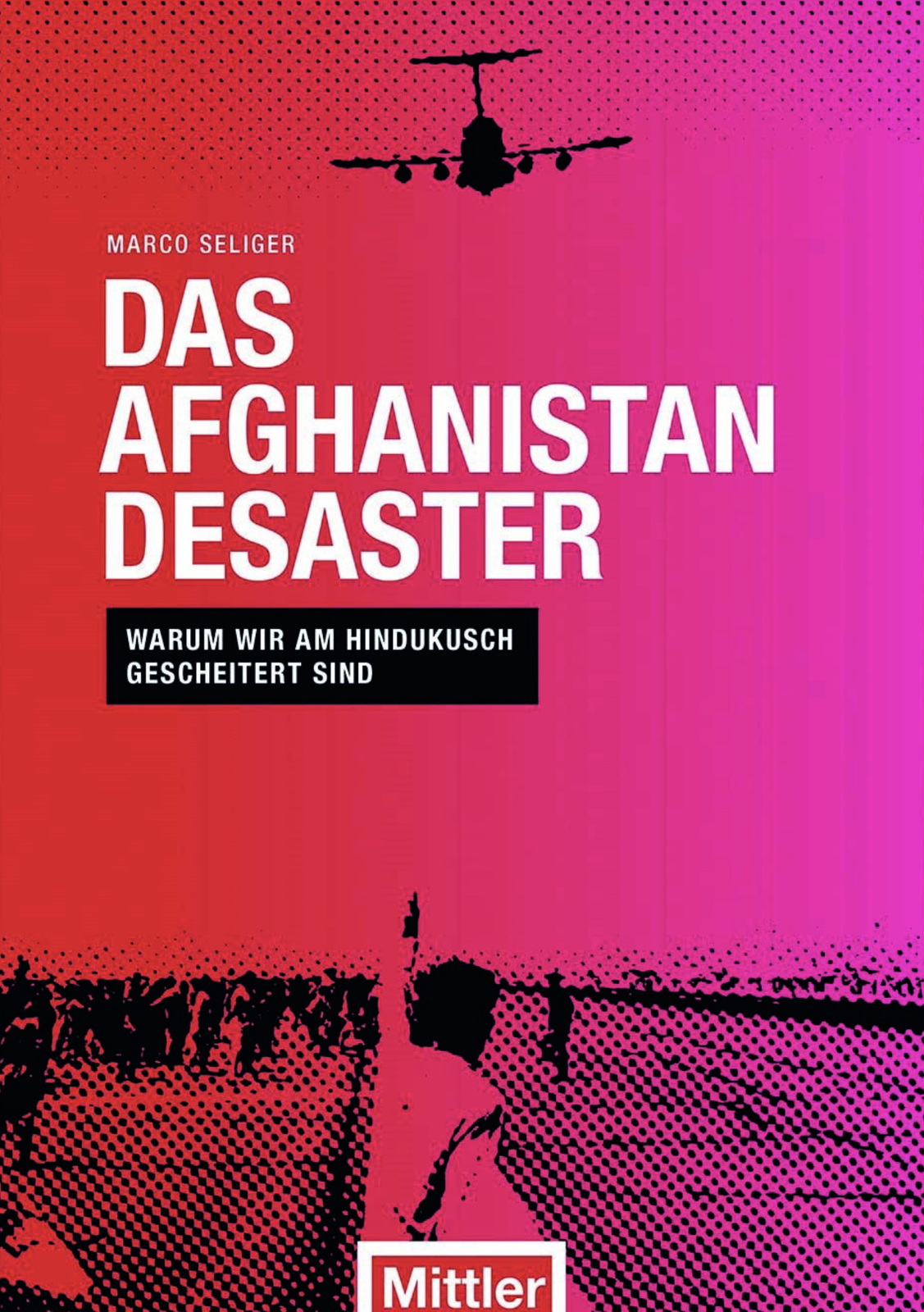
Marco Seliger
Das Afghanistan-Desaster: Warum wir am Hindukusch gescheitert sind
Mittler 2022, 350 Seiten,
25,95 Euro

© Jonas Ratermann







