Forum
Up and down
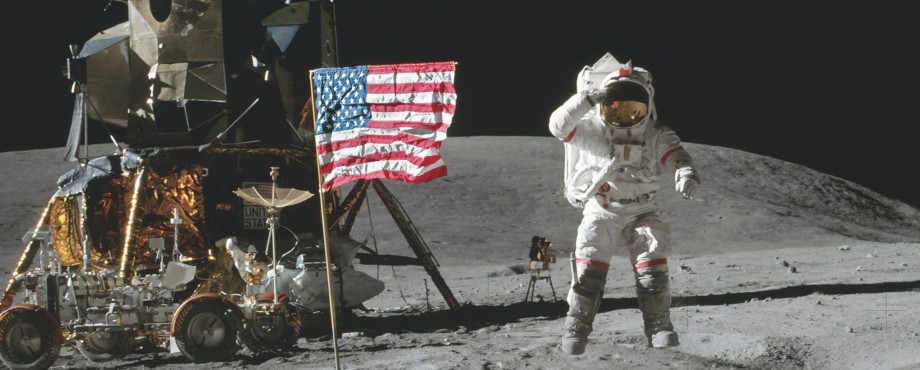
Die aktuelle politische Polarisierung in den USA ist das Ergebnis der gesellschaftlichen Polarisierung – und nicht umgekehrt. Über ein Volk in der Identitätskrise.
Der Sturm von militanten Anhängern des ehemaligen US-Präsidenten Donald Trump auf das Kapitol in Washington, D.C. am 6. Januar 2021 hat die deutsche Wahrnehmung der USA verändert. Der präzedenzlose Vorgang, dass ein Regierungschef, der in seinem Amtseid geschworen hat, die Verfassung der USA zu beschützen, die treuesten seiner Fans dazu aufstachelt, die amtliche Beglaubigung eines regulären Wahlergebnisses gewaltsam zu verhindern, hat für viele Deutsche ein ganz neues Licht auf die amerikanische Demokratie geworfen. Die bizarren Bilder von den vielfach Tarnkleidung, Bärenfellmützen und Captain-America-Kostüme tragenden Kapitolstürmern taten ein Übriges. Bezeichnenderweise bot der deutsche Außenminister Heiko Maas den USA umgehend einen "Marshallplan für Demokratie" an, um das Land wieder auf den rechten Pfad zurückzuführen.
Diese den USA von Deutschland angebotene Demokratiehilfe ist eine bemerkenswerte Umkehr der Verhältnisse in der deutsch-amerikanischen Beziehungsgeschichte seit 1945. Waren es nach dem Zivilisationsbruch des "Dritten Reiches" insbesondere die Amerikaner, die unter Einsatz riesiger personeller und finanzieller Ressourcen (nicht nur des Marshallplans) den Westdeutschen Demokratie beibrachten und deren durch das Grundgesetz konstituierte Ordnung im Systemkonflikt des Kalten Krieges garantierten, so erscheinen die USA vielen Deutschen nun als so etwas wie "der kranke Mann am Potomac", dem der deutsche Arzt zu Hilfe eilen muss, sofern ihm denn überhaupt noch zu helfen ist.
Enttäuschte Liebe
In vieler Hinsicht ist die gegenwärtige Kritik an den USA in Deutschland eine Manifestation erfolgreicher eigener Demokratisierung, doch hat Amerikakritik in Deutschland schon immer etwas mit enttäuschter Amerikaliebe zu tun gehabt. Die USA waren seit dem ausgehenden 18. Jahrhundert stets eine Projektionsfläche für deutsche Träume und Albträume von Freiheit und Demokratie. Deshalb ging es in der deutschen Auseinandersetzung mit den USA meist gar nicht um die USA, sondern um das in Deutschland Gewollte und Nicht-Gewollte. Dass die Realitäten in den USA dabei nur selten deutschen Erwartungen entsprachen, ist dabei weniger ein Problem der Amerikaner als eher eines der Deutschen.
Amerika ist anders – und war es schon immer. Gewiss, die disruptive Präsidentschaft Donald Trumps ist in vieler Hinsicht präzedenzlos. Insbesondere die Ereignisse seit der Präsidentschaftswahl vom 3. November 2020 sind in der US-Geschichte ohne Gleichen: Einen Präsidentschaftskandidaten, der durch Betrugsgerede schon während des Wahlkampfes die Integrität des US-Wahlsystems massiv in Frage stellt; einen Wahlverlierer, der sich weigert, seine offenkundige Niederlage einzugestehen; einen US-Präsidenten, der die gewaltbereiten Teile seiner Wählerschaft von der Kette lässt, um die amtliche Beglaubigung des Wahlergebnisses handgreiflich zu verhindern – all das hat es in der Geschichte der USA noch nicht gegeben.
Und doch ist Trump in vielem auch ein Ergebnis der amerikanischen Demokratie, eine ihrer Entwicklungsmöglichkeiten, und als solche das Symptom ihrer tiefen Krise, die sich in ihrer Konstellation sehr genau beschreiben lässt.
Da ist zunächst der tiefgreifende ökonomische Strukturwandel. Das industrielle Kernland im Gebiet um die Großen Seen wurde im Verlauf einer sich in den 1970/80er Jahren beschleunigten De-Industrialisierung vom Manufacturing Belt zum Rust Belt, in dem stillgelegte Fabriken vor sich hin rosten. Die Verlagerung von Arbeitsplätzen nach China oder – im Zeichen des Nordamerikanischen Freihandelsabkommens von 1993 – auch nach Mexiko sowie die sich um 2000 voll entfaltende Internetwirtschaft, die nur wenige lukrative Jobs für Hochqualifizierte schuf und die weniger gut Qualifizierte massenhaft freisetzte, vernichteten weitere Arbeitsplätze in den USA.
Von der Realität eingeholt
Der ökonomische Strukturwandel ging einher mit der Umverteilung des Wohlstandes von unten nach oben im Zeichen einer in den USA konservativ, in Deutschland aber neoliberal genannten Wirtschafts- und Fiskalpolitik, die durch staatliche Deregulierung und fortlaufende Steuersenkungen die Marktkräfte entfesseln und das wirtschaftliche Wachstum ankurbeln wollte, tatsächlich aber vor allem die Aktienkurse steigen ließ. Die Realeinkommen stagnieren seit den 1980er Jahren, die private Verschuldung hat astronomische Höhen erreicht, und die gigantische Kapitalvernichtung in den Börsen- und Finanzkrisen von 2001/02 (NASDAQ-Crash) und 2007/08 taten ein Übriges.
Das Ergebnis: Selbst gut situierte Amerikaner der Mittelklasse, um von der rasant wachsenden Zahl der Armen gar nicht erst anzufangen, sind tief verunsichert, weil sie insgeheim wissen, dass sie sich ihren Lebensstil eigentlich gar nicht leisten können. Sie haben vielfach Angst, dass es ihren Kindern nicht besser gehen wird als ihnen selbst, und viele ihrer Kinder sehen das genauso. Genau das aber, die Gewissheit, dass es den Kindern einmal besser gehen würde, war so etwas wie der soziale Kitt, der die amerikanische Gesellschaft zusammenhielt.
Der ökonomische Strukturwandel überlagerte sich mit tiefgreifenden sozialen Wandlungsprozessen, durch die die amerikanische Gesellschaft seit den 1960ern immer individualistischer, diverser und pluralistischer geworden ist.
Ein Abbild der Weltgesellschaft
Dieser soziale Wandel ist zum Teil migrationsgefügt. Die Liberalisierung der Einwanderungsgesetzgebung Mitte der 1960er Jahre öffnete nicht nur die Tore der USA für eine bis heute anhaltende massenhafte Einwanderung, die alles Zurückliegende weit, weit übertrifft. Sie führte auch zu einem grundlegenden Wandel in der demographischen Zusammensetzung der Migranten, die seit den 1970er Jahren vorwiegend aus den südlichen Teilen der westlichen Hemisphäre und aus Asien, aber nicht mehr primär aus Europa kommen. Speiste sich die Einwanderung in die USA bis zum Ersten Weltkrieg ganz überwiegend aus den Ländern Europas, und gab es ein starkes europäisches Fundament für die amerikanische Kultur, so ist die US-Gesellschaft inzwischen zu einem Abbild der Weltgesellschaft geworden, in der sich nicht wenige europäisch-amerikanische Bevölkerungsgruppen zunehmend marginalisiert fühlen.
Die Grundrechterevolution der 1960er Jahre trieb die Pluralisierung der US-Gesellschaft auf unerwartete Weise voran. Die von Dr. Martin Luther King, Jr. angeführte afroamerikanische Bürgerrechtsbewegung führte nicht nur zur rechtlichen Gleichstellung der Schwarzen durch die "Civil Rights Acts" von 1964/65. Vielmehr begannen in ihrem Windschatten auch andere bislang marginalisierte Gruppen – die Frauen, die Homosexuellen, die American Indians, die Hispanics und andere – ihr Recht auf Selbstbestimmung einzufordern. Es etablierte sich ein Grundrechtebewusstsein, aus dem heraus immer mehr soziale Gruppen ihr Recht auf "Anders-Sein" einforderten. Die daraus resultierende Vervielfältigung von Lebensstilen ließ die US-Gesellschaft in eine Vielzahl von sozial-moralischen Milieus zerfallen, die bestenfalls mit dem Rücken zueinanderstehen, schlimmstenfalls aber einander in grundsätzlicher Ablehnung zugetan sind. Zusammen mit den anderen hier genannten Krisenfaktoren produzierte die Pluralisierung von Lebensstilen ein weitgreifendes Gefühl der Identitätsungewissheit in der US-Gesellschaft, die sich immer weniger darauf verständigen kann, wer sie ist, wer sie sein will und was sie im Kern zusammenhält.
Die aktuelle politische Polarisierung in den USA ist das Ergebnis der gesellschaftlichen Polarisierung – und nicht umgekehrt. Antworten auf die Frage, warum Trumps rechtsnationalistischer Populismus die Wirkung entfalten konnte, die er entfaltet hat, sind in dieser komplexen Krisenkonstellation zu suchen, die mit der Inauguration von Joe Biden nicht verschwinden wird. Doch anstatt sich im Bewusstsein eigener demokratischer Reinheit empört von den USA abzukehren, sollten die Deutschen genauer hinschauen, weil die USA als Land der Freiheit ein Testlabor für die Herausforderungen von Individualisierung und Diversität sind, vor denen Deutschland auch steht.

Dr. Volker Depkat ist Historiker und Professor für Amerikanistik an der Universität Regensburg. Zu seinen Hauptarbeitsgebieten gehören die Geschichte Nordamerikas in kontinentaler Perspektive, die Geschichte europäisch-amerikanischer Beziehungen seit der Frühen Neuzeit sowie die Geschichte des Föderalismus in Europa und Amerika.







