Salon Möller
Moderne, Merz, Memorial
Gleich drei neue Bücher über Friedrich Merz, ein fantastisches Buch zur Aussöhnung und ein Blick auf Russlands Schicksal.
Wann immer ein neuer Name auf der politischen Bühne auftaucht, dauert es nicht lange und die Verlage werfen die ersten, meist hastig geschriebenen Biografien auf den Markt. Bei Friedrich Merz ist das anders. Ihn scheint man schon lange zu kennen. An ihm schieden sich schon immer die Geister – nicht nur die in seiner eigenen Partei. Er war einer der politischen Untoten in der CDU über die langen MerkelJahre hinweg. Dann kam er zurück und ist Bundeskanzler geworden. In gleich drei neu erschienenen Büchern kann man jetzt nachlesen, wer er ist, wohin er will und warum er das wichtigste politische Amt am Ende doch noch bekommen hat. Vieles davon ist bekannt und manches auch längst zur billigen Münze in der politischen Auseinandersetzung geworden. Weshalb an einer braven Beschreibung seines „Weges zur Macht“, wie sie der Journalist und Kirchenfachmann Volker Resing bei Herder veröffentlicht hat, wohl der geringste Bedarf besteht.
Sehnsucht nach der Vor-Merkel-Zeit
Sehr viel spannender ist dagegen der Versuch zweier anderer Autorinnen, über die Beschäftigung mit der Rolle von Friedrich Merz mehr über den Zustand einer CDU erfahren zu wollen, wie sie Angela Merkel in 16 langen Jahren zugerichtet hat.
Die junge Journalistin Sara Sievert sieht im späten Comeback des Friedrich Merz sogar eine gewisse Unvermeidlichkeit, die allerdings seiner Selbstwahrnehmung und der Autosuggestion seiner Anhänger geschuldet ist und nicht zuletzt dem überwältigenden Wunsch eines guten Teils seiner Partei, in den unversehrten Zustand der Vor-Merkel-Jahre zurückkehren zu können. Spätestens die böse Abstimmungsniederlage bei der Kanzlerwahl hat indessen gezeigt, wie volatil selbst diese Mehrheiten für Merz immer noch sind. Er schwebt mehr denn je in der doppelten Gefahr, seine treuen Unterstützer zu enttäuschen, ohne im Gegenzug die notorischen Kritiker und Skeptiker zu gewinnen.
Mariam Laus publizistische Firewall
Die dritte Autorin, die Zeit-Journalistin und ausgewiesene Unionskennerin Mariam Lau, benennt diese Gefahr sehr genau. Sie hat ihr Buch lapidar Merz genannt und wollte trotzdem keine herkömmliche Biografie schreiben. Im Untertitel verrät sie, worum es ihr wirklich geht, die „Suche nach der verlorenen Mitte“. Die Autorin versucht die künftige Standortbestimmung der Partei mit der politischen Positionierung ihres neuen Spitzenmanns zu verknüpfen und ihn wider alle Vorurteile als den politischen Erben erscheinen zu lassen, der eine veränderte, ideologisch durchlüftete oder besser gesagt: entschlackte Partei mit sich selbst versöhnen kann und darüber die alten Ressentiments fahren lässt, die lange Zeit zu seinem Markenkern gehört haben.
Es ist auffällig, mit welchem Wohlwollen, um nicht zu sagen mit welcher Fairness sich die Autorin Friedrich Merz nähert. Man könnte in Anlehnung an jenen während des Irakkrieges so populär gewordenen Begriff des „embedded journalism“ von einem „einbettenden Journalismus“ sprechen. Lau umhegt den neuen Kanzler wie mit einem politischen Weidezaun. Sie stellt überall dort, wo sie Gefahr für ihn wittert, Warnschilder auf und schreibt ihr Buch als eine Art publizistische Firewall. Das tut man nicht schnell und aus aktuellem Anlass. Auch wenn der Verlag wohl auf den vorgezogenen Erscheinungstermin gedrängt hat. Vielmehr schöpft das Buch aus zahllosen Gesprächen, langen Beobachtungen und einer darüber gewachsenen hohen Vertrautheit mit einem politischen Milieu, in dem sich die Autorin zu Anfang sicher nicht zu Hause gefühlt hat. Man muss ihr daher mit großem Respekt attestieren, dass sie zum publizistischen Echoraum für eine CDU geworden ist, die immer noch auf der Suche nach ihrer neuen politischen Mitte ist. Und die Autorin registriert dabei sehr genau, aus welcher Ecke der Partei die womöglich falschen Ermunterungen kommen, aber auch, wo andererseits die begründete Enttäuschung lauert. Dem als wortbrüchig Gescholtenen attestiert sie eine erstaunliche Resilienz, wie das Modewort heißt, zeigt ihm aber unverhohlen, wo die Abgründe sind, denen er sich immer wieder leichtfertig nähert. Wer die Anfänge dieser womöglich kommenden Ära Merz besser verstehen will, sollte also unbedingt zum Buch von Mariam Lau greifen und großzügig über die eine oder andere Unschärfe hinwegsehen. Die Autorin beweist eine Diskursbereitschaft, die sich wohltuend von den engstirnigen Frontstellungen heutiger Debatten unterscheidet.
Wagners wichtiges Buch zur Aussöhnung
Davon, wie man wieder ins Gespräch miteinander kommen kann, ohne seine eigenen Überzeugungen opfern zu müssen, führt uns exemplarisch das fabelhafte Buch von Thomas Wagner über das Abenteuer der Moderne vor, das eigentlich von der überraschenden Beziehung zweier grundverschiedener Denker der Nachkriegszeit handelt: Arnold Gehlen und Theodor Adorno, die über alle unversöhnlichen Gegensätze hinweg nicht nur intellektuelles Verständnis, sondern auch persönliche Empathie füreinander entwickelten. Dass sich der Philosoph Wolfgang Harich damals als Dritter im Bunde von Ostberlin aus Zugang zu diesem Gesprächsraum verschafft hatte, beweist eine Gesprächsfähigkeit selbst im Anblick der deutschen Spaltung, die wir uns dringend wieder vor Augen führen sollten. Thomas Wagner hat ein eminent wichtiges Buch zur richtigen Zeit geschrieben.
Russland ist nicht gleich Russland
Von der Überzeugung, wieder miteinander sprechen zu müssen, war wohl auch das Manifest der pazifistischen Linken aus dem Umfeld des ErhardEppler-Kreises der SPD getragen, das nach einem Waffenstillstand im Krieg Putins gegen die Ukraine die dringende Wiederaufnahme von Friedensgesprächen mit Russland fordert. Auch da bekommt man schnell das Gefühl, dass einige der politischen Untoten in dieser Partei wiederauferstanden sind. Vielleicht kann diesen Kreis die Lektüre eines Buches über die kurz nach Kriegsbeginn verbotene Erinnerungsstiftung Memorial eines Besseren belehren, dessen Autoren, wie die bekannte Historikerin und Mitbegründerin von Memorial Irina Scherbakowa, eindringlich zeigen, warum Putin nicht nur ein anderes Land überfallen hat, sondern wie so oft in der russischen Geschichte auch Krieg gegen das eigene Volk führt.
Mit wem wollen die Unterzeichner des Friedensmanifests denn wohl reden, wenn nicht mit dem Machthaber im Kreml? Das wird eines nicht mehr so fernen Tages unumgänglich sein. Aber die Unterzeichner sollten sich eine bittere Erkenntnis des im Schweizer Exil lebenden russischen Schriftstellers Michail Schischkin zu eigen machen: das Schicksal der russischen Kultur und Gesellschaft, schreibt er, sei es, immer wieder in zwei Lager gespalten zu sein. Die einen, die im Land bleiben und sich den Verhältnissen fügen würden. Und die anderen, die Freiheit und Selbstbestimmung in der Fremde suchten. Auch das ist ein Teil der russischen Gesellschaft. Mit diesem hätte man in den vergangenen Jahren immer schon reden können, hätte man Russland nicht fortwährend mit den Machthabern im Kreml verwechselt.
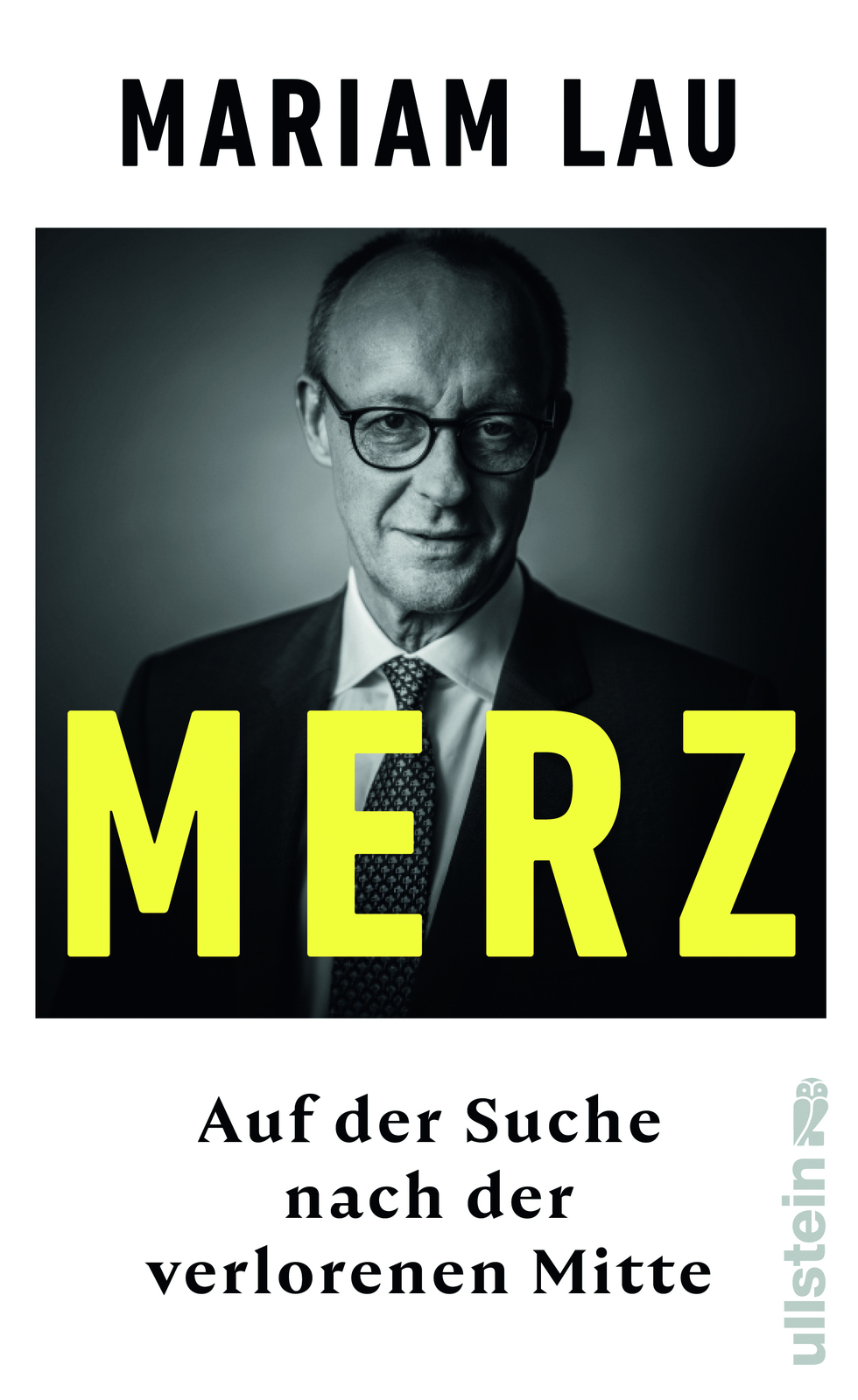
Mariam Lau
Merz. Auf der Suche nach der verlorenen Mitte
Ullstein Verlag, Berlin 2025,
334 Seiten, 24,99 Euro
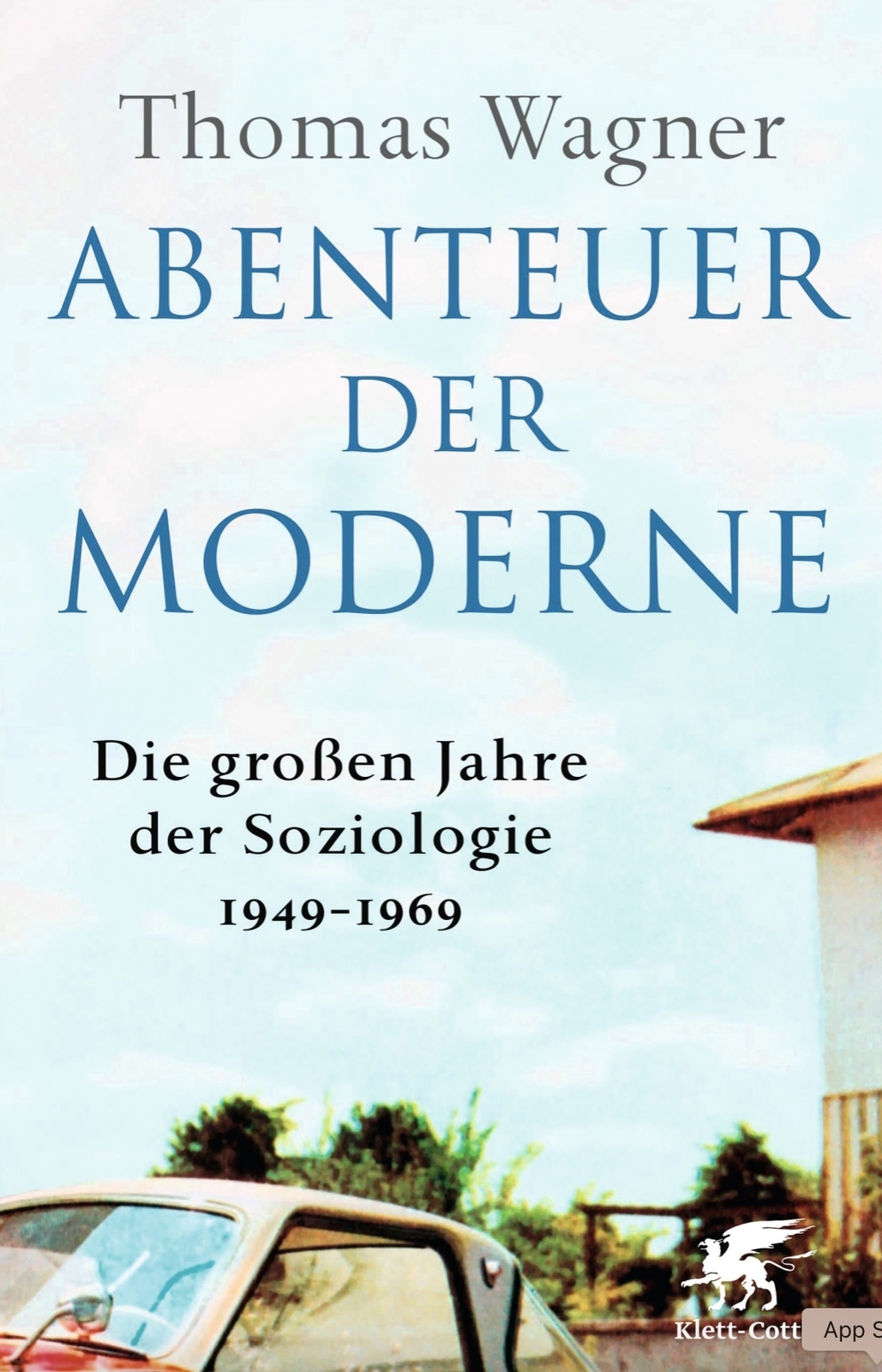
Thomas Wagner
Abenteuer der Moderne. Die großen Jahre der Soziologie 1949–1969
Klett-Cotta Verlag, Berlin 2025,
336 Seiten, 28 Euro

Irina Scherbakowa, Filipp Dzyadko, Elena Zhemkova
Memorial. Erinnern ist Widerstand
C. H. Beck Verlag, München 2025,
192 Seiten, 25 Euro

© Antje Berghäuser rotarymagazin.de
Weitere Artikel des Autors
11/2025
Raus aus der Komfortzone!
Wundt neu entdeckt
9/2025
Weimarer Malerschule
8/2025
Die Bronzen von San Casciano
5/2025
Chemnitz neu entdecken
4/2025
Vaterfigur des modernen Japan
4/2025
Wien verneigt sich
3/2025
Thoma neu entdecken
2/2025
Urbane Revolution
1/2025
Das Heilige sehen
Mehr zum Autor







