Salon Möller
Urbane Revolution

Die mittelalterliche Gründerzeit um 1200 schuf die neue Lebensform der Stadt. Ein neues, lesenswertes Buch erzählt jetzt von dieser spannenden Epoche.
Süffig geschriebene, aber sehr wohl dem Stand der wissenschaftlichen Forschung entsprechende Bücher zur deutschen Geschichte sind lange Zeit eine Domäne der englischsprachigen Historiker gewesen. Das berühmte Buch von Christopher Clark über den Ausbruch des Ersten Weltkriegs hat es sogar bis in unseren alltäglichen Sprachgebrauch geschafft. Von politischen Schlafwandlern reden wir inzwischen fast alle. Aber nicht nur die deutsche Zeit- und Kriegsgeschichte war das bevorzugte Thema dieser Autoren, auch Standardwerke über das Heilige Römische Reich oder die Habsburgermonarchie gehören mittlerweile dazu. Und vor wenigen Monaten erst hat die in Oxford lehrende australische Historikerin Lyndal Roper ihr Buch über den deutschen Bauernkrieg veröffentlicht.
Die ihrer menschenleeren Strukturgeschichte verhafteten deutschen Historiker haben lange gebraucht, bis sie ihre Scheu vor erzählenden, sich an ein größeres, interessiertes Publikum wendenden Geschichtsdarstellungen verloren haben. Einer, der diese Distanz nie hatte, ist der renommierte Berliner Archäologe und Museumsdirektor Matthias Wemhoff, der bei allem, was mit Graben und Buddeln zu tun hat, inzwischen ein international gesuchter Gesprächspartner geworden ist.
Eine Zeit des Aufbruchs
Wemhoff hat sich jetzt mit der preisgekrönten Fernsehautorin Gisela Graichen zusammengetan, die sich als äußerst erfolgreiche Filmemacherin kulturhistorischer Dokumentationen ebenfalls einen Namen gemacht hat. Und von diesem Dreamteam der gelehrten Unterhaltung ist jetzt ein Buch über das goldene Jahrhundert des Mittelalters erschienen, das sich mit jener spannenden Zeit um 1200 befasst, als die Menschen von großer Neugier ergriffen waren und sowohl das deutlich wärmere Klima als auch eine Vielzahl von technischen Neuerungen ihren Alltag bestimmten. Von einer regelrechten Gründerzeit sprechen daher die Autoren, und der Vergleich mit der eigentlichen Gründerzeit des 19. Jahrhunderts ist bewusst gewählt. Mit den Wind- und Wassermühlen entstanden neue Energiequellen; mit den Koggen kam ein neuer Schiffstyp auf die Meere; das Kummet ermöglichte den Einsatz der Pferde in der Landwirtschaft; und mit Brille, Kompass oder Räderuhr bestimmte eine zuvor nie da gewesene Genauigkeit das tägliche Leben. Man könnte diese Liste noch weiterschreiben. Sie widerspricht dem lange vorherrschenden Bild des Mittelalters als einer dunklen Epoche.
Das wäre freilich noch kein hinreichender Grund gewesen, ein solches Buch zu schreiben. Denn vieles davon ist inzwischen bekannt und prägt unser heutiges Bild jener erstaunlichen Aufbruchsperiode, die erst den Seuchenzügen des Spätmittelalters und der damals einsetzenden Klimaverschlechterung wieder zum Opfer fiel. Im Zentrum dieser damaligen Gründerzeit steht für die Autoren jedoch die Entstehung einer spätmittelalterlichen Städtelandschaft, an der sich nicht mehr sehr viel geändert hat und die unser urbanes Leben bis heute prägt. Denn ein Großteil jener Städte, in denen wir heute leben, ist zur damaligen Zeit entstanden; oder besser gesagt: sie wurden damals zielstrebig gegründet, weshalb die eigentliche Fragestellung dieses Buches auch im Untertitel steht: „Wie das Mittelalter unsere Städte erfand“. Die Zähringerstadt Freiburg, um nur ein bekanntes Beispiel zu nennen, ist dafür mustergültig gewesen. Sie soll hier für eine Vielzahl vergleichbarer Gründungen stehen.
Keimzelle für Fortschritt
Aber genau mit der Fokussierung auf diesen Urbanisierungsprozess beginnen die Probleme des Buches, das sich über weite Strecken eben nicht entscheiden kann, ob es die Geschichte der neuzeitlichen Stadt, das Porträt einer Aufbruchsperiode oder eine Art Zivilisations- und Technikgeschichte erzählen will. Der Leser muss schon bereit sein, zwischen der Erfindung der Brille, der kommerziellen Revolution der Städtehanse oder der Rolle der Hübschlerinnen beim Sex in the City hin und her zu springen, um dem Buch das Versprechen eines Jahrhundertporträts abzunehmen.
So beginnt das eigentliche Thema der sich explosionsartig verbreitenden Städtegründungen im Buch so richtig erst nach 150 Seiten mit den konkreten Beispielen, die zeigen, wie schnell die feudalen Gründer gelernt haben, dass solche rechtlich und fortifikatorisch geschützten Siedlungsformen zur eigentlichen Keimzelle für Handel und Wandel, für Fortschritt und Einfluss ihrer Herrschaftsgebiete geworden sind. Die Stadtmauer wird fortan zur demonstrativen Grenzlinie zwischen einem freien, städtischen Leben und der alten, an die Scholle gebundenen Hörigkeit. Diese neuen Städte waren in der Regel eben nicht aus wilder Wurzel entstanden, sondern waren das Ergebnis sorgfältiger Planungen und zielgerichteten Vorgehens. Es hätte zum Verständnis dieses Vorgangs deshalb auch nicht geschadet, wenn die Autoren jene heftige Debatte über mittelalterliche Stadtplanung wenigstes erwähnt hätten, die von den Untersuchungen der Stuttgarter Architekturhistoriker Klaus Humpert und Martin Schenk ausgingen, die damals schon das Ende vom Mythos der gewachsenen Stadt apostrophierten. Auch wenn sie heftigen Widerspruch erfahren haben.
Es hätte dem Buch wohl auch besser getan, sich weniger mit der Freilegung alter Parzellengrenzen oder Straßenverläufe zu beschäftigen als mit der grundsätzlichen Frage, warum jenes 13. Jahrhundert zu einem solchen Erfindungsreichtum fähig war und inwieweit man dafür den modernen Begriff der Innovation verwenden darf, der in der Mediävistik lange Zeit kaum eine Rolle spielte.
Nationenbildung als Zeichen von Innovation
Denn nicht nur die neuen urbanen Zentren wurden zu Keimzellen einer neuen Rationalität und Lebensführung; auch die Klöster und Universitäten trugen entscheidend zum Fortschritt dieser neuen Epoche bei. Und manches, was uns heute rückwärtsgerichtet erscheint, war zu jener Zeit ausgesprochen modern. Weshalb es auch wenig Sinn hat, den Weichzeichner unseres modernen Europaverständnisses über dieses weit zurückliegende Jahrhundert zu legen. Denn gerade die frühe Nationenbildung war auch ein Zeichen für Innovation.
Trotzdem ist das Buch dieses Autorenduos zu einem großen Lesevergnügen geworden, das immer wieder staunen lässt, was zu jener fernen Zeit alles erfunden, gedacht und gebaut wurde. Die Epoche um 1200 erscheint uns plötzlich sehr nah, auch wenn uns selbstredend lange Jahrhunderte von ihr trennen.
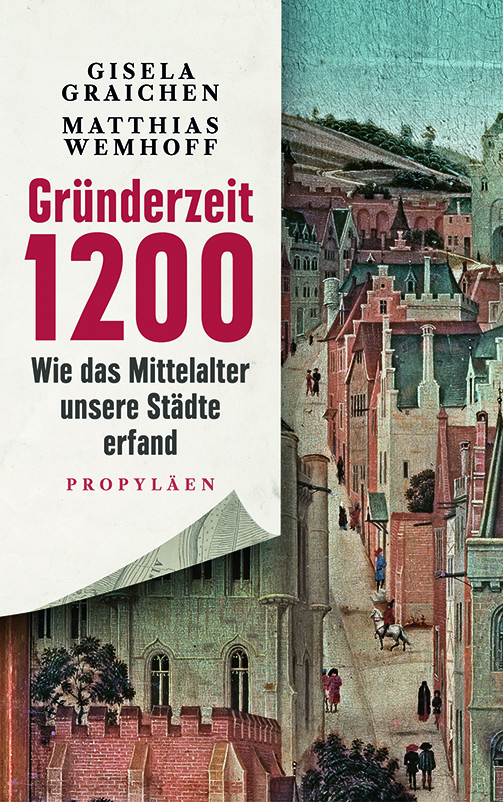
Gisela Graichen und Matthias Wemhoff
Gründerzeit 1200. Wie das Mittelalter unsere Städte erfand
Propyläen Verlag 2024,
457 Seiten, 29 Euro

© Antje Berghäuser rotarymagazin.de
Weitere Artikel des Autors
Wundt neu entdeckt
9/2025
Weimarer Malerschule
8/2025
Die Bronzen von San Casciano
7/2025
Moderne, Merz, Memorial
5/2025
Chemnitz neu entdecken
4/2025
Vaterfigur des modernen Japan
4/2025
Wien verneigt sich
3/2025
Thoma neu entdecken
1/2025
Das Heilige sehen
12/2024
Ein Buch für die Ewigkeit
Mehr zum Autor







