Forum
Die Bronzen von San Casciano

Im zähen Schlamm eines antiken Thermalbades in der Toskana wurden vor drei Jahren ungewöhnlich gut erhaltene etruskische Bronzen gefunden. Sie sind jetzt in Berlin zu bestaunen.
Gut ein halbes Jahrhundert ist es inzwischen her, dass ein Hobbytaucher vor der Küste Kalabriens in zehn Meter Meerestiefe einen außergewöhnlichen Fund machte. Lebensgroße Bronzestatuen, die in einem erstaunlich guten Erhaltungszustand verstreut auf dem Grund des Ionischen Meeres lagen. Es waren, wie sich bald herausstellte, griechische Plastiken aus dem 5. vorchristlichen Jahrhundert, der Blütezeit der antiken Bildhauerkunst eines Phidias also, von der überhaupt nur wenige Zeugnisse bis in unsere Gegenwart erhalten blieben. Als die berühmten Bronzen von Riace kann man diese Fundstücke heute im Museum von Reggio Calabria bewundern, wo sie zum Anziehungspunkt für kunstbegeisterte Menschen aus aller Welt geworden sind und zum Weltkulturerbe zählen.

Fünf Jahrzehnte später sollte sich eine solche Sensation wiederholen. Unweit von Florenz, in San Casciano dei Bagni, einem kleinen Ort in der Provinz Siena, der seit alters für seine Heilquellen berühmt war, stießen Archäo-logen unerwartet auf einen einzigartigen Schatz etruskischer und römischer Bronzefiguren. Sie hatten im zähen Schlamm eines antiken Thermalheiligtums auf wundersame Weise überdauert und stellen den bisher wohl größten Fund solcher Kunstwerke dar, die jemals auf italienischem Boden gefunden wurden. 15 von ihnen sind jetzt das erste und für lange Zeit wohl letzte Mal außerhalb Italiens in der James-Simon-Galerie auf der Berliner Museumsinsel zu sehen, bevor sie in einem eigens für sie errichteten Museum in San Casciano dei Bagni ihre endgültige Heimstatt finden werden. Dazu kommen mehr als 100 kleinere Leihgaben aus diesem Grabungsfund, die von passenden Objekten aus den reichen Beständen der Berliner Antikensammlung ergänzt und kontrastiert werden; etruskische Kopfvotive beispielsweise, griechische Terrakotten oder ein antiker Spiegel aus Chiusi. Diese Museumsobjekte zeigen das frühe Interesse an etruskischer Kunst nicht zuletzt in Berlin, wo im Zuge der deutschen Antikenbegeisterung schon 1844 ein eigenes "Etruskisches Cabinett" im Alten Museum eingerichtet wurde.

Die Arbeiten zeugen von der hohen Kunstfertigkeit der Etrusker, jenes immer noch etwas rätselhaften Volkes, das einst in der Mitte Italiens auf dem Gebiet der heutigen Toskana siedelte und dann lautlos in der römischen Welt unterging. Aber sie geben auch Einblick in das Alltagsleben und die Glaubensvorstellungen jener Zeit, die sich im Übergang befand zu der immer mächtiger werdenden römischen Expansion. Und sie zeigen auf ungewöhnlich realistische Weise das Leiden der Kranken und Siechen, die seit alters Heilung in den Thermalquellen von San Casciano suchten; jener Lucius Marcius Grabillo etwa, dessen verkrüppelter Leib zu den ungewöhnlichsten Ausstellungsstücken zählt und seinen Namen eingraviert trägt.
Von den Bronzen von Riace hieß es bald, wer sie nicht gesehen habe, der habe Italien nicht gesehen. Das wird man in Zukunft auch von den Bronzen von San Casciano dei Bagni sagen können. Bis zum 12. Oktober in der James-Simon-Galerie auf der Museumsinsel. Für kunstsinnige Berlin-Besucher ein Muss.
"Biografie der Republik"
Wechseln wir von der Kulturgeschichte Italiens zur Zeitgeschichte Österreichs, eines Landes, von dem der Wiener Kabarettist Helmut Qualtinger einmal sagte, es sei "ein Labyrinth, in dem sich jeder auskennt". Der Nestor der österreichischen Zeitgeschichtsschreibung, der Wiener Historiker Oliver Rathkolb, hat sich dieses Bonmot zu eigen gemacht und es seinem Buch über "Die paradoxe Republik Österreich" vorangestellt. Die erste Ausgabe ist bereits vor 20 Jahren erschienen und längst zu einem Standardwerk geworden, zu der "Biografie der Republik", wie Ernst Schmiederer in der Hamburger Zeit damals anerkennend schrieb. Man könnte stattdessen sicher auch das leicht lesbare Begleitbuch der Dokumentationsreihe des ORF zur Hand nehmen und sich durch die Geschichte Österreichs blättern (Molden Verlag) oder auf Györgi Dalos' Nachkriegsgeschichte der Alpenrepublik warten, die Ende August unter dem etwas verquälten Titel "Neutralität und Kaiserschmarrn" erscheinen wird (C. H. Beck Verlag). Aber an Rathkolbs analytischem und detailgenauem Buch kommt man schließlich doch nicht vorbei. Der Autor hat es jetzt noch einmal aktualisiert und um die letzten Jahre der Entwicklung seines Landes ergänzt, einer Ära, die von Skandalen, Affären und einem besorgniserregenden Populismus erschüttert wurde. Wer sich die Mühe macht, den zehn Längsschnitten zu folgen, mit denen Rathkolb die Nachkriegsgeschichte Österreichs seziert, begreift schnell, aus welchen historischen Umständen sich auch die jüngsten politischen Verwerfungen erklären lassen.
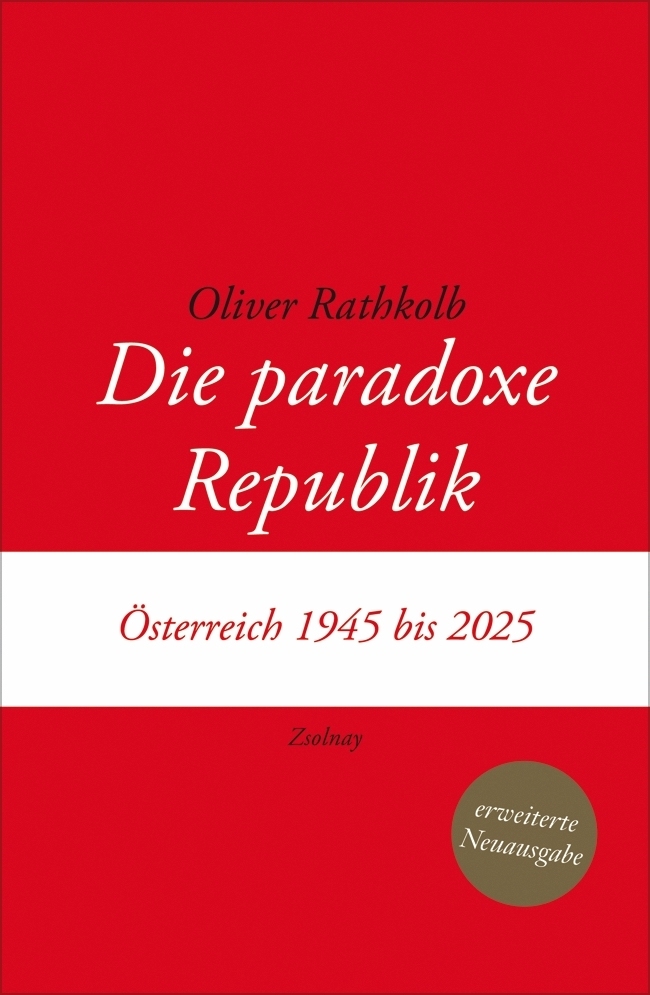
Erst nach dieser Lektüre erschließt sich die ganze Bitterkeit, die in Qualtingers Motto versteckt ist. Denn natürlich war dieses Nachkriegsösterreich keineswegs jene Mozartkugelidylle, als die man sich selbst zu vermarkten suchte. Der Außenstehende glaubt, dieses so harmlos schöne Land zu kennen, das seine imperiale Vergangenheit abgestreift hat. Aber das ist im heiteren wie im tragischen Sinne ein gewaltiger Irrtum. Und Rathkolb erklärt auch, warum. Auf mehr als 500 Seiten hadert er immer wieder mit der Grundverweigerung Österreichs, sich seiner Verantwortung für die eigene Vergangenheit zu stellen, was den Österreichern im Vergleich zu den deutschen Nachbarn schon deshalb leichter gelang, weil sie sich immer auch als erstes Opfer der deutschen Schreckensherrschaft gerieren konnten. Es hat lange gedauert, bis eine jüngere Generation dieses kollektive Verschweigen durchbrach.
Rathkolb erfuhr in den Kanzlerjahren Bruno Kreiskys seine politische Prägung, für den er deshalb besonders warme Worte findet; und er schaut mit dem skeptischen Blick jener Generation, in der Österreichs Politik eine neue Dignität und Haltung bekam, auf die jüngsten Verwerfungen. Ihm muss das wie eine hässliche Selbstverzwergung seines Landes erscheinen. Er nennt das Verschweizerung. Und er wittert den politischen Revisionismus selbst in so bahnbrechenden Büchern wie Christopher Clarks "Schlafwandler", das er offenbar für eine neuerliche Bestätigung der österreichischen Grundüberzeugung hält, dass, wenn alle ein bisschen Schuld an der Urkatastrophe des 20. Jahrhunderts hatten, es doch keiner wirklich gewesen sein kann.
Man nimmt Rathkolb diese historische Melancholie nicht übel. Da schreibt einer ex post mit dem Blick seiner eigenen Zeit. Und erweist sich dabei als Repräsentant einer liberalen Historikergeneration, die ihre wissenschaftliche Genauigkeit niemals für ihre politischen Überzeugungen geopfert hätte. Ein Buch also, aus dem man mehr lernen kann, als nur Österreichs Ringen mit dem eigenen Bedeutungsverlust.

© Antje Berghäuser rotarymagazin.de
Weitere Artikel des Autors
11/2025
Raus aus der Komfortzone!
Wundt neu entdeckt
9/2025
Weimarer Malerschule
7/2025
Moderne, Merz, Memorial
5/2025
Chemnitz neu entdecken
4/2025
Vaterfigur des modernen Japan
4/2025
Wien verneigt sich
3/2025
Thoma neu entdecken
2/2025
Urbane Revolution
1/2025
Das Heilige sehen
Mehr zum Autor





