Titelthema
Die Diktatur des Eichstrichs
Über die Kultur des Situativen: Was wir an den Italienern lieben und nicht lieben, steht in einer komplementären Beziehung.
An einer Theke in Hamburg, ich bestelle eine Grappa. Der Kellner hält das Glas gegen das Licht (ja, es ist sauber!), stellt es auf den Tresen, beugt sich darüber, schenkt vorsichtig ein. Bis zum Eichstrich, zwei Zentiliter. Manchmal bin ich mutig und sage: Noch ein bisschen mehr? – Also einen doppelten?! – Nein, danke, ist schon in Ordnung!
An einer Theke in Neapel, ich bestelle eine Grappa. Der Kellner stellt das Glas vor mich hin, holt die Flasche, schwenkt sie mit großer Gebärde, schenkt ein. Mal mehr, mal weniger. Und manchmal sage ich: Danke, es reicht, basta, basta, per favore. Wer, wie ich, seit vielen Jahren in beiden Ländern lebt und arbeitet, sieht mit einer Art von doppeltem Blick: mit deutschen Augen in Italien, mit italienischen Augen in Deutschland. Und es sind nicht zuletzt die kleinen Beobachtungen des Alltags, die Unterschiede offenbaren und zu Vergleichen reizen. Ich weiß, dass ich mich damit auf Glatteis begebe. Aber die Tatsache, dass es auf Digestif-Gläsern in Süditalien keinen Eichstrich gibt, lädt dazu ein.
Wir im Norden leben in egeld, süden, süditalien, iner Kultur des Messens und Wägens, der klaren Grenzen und Definitionen, der Kultur des Eichstrichs. Der Eichstrich symbolisiert nicht nur den Mythos sozialer Gerechtigkeit (jedem die gleiche Menge!), sondern auch die Grenzmarke der Mäßigkeit (nicht übertreiben, bitte!). Mit der Kultur des Eichstrichs ist der Norden Europas auch wirtschaftlich das geworden, was er ist, erfolgreich, das Zugpferd des Kapitalismus. Was der europäische Süden dem entgegenzusetzen hat, könnte man als die Kultur des Situativen bezeichnen. Wie viel oder wie wenig der Kellner einschenkt, hat etwas mit seiner Stimmung zu tun, mit der Tageszeit, dem Wetter, dem Gast. Und mit einigem anderen.
Karl Marx definiert Geld als das allgemeine Äquivalent, in dem sich der uniformierende Charakter der Ware spiegele. In der Kultur des Situativen wird diese These täglich zuschanden. Wenn ich in „meinem“ kleinen Ort in Süditalien einkaufe, im Restaurant esse oder eine Dienstleistung in Anspruch nehme, weiß ich häufig zu Beginn des Geschäfts nicht genau, was ich am Ende dafür bezahlen werde. Denn – und auch dies ist einer der vielen kleinen Unterschiede – hier gibt es in den Auslagen keine Preisschilder und auch sonst häufig keinen Prezzo fisso, keinen „festen Preis“. Sofern man mich kennt, zahle ich in der Regel weniger als einer der auswärtigen Bustouristen, die tagsüber in den auch unter Fremden beliebten Ort kommen. Manchmal beeinflusst auch ein schönes Gespräch den Preis zu meinen Gunsten, eine gute Geschichte oder ein kleines Mitbringsel. Manchmal klappt es auch nicht. Und manchmal werde ich kräftig übers Ohr gehauen. Mit anderen Worten: Der Wert der Ware bemisst sich hier nicht ausschließlich (wie bei Marx) nach dem in die Ware investierten Mehrwert, sondern auch nach den in den Kaufakt investierten zwischenmenschlichen Beziehungen. Das macht die Kultur des Situativen zugleich zu einer Kultur der Kommunikation.
Die Regeln des Situativen
Auch andere Bereiche des öffentlichen Lebens funktionieren auf diese Weise, der Straßenverkehr zum Beispiel. Wer zum ersten Mal in Neapel zu Fuß oder gar mit dem Auto unterwegs ist, könnte leicht meinen, hier herrsche das totale Chaos. Das Gegenteil ist der Fall. Chaos ist Unordnung und Willkür, in Neapel herrschen hingegen die Regeln des situativen Arrangements. Und sie funktionieren gut. Würde man, wie in Deutschland, den Vorschriften der Straßenverkehrsordnung bedingungslos folgen, käme der Verkehr bald zum Erliegen, würde tatsächlich das blanke Chaos ausbrechen. Stattdessen verständigt man sich (auch hier geht es um Kommunikation) mit Zeichen und Gesten, die auch der Fremde nach einiger Zeit lernt. Natürlich hat der Kreisverkehr „eigentlich“ Vorfahrt, aber wer sich einfädeln möchte, darf nicht einfach warten, bis der überfüllte Kreisel frei ist, er muss sich hineinschieben, Meter um Meter, gegen die Straßenverkehrsordnung. Das Gleiche gilt bei Vorfahrt rechts vor links. Entschieden wird aus der Situation – und es muss dabei durchaus nicht immer sehr sanft, es kann mitunter auch recht rabiat zugehen.
Oder der Zebrastreifen. Im Norden markiert er die institutionalisierte Rücksichtnahme auf den Fußgänger. Jeder Autofahrer bremst, sobald sich ihm ein Fußgänger auch nur nähert. Anders im Süden. Der Fußgänger muss deutlich zu erkennen geben, dass er den Zebrastreifen passieren will. Dafür kann er aber auch sonst fast überall und ohne jeden Zebrastreifen eine viel befahrene Straße überqueren, sofern er das mit einem Handzeichen deutlich macht. In Deutschland müsste er in einem solchen Fall mit einem Hupkonzert rechnen.
Das alles klingt vielleicht parteilicher, als es eigentlich gemeint ist. Es spricht vieles für feste Regeln. Sie machen das Leben zumindest einfacher als die Kultur des Situativen, die bereits das Überqueren einer Straße zu einem Abenteuer machen kann, das alle Sinne fordert. Und wer längere Zeit im Süden lebt, es dort mit der Bürokratie zu tun hat, mit Verabredungen und Arbeitsterminen, beginnt bald mit der Kultur des Eichstrichs zu liebäugeln.
Denn auch die Kultur des Situativen ist zutiefst ambivalent. Touristen, die aus Italien zurückkommen, berichten zu Hause gern von kleinen, augenzwinkernd gewährten Gefälligkeiten, Preisnachlässen, Sonderkonditionen, schwärmen von der „leichten, lockeren Lebensart“ im Süden, wo man die Dinge eben nicht so genau nehme wie im Norden. Spätestens dann allerdings, wenn der italienische Taxifahrer einen Riesenumweg fährt, der Bootsausflug doppelt so teuer wird oder die Rechnung im Restaurant „nicht stimmt“, schlägt die Stimmung um. Dann sind die Italiener eben wieder die alten Gauner und Betrüger, Schlitzohren und Schnorrer. Es ist das Muster, das den Blick der Deutschen auf ihr Lieblingsland im Süden und seine Bewohner seit Jahrhunderten prägt, die Dialektik von Sehnsucht und Abwehr. Auch Goethe hat ja zwei Italienbücher geschrieben, neben der klassischen „Italienischen Reise“ auch die bitteren „Venezianischen Epigramme“, die kein Anti-Italien-Klischee auslassen. Hatte er in der Italienischen Reise noch notiert, wir beurteilten „die südlichen Völker [...] aus unserem Gesichtspunkte zu streng“, so heißt es in den Venezianischen Epigrammen über Italien: „Deutsche Redlichkeit suchst du in allen Winkeln vergebens / Leben und Weben ist hier, aber nicht Ordnung und Zucht.“
Den Süden nicht verurteilen
Schlimm wird es in den regelmäßig wiederkehrenden politischen und wirtschaftlichen Krisenzeiten. Sehr schnell gewinnen dann die alten Aversionen gegen die Südländer öffentlich an Boden, wird zu Unzuverlässigkeit, was sonst gern Ungezwungenheit heißt. Es wäre Zeit zu begreifen, dass das, was wir an den Italienern lieben, zu dem, was wir an ihnen nicht lieben, in einer komplementären Beziehung steht. Und zu wünschen, dass wir in einem vielfarbig vereinten Europa die Kultur des Eichstrichs weniger rigoros und aggressiv gegen Menschen und Zustände im Süden in Anschlag brächten. Wo kämen wir denn hin ohne die Italiener – „wir armen Nordländer“, um noch einmal den „ersten“ Goethe zu zitieren?
Buchtipp
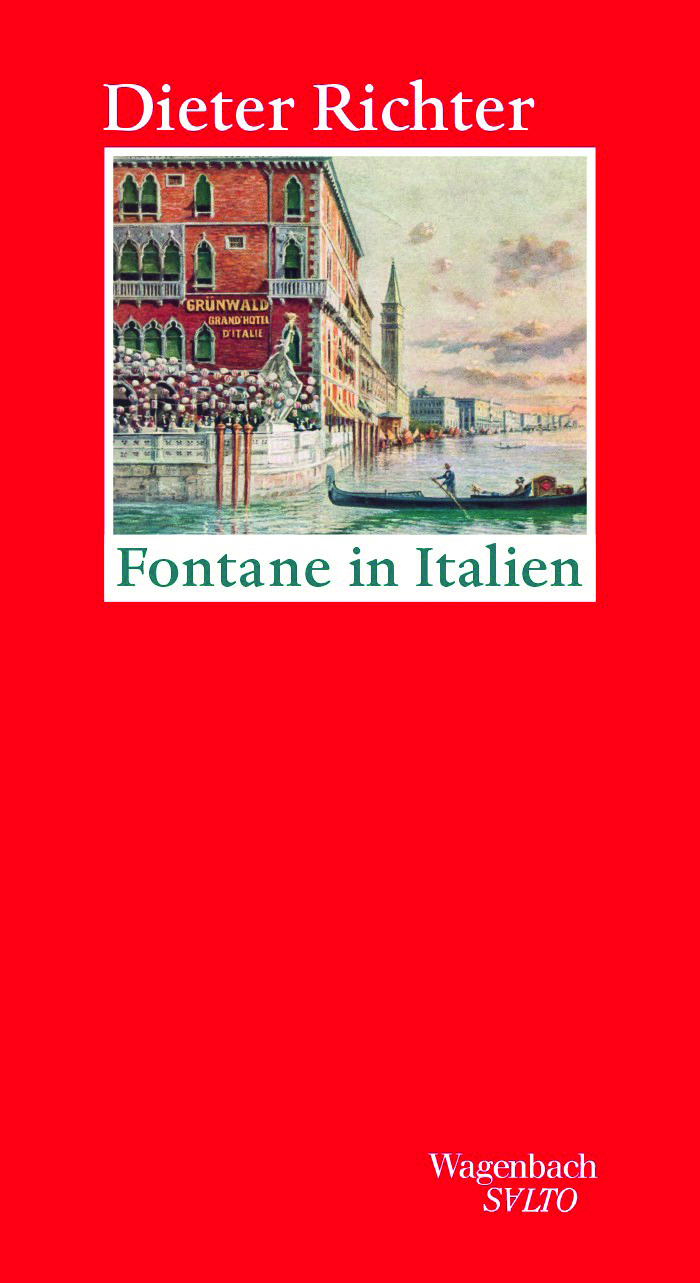
Dieter Richter
Fontane in Italien, Wagenbach 2019,
144 Seiten, 18 Euro

Dieter Richter wurde 1938 in Hof/Bayern geboren, studierte Germanistik, Altphilologie und Theologie. Von 1972 bis 2004 lehrte er als Professor für Kritische Literaturgeschichte an der Universität Bremen. Er ist Verfasser zahlreicher kulturwissenschaftlicher Bücher.
Weitere Artikel des Autors
7/2022
Seeseiten: Das Meer in der Literatur
Mittelmeer, Mittlermeer
Mehr zum Autor







