Titelthema
Italien ist ein Pendlerzug
Im dreifachen Sinn sind die Pendlerzüge eine italienische Metapher – im Hinblick auf die soziale Schichtung, die ökonomische Geografie und die kulturelle Bindung.
Die meisten Regionalbahnen verlassen „Venezia Santa Lucia“, den Hauptbahnhof Venedigs, von den Bahnsteigen auf der linken Seite der Gleisanlage, vom Eingang aus betrachtet. Dort, weitab von den Hochgeschwindigkeitszügen, die Venedig mit Mailand oder Rom verbinden, stehen die grünen Waggons der „Trenitalia“, in denen man nach Conegliano, nach Mira oder nach Rovigo fahren kann. Eine doppelte Tür öffnet sich rumpelnd, wenn man auf den Knopf an der Außenseite des Zuges drückt. Es gibt oft nur eine, nämlich die zweite Klasse, die Einrichtung in Stahl und Kunststoff ist manchmal lädiert, aber kaum zu zerstören, sodass sie drei oder dreißig Jahre alt sein könnte, ohne dass sich der Unterschied erkennen ließe, und in der Luft hängt manchmal ein unbestimmt saurer Geruch. Die Fahrt kostet fast nichts, das Publikum ist zahlreich und gemischt, und der Schaffner zieht die Brauen zusammen, wenn man die Fahrkarte nicht an einem kleinen Automaten, der beim Gleisanfang an einer Säule hängt, vorab entwertet hat.
So oft der Hund das Bein hebt
Über einen Zug, der an jeder nur möglichen Haltestelle Station macht, heißt es in der italienischen Umgangssprache, er halte „ogni pipi di cane“, so oft, wie der Hund das Bein hebt. Es dauert eine Weile, bis der Zug die Werften und Raffinerien von Marghera, die Hotels von Mestre, Wohnblocks in großen Mengen sowie ein paar alte Villen hinter sich gelassen hat. Dahinter aber liegt kein offenes Land, sondern ein diffuses Gelände, in dem sich Einfamilienhäuser mit Maisfeldern, Autowerkstätten mit Brachflächen, Sportplätze mit Gemüsegärten und Fabrikhallen abwechseln und dazwischen ein paar Reihen Wein gepflanzt sind. Alle paar Kilometer folgen ein Dorf oder eine kleine Stadt, und ein schlanker Kirchturm ragt aus einem oft pittoresken Zentrum in die Höhe, und so ginge es stundenlang fort, wenn man nicht irgendwo ausstiege, in Castelfranco Veneto zum Beispiel, der Stadt, in der im Jahr 1478 der Maler Giorgione geboren wurde. Dort steht, neben dem Dom, ein Museum, das ihm gewidmet ist, und auch wenn er in diesem schmucken mittelalterlichen Bau nie lebte, und auch wenn ihm das Fresko in der Halle wohl zu Unrecht zugeschrieben wird, so erscheint es doch angemessen, dass der jung verstorbene Künstler hier und heute ein Zuhause hat.
In weiten Teilen bildet die große Ebene zwischen Verona und Bologna, zwischen Piacenza, Padua und darüber hinaus ein Gelände mit gemischter Nutzung. Gründe dafür gibt es viele: eine Wirtschaftspolitik zum Beispiel, die das Ansiedeln neuer Unternehmen erleichtert, aber nicht für das Abräumen der alten sorgt, ferner die Kleinteiligkeit, mit der in Italien nach wie vor produziert wird, aber auch die enge Bindung vieler Italiener an die Familie sowie an die Kommune, in der man groß wurde. Man stelle sich, bei Einbruch der Abenddämmerung, das „Caffè Centrale“ mit seiner Prominentenwirtschaft im Rücken, auf den kleinen Platz vor dem Dom von Asolo, ein wenig nördlich von Castelfranco Veneto auf einem der ersten Hügel vor den Dolomiten gelegen: Die unzähligen Lichter, die dann in der Ebene aufleuchten, ohne dass es dazwischen größere dunkle Flecken gäbe, über Dutzende von Kilometern hinweg, sind Folge einer intensiv betriebenen Ökonomie der Immobilie, die den Unterschied von Stadt und Land verschwinden ließ, auch wenn die (selbstverständlich angestrahlten) Kirchtürme noch immer für die Orientierung sorgen. „Campanili“ nennt man diese Türme auf Italienisch (nach den „campane“, den Glocken), und sie sind das Symbol des „campanilismo“, einer Sozialordnung, in der jeder zuerst an sich und an sein Dorf denkt.
Zuerst kommt die Familie
Solange der Wohlstand wuchs, also bis in die Neunzigerjahre hinein, expandierte man dort auf dem eigenen Besitz, kaufte womöglich noch hinzu. Danach, als die wirtschaftlichen Verhältnisse schwierig und schwieriger wurden, hielt man an den Immobilien fest, in der begründeten Annahme, dass man sich auf Staat und Gesellschaft nicht verlassen sollte. Ein Soziologe würde sagen, in Italien sei die soziale Mobilität gering, sowohl in Hinsicht auf die gesellschaftlichen Hierarchien als auch mit Blick auf die geografische Herkunft. Durch die Verpflichtung auf den Wohnbesitz werde die soziale Unbeweglichkeit darüber hinaus verstärkt. So kommt es, dass die meisten Menschen dort bleiben, wo auch schon ihre Eltern und Großeltern lebten. So kommt es, dass die Alten seltener einsam werden, wodurch das Risiko steigt, dass sie sich mit dem Coronavirus infizieren. So kommt es aber auch, dass so viele Menschen in den grünen Zügen unterwegs sind. Denn es fügt sich ja immer häufiger so, dass die Schule, der Arbeitsplatz oder die Universität weit vom Wohnort entfernt sind.
Einer der Züge, die „Venezia Santa Lucia“ verlassen, fährt nach Pordenone, einer Kleinstadt im Nordosten Venedigs, die schon im Friaul liegt. Der Zug hält auf dieser Strecke an ungefähr zwanzig Bahnhöfen, er überquert ein Dutzend Flüsse, und die Fahrt währt eine gute Stunde. Bis vor einigen Jahren pendelten die Menschen aus den Dörfern nach Pordenone, jetzt geht es in die umgekehrte Richtung, nach Treviso, wo die Zentralverwaltung von Benetton zu Hause ist, oder nach Venedig. Dabei ist die Innenstadt, selbst an italienischen Verhältnissen gemessen, von außerordentlicher Schönheit: Eine lange Straße windet sich hindurch, von gotischen Palazzi gesäumt, bis sie vor einem Dom und einem Rathaus endet, die beide auf das 14. Jahrhundert zurückgehen. Wohlhabend war Pordenone durch Baumwollspinnereien geworden, doch reich wurde die Stadt nach dem Zweiten Weltkrieg, als an der Peripherie die größte Fabrik für Haushaltsmaschinen in Südeuropa entstanden war. Von diesem Unternehmen sind nur noch Reste übrig geblieben. Sie gehören einem schwedischen Konzern, der die Produktion weitgehend nach Osteuropa und Asien verlegt hat. Pordenone zählt aber nicht weniger Einwohner als vor zehn oder zwanzig Jahren: Die Menschen sind wohnen geblieben.
Misstrauen gegenüber dem Staat
Immer wenn der Staatshaushalt Italiens zu einer unsicheren Angelegenheit wird und Hilfe aus dem Ausland in Betracht käme, ist von diesem Immobilienbesitz die Rede: Warum die Italiener subventionieren, wenn sie doch in der Mehrheit vermögend sind, vermögender jedenfalls als Deutsche oder Österreicher? Tatsächlich beträgt das mittlere Vermögen der Haushalte in Italien nach Berechnungen der Bundesbank mehr als 150.000 Euro, während es in Deutschland bei gut 50.000 Euro und in Österreich bei etwa 75.000 Euro liegt. Da könne man doch, so beginnen die Spekulationen, eine einmalige Vermögensabgabe von zwanzig Prozent des Haushaltsvermögens verfügen, und alle finanziellen Nöte des Staates seien aufgehoben. Die Unterschiede sind aber im Umgang mit Immobilien begründet: In Deutschland, heißt es immer wieder, besäßen die Menschen so wenig Wohneigentum, weil sie sich durch einen Sozialstaat abgesichert wähnen und gar nicht einsähen, warum sie sich einer Wohnung wegen verschulden sollten.
Es ist jedoch nicht nur das Misstrauen gegenüber dem Staat, das die Menschen in das Wohneigentum treibt, und es sind nicht nur die schlechten Erfahrungen mit plötzlich gekürzten Renten (so nach der Reform von 1992) oder Krankenversicherungsansprüchen. In Italien warten viele Menschen im Alter von dreißig oder vierzig Jahren, die keine ihrer Ausbildung gemäße Stelle erhielten und vermutlich nie eine solche bekommen werden, auf die plötzliche Lösung ihrer Schwierigkeiten durch den Erbfall. Es bleibt ihnen gar nichts anderes übrig. Hinzu kommt, dass die Immobilienwerte zunehmend fiktiv sind: Der durchschnittliche Preis einer italienischen Eigentumswohnung sank, wie eine der nationalen Maklerfirmen jüngst ausrechnete, seit dem Jahr 2008 um fast zwanzig Prozent. Aber es wird, aus den genannten Gründen, nur wenig verkauft, was vor allem für die ländlichen Gebiete und die kleinen Städte gilt. Lässt sich nun ermessen, wie niederträchtig sich der nördlich der Alpen beliebte Vorschlag einer Vermögensabgabe in italienischen Ohren anhört?
Als an einem frühen Morgen vor gut zwei Jahren ein voll besetzter, aus Cremona kommender Regionalzug bei Mailand entgleiste, starben drei Menschen. „L’Italia è un treno di pendolari“ schrieb daraufhin die Presse, „Italien ist ein Pendlerzug“. Fast sechs Millionen Pendler sind in Italien jeden Tag mit der Bahn unterwegs. In Deutschland beträgt die Zahl der Pendler nicht einmal ein Drittel davon. Gemeint ist auch, dass sich das Leben in Italien in Pendelbewegungen zwischen Extremen vollzieht: Da sind auf der einen Seite die schäbigen grünen Züge, in denen sich das Volk durch das Land bewegt, auf der anderen die „Freccerosse“ („Rote Pfeile“) mit ihren drei ersten Klassen: „Premium“, „Business“ und „Executive“. Da ist auf der einen Seite der Norden mit seinen vielen und eng getakteten Bahnverbindungen, und auf der anderen Seite der Süden, wo die Züge im Durchschnitt zehn Jahre älter sind als im Veneto und auf meist eingleisigen Strecken nur gelegentlich herumfahren. Und da ist auf der einen Seite die große Stadt, in der sich, wie in allen industrialisierten Ländern, das Kapital und die Arbeit konzentrieren, und auf der anderen eine Region, aus der das Leben trotz allem nicht entwichen ist.
Jedes Dorf ein eigener Dorfstaat
In diesem dreifachen Sinne, im Hinblick auf die soziale Schichtung, die ökonomische Geografie und die kulturelle Bindung an die heimatliche Region, sind die „pendolari“ eine italienische Metapher. Die grünen Züge fahren kreuz und quer durch die Landschaft zwischen Venedig und den Bergen. Sie halten in Cittadella und in Belluno, sie verkehren zwischen Casarsa, wo Pier Paolo Pasolini als Lehrer arbeitete, und Portogruaro. Die Züge sind das Bindeglied zwischen ländlichen Gemeinden und kleinen Städten, die eigentlich alle, und jede für sich, ein Stadt- oder Dorfstaat sind. Viele Passagiere kennen einander, nicht zuletzt von zahllosen gemeinsamen Fahrten. Die Telefone klingeln unentwegt, aber die Verbindungen brechen manchmal ab, oft bei mehreren Reisenden gleichzeitig. Der Ruf „ci sei?“ tönt dann durch den Wagen, „bist du noch dran?“ Vielleicht würde man gern mit „si“ antworten, aber das geht selbstverständlich gar nicht.
Buchtipp
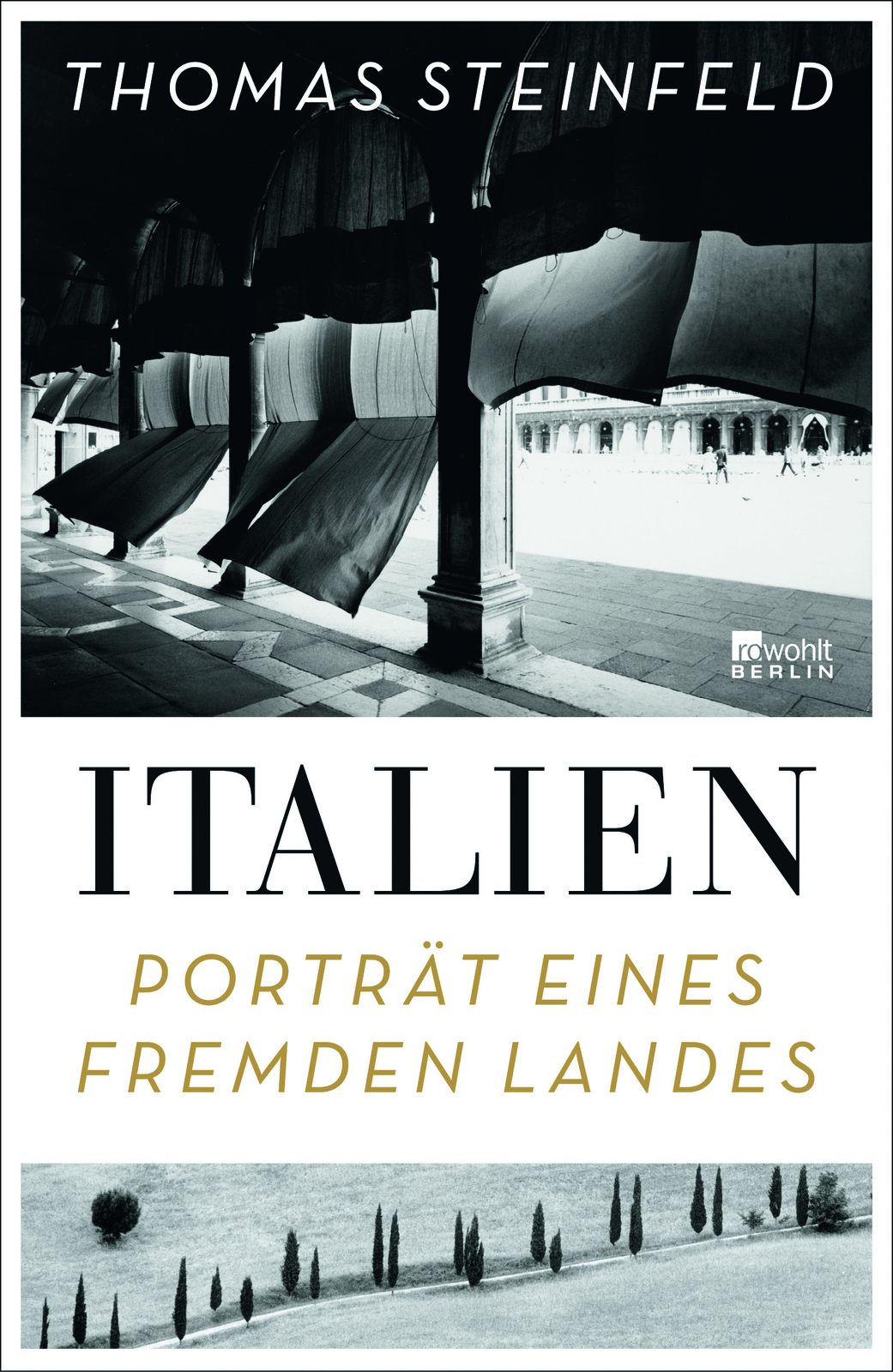
Thomas Steinfeld
Italien: Porträt eines fremden Landes
Rowohlt 2020, 448 Seiten, 25 Euro

Thomas Steinfeld ist Germanist und Musikwissenschaftler, lehrte in Schweden und Kanada und war Feuilletonredakteur der Frankfurter Allgemeinen Zeitung und der Süddeutschen Zeitung. Von 2006 bis 2018 lehrte er als Professor für Kulturwissenschaften an der Universität Luzern. Heute ist er Autor und Korrespondent der Süddeutschen Zeitung.
Weitere Artikel des Autors
8/2021
Die Rückkehr der Heimat
7/2020
Nichts als Reinheitsfantasien
Mehr zum Autor







