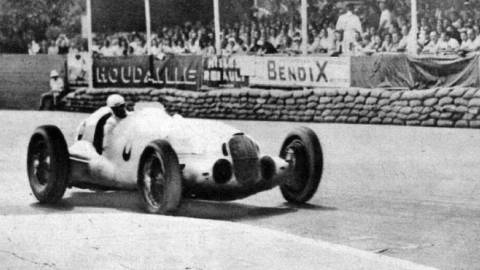Luther-Kolumne
Kirche ohne Profil und klaren Kurs
Wieviel Pluralismus braucht die evangelische Kirche? Und wieviel verträgt sie? Gedanken zur Identität des Protestantismus
Das Jahr des großen Reformationsjubiläums ruft nach einer Standort- und Kursbestimmung für die protestantischen Kirchen weltweit und insbesondere im Ursprungsland der Reformation. Selbstverständlich hat die geschichtliche Entwicklung im letzten halben Jahrtausend viel Neues gebracht und die evangelische Kirche verändert. Umso mehr drängt sich die Frage auf, was bei allem Wandel im Umbruch der Zeiten die bleibende Identität des Evangelischen ausmacht – und ob sie heute in ihrem Kern noch angemessen gewahrt ist oder mehr und mehr verlorengeht. Evangelische Kirchen verdanken ihr Profil ihrer historischen Entstehung, und das bedeutet dem Systematischen Theologen Günther Keil zufolge: Ihre „geschichtliche Geprägtheit macht durchaus geschichtliche Neuansätze möglich, aber diese müssen im Kraftstrom dieser Geprägtheit stehen, dürfen den reformatorischen Ansatz nicht verlassen oder gar in sein Gegenteil verkehren…“
„Kraftströme“ der Reformation
Wie jedoch sieht der „Kraftstrom“ des Reformatorischen näherhin aus? Nach welchen inhaltlichen Kriterien bestimmt er sich? Kernbegriffe wie „Freiheit“ oder „Wahrhaftigkeit“ werden zwar gern als Antworten auf diese Frage genannt, sind aber Allgemeinplätze, die ihrerseits der Näherbestimmung bedürften. Im Zentrum der Reformation stand zweifellos Martin Luthers Entdeckung und Propagierung der radikalen göttlichen Gnade, die in ihrer Bedingungslosigkeit nur im Glauben an Jesus Christus erkannt und ergriffen werden kann, wobei selbst solcher Glaube als Gnadengeschenk verstanden wird. Allein die Gnade, allein durch den Glauben: So lauten die Prinzipien reformatorischer Rechtfertigungslehre. Indessen wird vielfach gesagt, diese sei für den modernen Menschen kaum mehr interessant. Ihm gehe es stattdessen um die Sinnfrage. Nicht wie er vor Gott und dem Endgericht bestehen könne, sei für ihn relevant, sondern ob es Gott überhaupt gebe.
Diese Diagnose hat ihre Richtigkeit. Es konnte dahin kommen, weil allein die Entstehung der evangelischen Kirche im Gegenüber zur römisch-katholischen auf die Dauer zu einer Relativierung des Konfessionellen und schließlich auch des Religiösen überhaupt beigetragen hat. In der Konsequenz ist die Gesellschaft zunehmend säkularisiert und pluralisiert worden. Moderne und Postmoderne sind insofern ohne die Entstehung und Geschichte des Protestantismus nicht zu verstehen. Umgekehrt aber wirken sie ihrerseits auf die evangelische Kirche zurück. So erklärt sich deren heutiges Gesamtbild: Sie ist in sich vielgestaltig, ja widersprüchlich geworden; verweltlichte Religiosität, Anpassung an den Zeitgeist und an die herrschende Kultur stehen teils vermittelt, teils unvermittelt neben konservativem Bemühen um ein Festhalten reformatorischer Kerngehalte.
Unscharfes Profil
Das insofern erodierende Profil protestantischer Spiritualität dürfte mit ursächlich dafür sein, dass die Mitgliederzahl der evangelischen Kirche in Deutschland im letzten halben Jahrhundert deutlich schneller nach unten gegangen ist als die der katholischen Kirche. Aktuell ringen protestantische Landeskirchen um neue Konzepte, mit denen sie auf die problematische Entwicklung ihrer Statistiken angemessen zu reagieren versuchen. Doch was sich bisher abzeichnet, ist weniger eine verstärkte Rückbesinnung auf reformatorische Kerngehalte des Glaubens als vielmehr ein Experimentieren mit anderen Gestaltungsformen und Strukturen: Weniger an die Reformation als vielmehr an „Reformen“ wird gedacht.
Das hat ganz offenkundig zu tun mit der theologisch überwiegend liberalen Ausrichtung protestantischer Kirchen in der Gegenwart. Nur zwei Beispiele dafür seien hier angeführt. Zum einen: Was ist aus der lutherischen Orientierung am Prinzip des „Christus allein“ geworden, wenn Gerhard Ulrich, Leitender Bischof der Vereinigten Evangelisch-Lutherischen Kirche in Deutschland, im Kontext des Osterfests 2016 zur Frage der Auferstehung Jesu verlauten lässt, der Leib des Gekreuzigten sei vergänglich gewesen wie jeder Menschenleib; doch das, was in ihm göttlich gewesen sei, also seine Sache, seine Haltung, seine Leidenschaft und sein Einsatz für das wahre Leben, sei nicht tot und lebe, wenn nur seine Nachfolger das wollten? Solch eine reduktionistische Uminterpretation der Osterbotschaft in der Nachbarschaft zu ihrer nach wie vor anzutreffenden biblischen Ausrichtung provoziert nach innen wie nach außen die Frage, ob das evangelische Kirchenschiff ohne Kompass unterwegs sei. Dabei weiß Bischof Ulrich selbst: „Wir müssen energisch zu den Inhalten unseres Glaubens kommen, weil sich an den Inhalten unsere Zukunft als Kirche nach innen und außen entscheidet.“
Ein anderes Beispiel wäre der Umgang mit dem Problem der Homosexualität. Im Unterschied zur römisch- und orthodox-katholischen Kirche befindet sich die evangelische hier in einem Prozess fortlaufender Anpassung an die gesellschaftspolitische Liberalisierung. So gilt seit 2010 in der EKD, dass Pfarrerinnen und Pfarrer nicht nur gleichgeschlechtliche Lebenspartnerschaften eingehen, sondern auch wie Ehepaare in einer Dienstwohnung zusammenleben dürfen, sofern die einzelnen Gliedkirchen diese Bestimmung übernehmen. Das traditionelle protestantische Pfarrhaus in seiner Vorbildfunktion – wie hat es sein Gesicht geändert! Überdies votieren immer mehr landeskirchliche Synoden ganz im Sinne liberal orientierter Parteien und Strömungen dafür, Paare mit eingetragener Partnerschaft im Gegensatz zur bisherigen gesetzlichen Regelung baldigst im Vollsinne als Ehepaare gelten und sie folglich auch kirchlich trauen
zu lassen. Geistlichen wird dann dabei ein – wohl nur vorläufiger – Gewissensvorbehalt zugestanden, so dass sie bis auf Weiteres noch nicht dienstlich gezwungen sind, „Homo-Trauungen“ liturgisch zu vollziehen.
Der Protestantismus zeigt sich jedenfalls auch bei dieser Thematik in einer pluralistischen Verfassung und hat mit kaum vereinbaren Positionen in seinen Reihen zu kämpfen. So wird zwar die Argumentation Konservativer, die Bibel urteile in Sachen Homosexualität durchgängig kritisch, etwa von dem Erlanger Ethiker Peter Dabrock anerkannt, zumal er weiß, dass sich evangelische Ethik „wie evangelische Theologie überhaupt auf die Bibel als ihre Quelle und Norm verwiesen“ sieht. Insofern ist Dabrock ehrlicher als jene, die unter Anwendung hermeneutischer Thesen und exegetischer Zurechtlegungen an der Eindeutigkeit der betreffenden Schriftaussagen zu rütteln versuchen. Dennoch kritisiert er „ein kontextloses Zitieren einzelner alt- und neutestamentlicher Spitzensätze gegen homosexuelle Menschen und Praktiken“ und erklärt schließlich, für Christen kein Verständnis zu haben, die heutzutage noch Homosexualität als sündhaft einschätzen. Damit trifft er beispielsweise den emeritierten Erlanger Systematiker Reinhard Slenczka, der zum Thema erklärt: „Man kann den Eindruck haben, dass bisweilen Protestantismus als Protest gegen das klare Wort und Gebot Gottes praktiziert wird.“ Wie also steht es heute um das reformatorische Prinzip „Allein die Schrift“?
„Hierarchie der Wahrheiten“
Die Lage der evangelischen Kirche ist gegenwärtig von unterschiedlichen, teils miteinander unvereinbaren Einstellungen, Positionen, Deutungen und Zielvorstellungen geprägt. Zwar stehen die Grundbekenntnisse offiziell nach wie vor fest, doch sie werden keineswegs einheitlich gewertet und interpretiert. Nun gab es eine Art kirchlichen „Meinungspluralismus“ schon von Anfang an; nicht ohne Grund hat bereits der Apostel Paulus gemahnt: „Den Schwachen im Glauben nehmt an und streitet nicht über Meinungen“ (Röm 14,1). In zentralen Glaubensfragen allerdings geht es um mehr als um „Meinungen“. In diesem Sinne wäre auch von protestantischer Seite jener Sachverhalt anzuerkennen, den die katholische Kirche als „Hierarchie der Wahrheiten“ bezeichnet. Pluralismus sollte insofern nur in weniger zentralen Fragen kirchlich bejaht werden. Konzentriertes Bemühen um mehr Einigkeit im Christusglauben dürfte die einzige verheißungsvolle Chance auf kirchliche Stärkung sowohl für den Protestantismus als auch für die Ökumene insgesamt sein.

Prof. Dr. Werner Thiede ist Pfarrer i.R. der Evangelisch-Lutherischen Landeskirche in Bayern und außerplanmäßiger Professor für Systematische Theologie an der Universität Erlangen-Nürnberg. Zuletzt erschienen unter anderem "Unsterblichkeit der Seele? Interdisziplinäre Annäherungen an eine Menschheitsfrage" (Berlin, 2. Auflage, 2022) und "Himmlische Freude. Vom tiefen Glück des Glaubens" (Leipzig, 2024).
werner-thiede.deWeitere Artikel des Autors
Westliche Abschreckung und russischer Nihilismus
Mehr zum Autor