Titelthema
Schicksalstage eines Kontinents
Wie der Ausgang des Ersten Weltkriegs in Europa eine neue staatliche Unordnung entstehen ließ
Zur Zeit der im Januar 1919 einsetzenden großen Pariser Friedenskonferenz erzählte man sich in Osteuropa eine Anekdote: In Lemberg zeigt ein Galizier einem Amerikaner die Schäden, die der unmittelbar nach dem Krieg einsetzende Kampf um die Herrschaft über die Stadt hinterlassen hatte. „Schauen Sie auf diese Löcher dort“, wies er seinen Gast auf einige durch Maschinengewehre hervorgerufenen Einschussspuren an einer Wand hin. „Wir nennen sie ‚Wilsons Punkte‘.“
Die Schusslöcher in der Mauer waren eine deprimierende Antwort auf das, was der US-amerikanische Präsident Woodrow Wilson als Projekt eines wenn nicht ewigen, so doch dauerhaften Frieden entworfen zu haben glaubte. „Keine Nation sollte versuchen, ihre Politik einer anderen Nation oder einem anderen Volk aufzuzwingen“, hatte er im Januar 1917, kurz vor Kriegseintritt der USA, erklärt. „Vielmehr sollte jedes Volk frei sein, seine eigene Politik zu bestimmen.“
Wilsons Ideale
Mit seiner Vorstellung zum neuen, endlich nicht mehr auf rüden Machtverhältnissen gründenden Miteinander der Völker schien Wilson gegen Ende des Ersten Weltkriegs und mehr noch während der darauf folgenden Pariser Friedenskonferenz wie eine Lichtgestalt. Die Zeiten jeglicher Unterdrückung, so die Hoffnung, wären vorüber. Die New York Times ließ ihren Lesern keinerlei Zweifel, was Wilsons Worte seien – nämlich nicht weniger als eine „moralische Transformation“.
Diese Transformation hatte Wilson wiederholt verkündet. Sie war gewissermaßen der Preis, den er für den Kriegseintritt der USA gefordert hatte. Und der, stellte sich heraus, würde hoch werden. Immerhin hatten gut 200.000 US-Soldaten auf den europäischen Schlachtfeldern ihr Leben verloren. Deren Tod wäre nur dann nicht vergeblich, wenn auf ihn eine ganz neue Weltordnung folgte; eine, in der nicht mehr das Recht des Stärkeren gelte. Für dieses Ziel gälte es zu kämpfen, erklärte er am 2. April 1917, vier Tage vor dem Kriegseintritt der USA: „The world must be made safe for Democracy“.
Gut neun Monate später, Anfang Januar 1918, hielt der britische Premier David Lloyd George in London eine Rede, in der er eines der wichtigsten Legitimationsprinzipien der künftigen globalen Ordnung umriss: „Self-Determination“ –„Selbstbestimmung“. Damit war ein weiterer Großbegriff des 20. Jahrhunderts in die Runde geworfen. Um das Feld nicht den Briten zu überlassen, konzipierte Wilson eine Antwort, in der er seine Ansicht darlegt: die berühmten „Vierzehn Punkte“, die er am 8. Januar im US-Kongress vorstellte.
Mit ihnen traf Wilson den Nerv der Zeit. Viel mehr, als er es selbst wohl ahnte, griff Wilsons Entwurf Entwicklungen auf, die sich gerade in Mitteleuropa – einem der Zentren des Krieges – seit Jahrzehnten angedeutet hatten.
Mitteleuropa: Das war das Terrain der damaligen Großmächte: des Habsburger- und des Zarenreichs und – in kleinerem Maße – auch das der Hohenzollern. Diese Imperien hatten die Region im Griff, und zwar so sehr, dass etwa Polen, seit Ende des 18. Jahrhunderts aufgeteilt zwischen den drei mächtigen Nachbarn, komplett von der Landkarte verschwunden war. Entsprechend groß war hier der Wunsch, wieder als eigenständige Nation in die Welt zurückzukehren. „Hände und Füße mochte man in Ketten legen“, notierte 1916 der Schriftsteller Henryk Sienkiewicz, Literaturnobelpreisträger des Jahres 1905. „Aber es war unmöglich, Gefühle und Gedanken anzuschmieden. Sie fanden ihren Ausgang und wurden Literatur.“ Und darum, so Sienkiewicz, habe die polnische Literatur eine viel dringlichere Aufgabe als die anderer Nationen: „Das Volk verdichtet sich in ihr und lebt durch sie – denn anders kann es nicht leben.“
Träume von der eigenen Nation
Damit griff Sienkiewicz einen politisch- künstlerischen Impuls auf, der seit der Mitte des 19. Jahrhunderts in nahezu allen Teilen des Habsburgerreichs mit Händen zu greifen war. Überall machten sich patriotisch gestimmte Künstler und Intellektuelle daran, die Eigenständigkeit ihrer unter imperialem Dach lebenden Nationen zu propagieren. Begeistert diskutierten etwa die Tschechen die Idee eines „vlastenské divadlo“, eines „nationalen Theaters“. 1856 hatten die Initiatoren ein Grundstück am Ufer der Moldau erworben, acht Jahre später begannen die Bauarbeiten. „Wir alle“, schrieb der Autor Jan Neruda, „haben dieselbe Arbeit und verfolgen denselben Zweck, dem Volk ein nationales sowie allgemein menschliches Bewusstsein, eine feste ethische Grundlage sowie tiefe und inhaltsreiche Bildung zu geben. In der geistigen Bildung des Volkes besteht seine Zukunft, die ihm die Kraft gibt und es zur Berühmtheit führen wird!“
1883 wurde das Theater eingeweiht. Der Komponist Bedrich Smetana hatte für diesen Zweck die Oper „Libusa“ komponiert, ein Stück ganz nach dem patriotischen Geschmack der Zeit. „Meine geliebte tschechische Nation wird nicht untergehen, sie wird die Schreckenshöllen ruhmhaft überstehen!“, versichert die zentrale Protagonistin des Singspiels.
Das Ende der alten Reiche
Überall lockerte sich die Bindung an die großen Imperien, wich sie der Begeisterung für eine eigene, irgendwann einmal unabhängige Nation. „Die Zeit will uns nicht mehr“, beobachtet ein habsburgischer Aristokrat in Joseph Roths 1932 erschienenem Historienroman Radetzkymarsch. „Diese Zeit will sich erst selbständige Nationalstaaten schaffen! Man glaubt nicht mehr an Gott. Die neue Religion ist der Nationalismus. Die Völker gehn nicht mehr in die Kirchen. Sie gehn in nationale Vereine.“
Nach der Jahrhundertwende gewann der Prozess an Fahrt. Die Aussicht, die großen Imperien könnten zusammenfallen, beflügelte die nationalen Hoffnungen. Schon während des Krieges hatten Unterhändler wie der tschechische Philosoph Tomáš Garrigue Masaryk oder der polnische Pianist Ignacy Jan Paderewski erfolgreich Werbung für die Unabhängigkeit ihrer Länder gemacht. Und kaum war der Krieg zu Ende, war es soweit: Polen feierte seine Rückkehr in die europäische Staatenwelt, und die Tschechen sahen sich endlich wieder als eigenständige Nation.
Offen blieb zunächst über weite Strecken die Grenzfrage: Welche Territorien, welche Bevölkerungsgruppen sollten die neuen Staaten umfassen? Die „Völker Österreich-Ungarns“, hatte Wilson in seinen Vierzehn Punkten erklärt, sollten „freieste Gelegenheit zu autonomer Entwicklung“ erhalten. Wie schwierig es aber gerade in Mitteleuropa war, eindeutig definierte Staatsterritorien samt homogener Bevölkerung aus der Taufe zu heben, deuten die Worte an, mit dem der Schriftsteller Ödön von Horváth, Jahrgang 1901, seine Biographie umriss: „Ich bin in Fiume geboren, in Belgrad, Budapest, Pressburg, Wien und München aufgewachsen und habe einen ungarischen Pass; aber ich habe kein Vaterland. Ich bin eine typische Mischung des alten Österreich-Ungarn: Magyar, Kroate, Deutscher und Tscheche zugleich; mein Land ist Ungarn, meine Muttersprache Deutsch.“
Es liegt auf der Hand: Menschen wie Horváth einer einzigen Nation zuzuordnen, war außerordentlich schwierig, um nicht zu sagen: unmöglich. Das aber interessierte die Staatenlenker, die sich ab Januar 1919 zur großen Pariser Friedenskonferenz trafen, wenig. Sie hatten vor allem eines im Sinn: geordnete Nationalstaaten zu schaffen. So fochten sie um Homogenität, wo Homogenität nicht zu haben war.
Wilsons Worte, ahnte US-Außenminister Robert Lansing im Dezember 1918, würden in den betroffenen Regionen für erhebliche Unruhe sorgen. „Der Begriff steckt schlicht voller Dynamit. Er wird Hoffnungen wecken, die niemals verwirklicht werden können. Welch ein Unglück, dass dieser Begriff jemals geäußert wurde! Welches Elend er verursachen wird.“
In der Tat: Zwar reduzierten die Pariser Verträge die Zahl der in Mittel- und Osteuropa als Minderheiten lebenden Menschen um die Hälfte auf rund 30 Millionen Personen. Die aber lebten dafür unter einem ungleich höheren Druck als zuvor.
Die Folgen der neuen Selbstbestimmung bekamen auch die deutschsprachigen Gemeinden zu spüren. So etwa auf dem Gebiet der heutigen Staaten Tschechien und Slowakei. Dort galten Personen mit Deutsch als Muttersprache von 1919 an mit einem Mal als Fremde. 1917 mochte Masaryk noch die Gleichbehandlung der im Lande lebenden Minderheiten versprechen. Doch kaum war er im November 1918 ins Präsidentenamt gewählt, ließ er ganz andere Töne vernehmen. „Wir haben unseren Staat errichtet; dadurch wird die staatsrechtliche Stellung unserer Deutschen bestimmt, die ursprünglich als Immigranten und Kolonisten ins Land kamen.“ Rund 3,2 Millionen Menschen, die sich kurz zuvor noch als deutsche Bürger der österreichischen Reichshälfte verstanden hatten, wurden fast über Nacht zu einer Minderheit in der alten Heimat.
Hinnehmen wollten sie den neuen Status nicht. Am 4. März 1919 trat in Wien die neu gewählte Nationalversammlung zusammen – für viele der nun so genannten Sudetendeutschen Anlass, ihre Verbundenheit mit Deutsch-Österreich öffentlich zu bekunden. Überall hatten sie ihre Flaggen gehisst, im tiefsten Mitteleuropa erscholl „Die Wacht am Rhein“. Unter Berufung auf Wilsons „Vierzehn Punkte“ forderten die Demonstranten den Verbleib bei Österreich.
In Prag ließ man sich davon nicht beeindrucken, im Gegenteil: Die junge Republik ließ ihre Sicherheitskräfte los. 53 Menschen wurden an jenem Tag erschossen, über tausend wurden verletzt. Der 4. März war für die Sudetendeutschen fortan der „Tag der Selbstbestimmung“. Er wurde im Laufe der Jahre mit immer radikaleren Parolen gefeiert. 1933 gründete der Nationalist Konrad Henlein die „Sudetendeutsche Heimatfront“, die fortan entschiedenen Kurs in Richtung NSDAP nahm. Von ihnen frenetisch gefeiert, marschierte Hitlers Armee im März 1939 in die Tschechoslowakei ein.
Das Dilemma der neuen Ordnung
Dort wie in ganz Mittel- und Osteuropa zeigte sich das Dilemma der in Paris beschlossenen neuen Ordnung: Sie gebar Staaten, die die schwelenden Konflikte der zusammengebrochenen Reiche auf kleinerem Gebiet fortsetzten. Zentrum und Peripherie verharrten weiter in einem angespannten Verhältnis, nur mit dem Unterschied, dass das Zentrum, um beim tschechischen Beispiel zu bleiben, nun Prag und die Peripherie Karlsbad, Reichenberg oder Nikolsburg hieß. Nationalstaaten, weiß man seitdem, sind potentiell unduldsame Konstrukte.
100 Jahre Republik
Im November eröffnet in Wien das Haus der Geschichte Österreich
Zum 100. Jahrestag ihrer Gründung schenkt sich die österreichische Republik ein neues zeitgeschichtliches Museum. Am 10. November 2018 eröffnet das Haus der Geschichte Österreich (HGÖ) am Wiener Heldenplatz seine Pforten. Laut seinem inhaltlichen Konzept soll das HGÖ künftig einem breiten Publikum die Geschichte Österreichs ab der Mitte des 19. Jahrhunderts – mit einem besonderen Schwerpunkt von 1918 bis in die Gegenwart – in ihrem europäischen und internationalen Kontext vermitteln. Dabei sollen chronologische Erzählungen mit thematischen Schwerpunkten verschränkt werden, die die Vielfalt der österreichischen Gesellschaft spiegeln. So sollen etwa überlieferte Geschichtsbilder hinterfragt und Identitätsdebatten nachgezeichnet werden.
Aus Anlass des 100. Jahrestags der Ausrufung der Republik sowie der Gründung des HGÖ erscheint im Wiener Verlag Kremayr & Scheriau der Band „100 x Österreich“. Darin haben die Herausgeber Monika Sommer, Heidemarie Uhl und Klaus Zeyringer Schriftsteller und Wissenschaftler eingeladen, Einblicke in ihre Beobachtungen über die Verfasstheit Österreichs zu geben. Entstanden ist ein Band mit Essays zu 100 Stichworten, der – von der restituierten „Adele“ über „Politische Farbenlehre“ und „Staatsvertrag“ bis zu „Zukunftsangst“ – pointierte Perspektiven auf Politik, Kultur, Gesellschaft und Alltag versammelt.
Eine vielschichtige Zeitdiagnose, die präzise und prägnant, aber auch mit Witz und Ironie Österreichs Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft beleuchtet.

Haus der Geschichte
100 x Österreich. Neue Essays aus
Literatur und Wissenschaft
Kremayr & Scheriau Verlags
400 Seiten
29,90 EUR
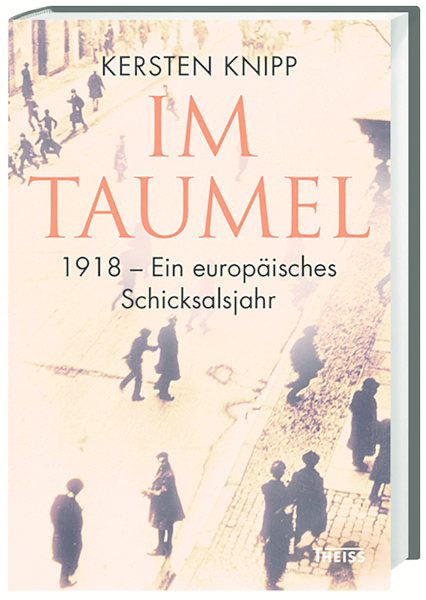
Buchtipp
Kersten Knipp
Im Taumel. 1918 – Ein europäisches Schicksalsjahr
wbg Theiss
422 Seiten
gebunden im Schutzumschlag
29,95, EUR

Kersten Knipp ist Autor und Journalist mit den Schwerpunkten arabische und romanische Welt. Auf den Online-Seiten der Deutschen Welle berichtet er regelmäßig über die politische Entwicklung im Nahen Osten.
Weitere Artikel des Autors
10/2021
Verlorenes Vertrauen
Afghanistan: Zeit der Abrechnung
4/2020
Selbsterhaltungskampf
Mehr zum Autor







