Titelthema
Gefährliche Zerrbilder
Bis heute ist der 20. Juli nicht wirklich tief ins öffentliche Bewusstsein gedrungen. Das macht dieses wichtige Datum anfällig für krude Umdeutungen.
Der 20. Juli 1944 muss in der Bundesrepublik seit jeher mit einer merkwürdigen Ambivalenz auskommen. Er hat einerseits eine hohe Bedeutung und wird gerne bei Feierlichkeiten in Ansprachen und bei Predigten zur nationalen Besinnung bemüht. Dies hat sich bis heute in einer Reihe von staatstragenden Würdigungen niedergeschlagen. Bundespräsident Theodor Heuss hatte mit seiner Rede am 19. Juli 1954 im Auditorium Maximum der Freien Universität Berlin den Ton gesetzt und vom „Vermächtnis“ gesprochen, „das durch das stolze Sterben dem Leben der Nation geschenkt wurde“. Die Geschichte des deutschen Widerstands handelt von inneren Kämpfen, vom Ringen mit dem Gewissen, von Anstand und Ehre, von Mut und Zivilcourage. Ein offizieller Feiertag ist der Gedenktag nie geworden, ein schwieriges Datum geblieben. Schon 1954 stand Heuss mit seiner Deutung vom heldenhaften Kampf des „Aufstands des Gewissens“ für die Sicht der Minderheit. Der Mehrheit hielt es indes mit ganz unterschiedlichen Betrachtungen, die eines gemeinsam hatten und haben: Sie werden den Frauen und Männern vom 20. Juli nicht gerecht. Von „Verrätern“ war in den Anfangsjahren der Bundesrepublik häufig die Rede, wenn das Attentat gegen Hitler zur Sprache kam. Noch wirkte die nationalsozialistische Propaganda mit der infamen Deutung des 20. Juli 1944 als eines Staatsstreichversuchs einer „ganz kleinen Clique verbrecherischer Offiziere“ nach. Aber auch die – meist schweigende – Mehrheit tat sich schwer und konnte wenig mit den Frauen und Männern anfangen, die 1944 das Äußerste gewagt hatten, um in Deutschland Anstand und Recht wiederherzustellen, bedeutete doch das Gedenken an den 20. Juli auch, dass es eine Alternative zum Mitmachen und Mitlaufen gegeben hatte. „Falsch und zu spät“ war ein häufig zu hörendes Urteil über den Staatsstreichversuch. Später folgten dann Diffamierungen der Angehörigen des 20. Juli als Reaktionäre und Antidemokraten. Wirklich tief ins öffentliche Bewusstsein ist der 20. Juli bis heute nicht gedrungen.
Geschichte lebt davon, dass immer wieder neue Fragen der jeweiligen Gegenwart an zurückliegende Ereignisse gestellt werden. Insofern ist Ruth Hoffmanns jüngst publizierte Behauptung, dass der Konsens über den 20. Juli in der Bundesrepublik in Frage zu stellen, beziehungsweise nicht mehr gegeben sei, eine ernstzunehmende These, die zur Auseinandersetzung einlädt. Bei näherer Hinsicht gerät ihre Auseinandersetzung jedoch zu einer geschichtspolitischen Abrechnung mit der Bundesrepublik. So stellt sie fest, dass unser heutiges Urteil über den 20. Juli „kein gesellschaftlicher Konsens, sondern das Produkt einer wechselvollen Entwicklung voller Widersprüche, empörender Vereinnahmungen und beschämender Versäumnisse“ sei.
Müssen wir die Geschichte der Bundesrepublik jetzt umschreiben und Abschied von unserer herkömmlichen Betrachtung des 20. Juli nehmen? Nur dann, wenn wir Vorurteile für Tatsachen, politische Meinungen und Polemik für analytisch abgesicherte wissenschaftliche Schlussfolgerungen halten. Auch die Bundeswehr hat in Hoffmanns Zerrbild des 20. Juli ihren instrumentalisierten Platz gefunden. Keine Deutung ist ihr zu bizarr. Adenauer habe die Erinnerung an den 20. Juli gebraucht, um die Wiederbewaffnung durchzusetzen, schreibt sie. Die Wirklichkeit sah jedoch anders aus: Für die Bundeswehr war die Haltung zum 20. Juli 1944 die Kardinalfrage, an der das Verhältnis zur eigenen Tradition gespiegelt werden konnte. Die Bundeswehr musste von Anfang an mit dem Grundproblem leben, dass sie von Soldaten der Wehrmacht aufgebaut wurde, denn andere Männer gab es nicht, alle wehrtauglichen Deutschen waren zur Wehrmacht eingezogen gewesen. Gleichwohl bestand seit der Begründung der Bundeswehr Einvernehmen darüber, dass die Wehrmacht nicht traditionsbildend sein könne.
Für die Entwicklung der Haltung der Bundeswehr zum 20. Juli 1944 darf es daher wohl als Glücksfall gewertet werden, dass bei ihrer Begründung maßgebliche Offiziere aus dem Umkreis des 20. Juli eine Rolle gespielt haben. Bereits in der Vorläuferorganisation, der „Zentrale für den Heimatdienst“, waren mit Major a.D. Axel von dem Bussche, Oberst a.D. Johann Adolf Graf von Kielmansegg, Major a.D. Achim Oster und Generalmajor a.D. Hans Speidel vier Angehörige des 20. Juli vertreten. Der vom Deutschen Bundestag im Sommer 1955 eingesetzte Personalgutachterausschuss hatte die Bewertung des 20. Juli 1944 zutreffend und in weiser Vorausschau als den „Prüfstein für eine sorgfältige Auswahl des Führerkorps aller Ebenen“ identifiziert. Bereits 1956 wurde die einstige NS-Ordensburg Sonthofen in Generaloberst-Ludwig-Beck-Kaserne umbenannt. Der erste Generalinspekteur der Bundeswehr, General Adolf Heusinger, stellte dann in seinem Tagesbefehl zum 20. Juli 1959 unmissverständlich klar, dass der 20. Juli 1944 ein Lichtpunkt in der dunkelsten Zeit Deutschlands gewesen sei.
Kein Kommisskopf, kein Nur-Soldat
Auch Stauffenberg hat es seinen bundesrepublikanischen Deutern nie einfach gemacht. Er passt in keine Schublande, auch nicht in das Stefan-George-Fach. Er war eben alles andere als ein sturer Kommisskopf, kein Nur-Soldat, vielmehr nach dem übereinstimmenden Urteil von Weggefährten eine charismatische, vielseitige Persönlichkeit. Schon Thomas Karlauf hat in seiner 2019 vorgelegten Biographie vollkommen fehl in der Einschätzung gelegen, dass Stauffenberg ausschließlich als Soldat geurteilt habe – die vorhandenen Zeugnisse belegen gerade das Gegenteil. „Bei aller verstandesmäßigen Klarheit“, hieß es sogar in einem zeitgenössischen SS-Bericht über Stauffenberg und den 20. Juli, „war er ein Feuergeist und von faszinierender und suggestiver Wirkung auf seine Umgebung. … ein wirklich universeller Mensch, keineswegs ein einseitiger Militär.“ Wann genau bei Stauffenberg der Entschluss gereift ist, dem Hitler-Regime aktiv ein Ende zu setzen, lässt sich nicht mit Sicherheit festlegen. Vieles spricht dafür, dass die Entscheidung letztlich während des Lazarettaufenthalts nach der schweren Kriegsverwundung im Afrikafeldzug um Ostern 1943 gefallen ist und dass sie das Ergebnis eines Prozesses war. Ganz wesentliche Voraussetzungen dafür sind während Stauffenbergs dienstlicher Verwendung in der Operationsabteilung des Oberkommandos der Wehrmacht seit 1941 geschaffen worden. Die Einsicht in die Untauglichkeit der militärischen Spitzengliederung im Krieg verfestigte sich bei ihm damals, und aus jener Zeit sind wiederholt kritische Sätze überliefert. So wurde er 1941 von einem Hörer seines Vortrags vor Generalstabsoffizieren mit den aufschlussreichen Worten zitiert, dass, so Stauffenberg, die deutsche Kriegsspitzengliederung noch blöder sei als diejenige, die Generalstabsoffiziere hätten erfinden können, wenn man ihnen den Auftrag gegeben hätte, sich die unsinnigste Spitzengliederung auszudenken.
Stauffenbergs Tat war nur möglich, weil ein verschwiegener Kreis gleichgesinnter Freunde, Militärs und Zivilpersonen, zusammenwirkten, in mühevoller Vorbereitungsarbeit einander verbunden und entschlossen, dem nationalsozialistischen Unheilregime ein Ende zu setzen. Von vornherein war der 20. Juli auch als symbolisches Handeln angelegt, denn die Verschwörer konnten nicht damit rechnen, Erfolg zu haben, sie konnten nur darauf hoffen. Ganz offenkundig ist dies eine Geschichte, mit der wir Deutsche uns schwertun, und die, je weiter wir uns von ihr zeitlich entfernen, Gefahr läuft, in politischer Absicht missdeutet zu werden. Der gänzlich unzulässige Versuch der Indienstnahme durch die AfD steht dafür. Ruth Hoffmanns sich auf Halbwissen stützende Thesenhistorie ist ein weiterer Beleg dafür, dass wir gut daran tun, zum 80. Jahrestag die eigentliche Bedeutung von Attentat und Staatsstreichversuch vom 20. Juli 1944 neu für unsere Gegenwart zu entdecken. Dies hat im Ausland, etwa durch die Opposition in Weißrussland, schon begonnen. Die Geschichte des 20. Juli 1944 ist noch lang nicht auserzählt.

Axel von dem Bussche, 20.04.1919 – 26.01.1993, hatte Hitler 1943 bei der Vorführung neuer Uniformen töten wollen, doch zu der Präsentation kam es nicht. In die Pläne für den 20. Juli war er eingeweiht, aber am Umsturzversuch nicht direkt beteiligt.
Buchtipp
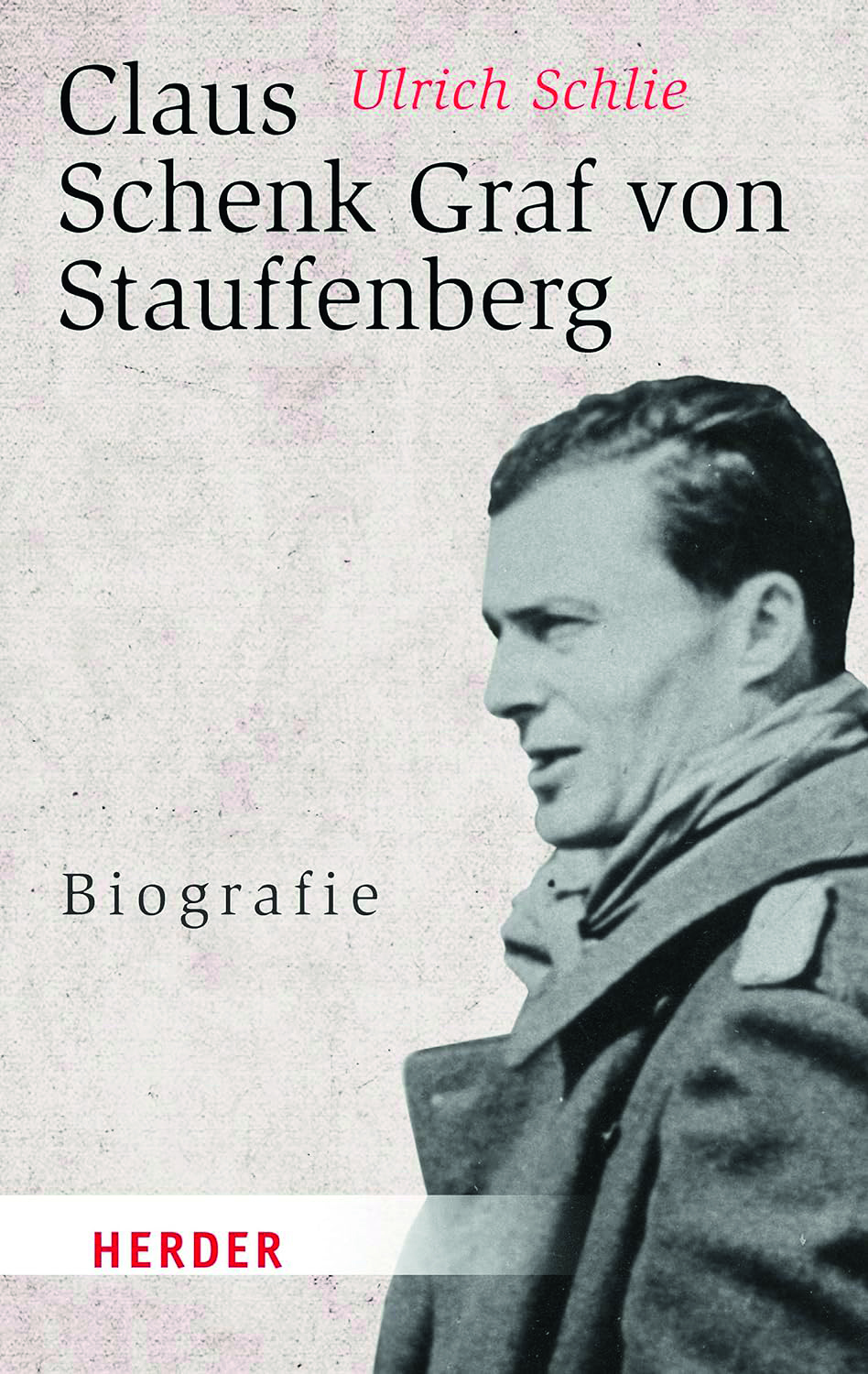
Ulrich Schlie
Claus Schenk Graf von Stauffenberg
Herder Verlag 2018,
224 Seiten, 12 Euro

Ulrich Schlie ist Historiker und seit 2020 Henry-Kissinger-Professor für Sicherheits- und Strategieforschung an der Universität Bonn. Von 2005 bis 2012 war er Leiter Planungsstab im Bundesministerium der Verteidigung, von 2012 bis 2014 dessen Politischer Direktor.
© Volker Lannert
Weitere Artikel des Autors
6/2025
"Ja, aber ..."
3/2025
Friedenssucher
4/2024
Große Aufgaben – damals wie heute
1/2023
Hybris und Nemesis
4/2021
Anders als früher
Mehr zum Autor







