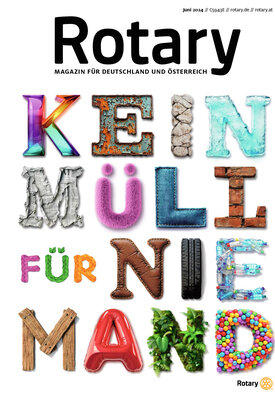Der Hüter des Common Sense

Hermann Lübbe, der große bundesrepublikanische Denker, feiert in diesen Tagen seinen 99. Geburtstag. Seine klugen Beobachtungen haben an Aktualität nichts eingebüßt
Es liegt eine ideengeschichtliche Versuchung darin, die Physiognomie eines Staates in der Philosophie wiedererkennen zu wollen, und die Bundesrepublik kann in ihrem achten Jahrzehnt mittlerweile auf ein breites Spektrum intellektueller Gründungsfiguren, Interpreten und Kritiker blicken. Zwei hochbetagte Wegbegleiter sind noch unter uns: Jürgen Habermas (geb. 1929), der „Hegel der Bundesrepublik“ (Jan Ross), war ihr kritischer Mahner, der in den 1980er Jahren zum Verfassungspatriotismus fand, dann im Zuge der Wiedervereinigung dem Bonner Provisorium nachtrauerte. Habermas avancierte zweifellos zur überragenden Debattengestalt der letzten fünf Jahrzehnte und gab zunächst der progressiven Linken, schließlich einer nostalgischen Sozialdemokratie Orientierung.
Hermann Lübbe (geb. 1926) hingegen, sein Counterpart in vielen Streitfragen um bundesdeutsches Selbstverständnis, Geschichtsbewusstsein, Bildungspolitik und gesellschaftliche Modernisierung, ist heute nur noch älteren Jahrgängen bekannt. Er neigte eher zur Entdramatisierung und fasste frühzeitig Vertrauen in die Ordnung des Grundgesetzes. Henning Ritter, langjähriger FAZ-Ressortleiter der Geisteswissenschaften, beschrieb Lübbes Denken einmal als „vollendete Aufklärung“ und rühmte ihn ganz zu Recht als den „eigentlichen philosophischen Verteidiger der Bundesrepublik“.
Das „kommunikative Beschweigen“
Lübbes langer Lebensweg spiegelt ein Jahrhundert deutscher Geschichte. In seinem Denken verarbeitete er die Leiden, Erfahrungen und Hoffnungen seiner Zeit, realitätsverbunden und mit sicherem moralischem Kompass. Anders als der etwas jüngere Flakhelfer Habermas hat Lübbe den Krieg noch als Marinesoldat erlebt und seine Folgen in Gefangenschaft durchlitten. Das Erlebnis des Totalitarismus hat ihn dazu geführt, sich entschieden zur Affirmation, ein Signalwort seiner Philosophie, des Guten und Richtigen, nämlich der liberalen Demokratie, zu bekennen.
In Zeiten beschleunigten Wandels ist es uns nicht mehr möglich, das eigene Leben an den Maßstäben der Vergangenheit auszurichten
Mit Odo Marquard und Robert Spaemann wurde Lübbe nach dem Krieg einer der bekanntesten Schüler des Münsteraner Philosophen Joachim Ritter (Vater des oben erwähnten Henning). Lübbe, der seit 1971 bis zur Emeritierung politische Theorie in Zürich lehrte, profilierte sich als führender Kopf der Ritter-Schule und nutzte die wichtigsten philosophischen Motive Ritters als Eckpfeiler zur liberalkonservativen Begründung der Bundesrepublik. Ihm ist es dabei gelungen, die Essenz der gewundenen Hegel- und Aristoteles-Auslegungen Ritters zu destillieren und für die Gegenwartsdiagnostik fruchtbar zu machen. Lübbes Kulturphilosophie der Moderne problematisierte die für die bürgerliche Gesellschaft konstitutive Entzweiung in liberaler Weise. Der Mensch muss in der komplexer werdenden Welt der Arbeitsteilung und Spezialisierung lernen, „entfremdet“ zu exis-tieren, weil er keine Chance hat, alle technischen Bedingungen seiner Lebenswelt umfassend zu begreifen. Herkunft und Zukunft treten auseinander, es kommt zur „Gegenwartsschrumpfung“. In Zeiten beschleunigten Wandels ist es uns nicht mehr möglich, das eigene Leben an den Maßstäben der Vergangenheit auszurichten. Als soziologische Bestandsaufnahme, nicht als normative Forderung, prägte Lübbe die Formel vom kommunikativen Beschweigen der NS-Vergangenheit als integrative Praxis der frühen Bundesrepublik. Anstatt eine unwahrscheinliche öffentliche Läuterung aller Ex-Parteigenossen zu fordern und die ausgebliebene Selbstbefreiung vom Nationalsozialismus zu beklagen, sei es immerhin möglich, die Vorzüge demokratischer Praxis einzuüben.
Kirche und Staat
Rückwirkend kann man seine Auseinandersetzungen mit Jürgen Habermas in den 70er und 80er Jahren als den bedeutendsten Beitrag zur Selbstverständigung über die intellektuelle Identität der Bundesrepublik betrachten. Es handelte sich im Kern um innerliberale Positionsklärungen, und an den Argumenten, die hier aufeinanderprallten, ließen sich die grundsätzlichen Streitfragen einer politischen Philosophie in der Demokratie nachvollziehen: Wann soll ein Diskurs in Dezision münden? Wie stabil oder flexibel müssen Institutionen sein? Welche Rolle spielen die vorpolitischen Ressourcen aus Religion und Traditionen für eine moralische Begründung der Politik? Als Sozialdemokrat, der Ende der 1960er Jahre vier Jahre als Staatssekretär in der nordrhein-westfälischen Landesregierung wirkte, orientierte er sich an den Lebenswelten der Bürger und akzentuierte ohne jeden akademischen Dünkel die Vielfalt milieu-, regional- und traditionsbedingter Umgangsformen. In der Säkularisierung sah er keine Befreiung von der Religion, sondern lediglich die politisch bedeutsame Tatsache, dass Kirchen und Staat gegeneinander geführt werden, aber in der Demokratie ein Gemeinsames finden.
Warnungen vor politischem Moralismus
Lübbes Philosophie vertritt zweifellos einen westlich-liberalen Standpunkt „nach der Aufklärung“ (eine seiner Lieblingsformeln). Er klammert sich aber nicht an einen Kanon, sondern übt sich in praktischer Hermeneutik und historisch-sensibler Kritik, auch wenn es um dezidiert antiliberale Denker geht. Auf stimulierende Weise adaptierte er so Stärken der Institutionentheorie Arnold Gehlens, um sie für den demokratischen Verfassungsstaat nutzbar zu machen. Carl Schmitts Dezisionismus nutzte er wiederum, um auf die notwendige Vorläufigkeit demokratischer Entscheidungen aufmerksam zu machen: Gegen den Kult der souveränen Entscheidung auf der einen Seite und die Forderung nach konsensueller Begründung auf der anderen Seite akzentuierte Lübbe die Legitimität demokratischer Dezision, die auf Revidierbarkeit und Common Sense beruht. In den Modi demokratischer Entscheidungsfindung und den zurechenbaren Verantwortlichkeiten sah er das wirksamste Argument gegen das Phantasma einer technokratischen Elitenherrschaft.
Seine Warnungen vor einem selbstgewissen politischen Moralismus, der den „Triumph der Gesinnung über die Urteilskraft“ markierte, konnte man bereits vor vier Jahrzehnten lesen. Sie haben an Aktualität so wenig eingebüßt wie so viele weitere kluge Beobachtungen dieses archetypischen bundesrepublikanischen Denkers.
Jens Hacke
lebt als Politik-wissenschaftler, Ideenhistoriker und Publizist in Hamburg. Zurzeit lehrt er Politische Theorie und Ideengeschichte an der Martin-Luther-Universität in Halle.
Foto: privat