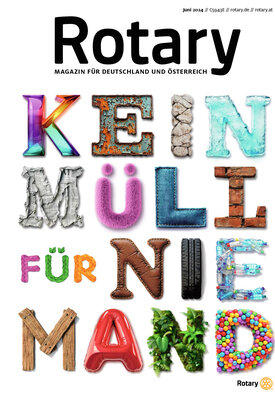„Jauchzet, frohlocket“

Warum die Erfolgsgeschichte des deutschen Chorwesens in Gefahr ist
Vielleicht haben auch Sie eingeschaltet: Am 18. Dezember 2024 lockte die Premiere von Bach – Ein Weihnachtswunder fast fünf Millionen Zuschauer vor die Bildschirme. Die ARD-Produktion war der quotenreichste Mittwochabend-Film im ganzen deutschen Fernsehjahr 2024. Und vielleicht haben auch Sie geweint: Tränen der Rührung, und zwar genau in jenem Moment, als der offenbar autistisch veranlagte zweitjüngste Bach-Sohn Gottfried Heinrich den Choral Ich steh an deiner Krippen hier anstimmt und nach und nach die übrigen Familienmitglieder in seinen Gesang einstimmen – um den eisenharten Ratsherrn Stieglitz zu erweichen, die infrage stehende Uraufführung des Weihnachtsoratoriums in letzter Minute doch noch zu gestatten.
Ja, der letzte Choral im Weihnachtsoratorium und zugleich sein intimster Moment geht tief zu Herzen. Zusammen mit dem unsterblichen Jauchzet, frohlocket gehört er für viele zum Weihnachtsfest wie der Tannenbaum oder der Festtagsbraten. Und überhaupt: Selten sind in der Musikgeschichte Gegenstand und dessen musikalische Ausgestaltung derart eins geworden, wie im Falle der Weihnachtsgeschichte nach Lukas und dem inzwischen 291 Jahre alten Weihnachtsoratorium des Leipziger Thomaskantors Johann Sebastian Bach. Denn Hand aufs Herz: Können Sie einer Lesung der Weihnachtsgeschichte lauschen, ohne dass in Ihnen gleich die Töne klingen, mit denen Bach sie im Weihnachtsoratorium in Noten kleidet?
Aber dass das Weihnachtsoratorium heute landauf, landab Scharen von Zuhörern in die Kirchen oder Konzerthäuser lockt und Tausende sangesfreudige Menschen auf Lebenszeit an die örtlichen Kirchenchöre bindet, hat noch einen Grund, der weit über Bach hinausgeht. Er liegt in dem Zauber begründet, den Musik zu entfachen vermag, wenn sie – wie in den Chorälen des Weihnachtsoratoriums – gemeinsam gesungen wird oder zumindest auf Melodien beruht, die jeder und jede kennt und mitsingen kann.
Luthers Choräle wurden die ersten Klassiker der protestantischen Kirchenmusik
Die Sangesfreudigkeit der Deutschen hat viele Väter, aber ein ganz zentraler war Martin Luther, genauer gesagt: seine Liebe zur Musik. Laut Luther ist die „Frau Musica“ ein „Geschenk Gottes“, mache „die Seelen fröhlich“ und „verjagt den Teufel“. Seine Devise: „Gottes Wort will gepredigt und gesungen sein.“ Und deshalb griff er selbst zur Feder und schuf deutsche Kirchenlieder, bestehend aus Texten, die – didaktisch klug aufbereitet – Inhalte der Bibel und der Glaubenslehre vermitteln und die er auf allseits bekannte Liedmelodien anstimmen ließ.
Luthers Choräle wurden die ersten Klassiker (und erfolgreichsten Exportprodukte) der protestantischen Kirchenmusik. Sie sorgen seit inzwischen fünf Jahrhunderten beim gemeinsamen Singen zuverlässig für ein wohliges Gemeinschaftsgefühl. Dies zumal, weil Luther im Verein mit seinem Erfül-lungsgehilfen Philipp Melanchton veranlasste, dass in den nachreformatorischen Schulordnungen die Musik fest in den Lehrplänen verankert wurde: mit standardmäßig vier Wochenstunden, unterrichtet von einem „Cantor“, und nicht zum Selbstzweck, sondern um mit den einstudierten (geistlichen) Gesängen sonntags den Gottesdienst zu verschönern. Luther im Jahr 1524: „Ich rede für mich, wenn ich Kinder hätte und vermöcht’s, sie müssten mir nicht alleine die Sprachen und Historien hören, sondern auch singen und die Musica mit der ganzen Mathematica lernen ... darinnen die Griechen ihre Kinder vorzeiten zogen, dadurch doch wunder geschickte Leut aus worden, zu allerlei hernach tüchtig.“
In den Jahrzehnten nach der Reformation versetzten allerorten in Sachsen und in den angrenzenden protestantischen Reichsgebieten neu gegründete Schulchöre die Kirchenemporen in Schwingungen. Und wo keine mehrzügigen Schulen vorhanden waren, besorgte ein – nach Luthers Empfehlung pragmatisch mit Freibier und „Cantorey-Schmäusen“ zusammengebrachter – Laienchor den Kirchengesang und trug das Seinige dazu bei, dass in Mitteldeutschland die „Frau Musica“ tatsächlich binnen Jahrzehnten ein „Breitensport“ wurde. Die Auswirkungen dieser flächigen musikalischen Ausbildung auf das allgemeine Musizierniveau wurden schnell unüberhörbar – und der pädagogische Erfolg ebenfalls. Sethus Calvisius, Leipziger Thomaskantor um 1600, bemerkte, ganz auf der Linie Luthers: „Wenn die Lieder mit menschlicher Stimm gesungen“ werden, so bewegen sie „die Gemüter der Menschen viel mehr und kräfftiger ... als wenn die Wort nur bloß geredet und gehört werden. ... Denn die Erfahrung bezeuget es: dass nichts leichter eingehe, auch bey den Kindern, als was man ihnen mit Gesang beybringet.“
Kann Bach das Chorland retten?
Auf längere Sicht war diese flächendeckende musikalische Früherziehung auch die Voraussetzung dafür, dass besondere musikalische Talente – Schütz, Bach und Händel (allesamt geboren in Mitteldeutschland) – früh erkannt und gezielt gefördert wurden und letztlich ihre heute identitätsstiftenden Werke schaffen konnten, die Deutschland insgesamt zu einem einzigartigen Chorland werden ließen.
Doch eine Entwicklung sollte uns heute Anlass geben, ein wenig zu relativieren. Bis ins 19. Jahrhundert hinein blieben die besagten vier Wochenstunden Musik vielerorts Standard; ich selbst hatte zwei, meine Kinder noch eine, und die fiel viel zu oft aus. 2024 hat Bayern in seinen Grundschulen die verbliebene eine Stunde in einem Verbundfach Musik/Kunst/Werken/Gestalten aufgehen lassen und damit de facto abgeschafft. Aber wenn die Schulen künftig als Vermittler einer allgemeinen Grundkompetenz im Singen ausfallen sollten, wer kann diese Aufgabe – jedenfalls in der Breite – übernehmen? Ehrenämtler? Vereine? Die Kirchen? Letztere wohl kaum. Ihre regelmäßigen Strukturreformen gehen in der Regel deutlich zulasten der kirchenmusikalischen Angebote – und sägen damit an einem der dicksten Äste, auf denen die Kirchen (noch) sitzen.
Und so müssen wir inzwischen wohl vor allem auf eines vertrauen: dass die Wirkung des Chorgesanges an sich oder im speziellen Falle der Zauber, der sich bei jeder einzelnen Aufführung des Weihnachtsoratoriums zuverlässig auf Zuhörer und Mitwirkende legt, weiterhin verborgene Energien freilegen wird – die ihrerseits den Erhalt des Chorlandes Deutschland absichern werden. Denn wie formulierte es der Soziologe Hartmut Rosa jüngst so schön: „Bach ist die einzige Droge, deren Glücksfaktor niemals abnimmt.“
Prof. Dr. Michael Maul
ist Intendant des Bachfestes Leipzig und Professor an der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg. Seit vielen Jahren ist er auf der Suche nach unentdeckten Bach-Schätzen in mitteldeutschen Archiven und machte dabei spektakuläre Entdeckungen.
Foto: Gert Mothes
FILMTIPP: „No Hit Wonder“
Der deutsche Film von Florian Dietrich mit Nora Tschirner in der Hauptrolle läuft derzeit in den Kinos
https://www.kino-zeit.de/film-kritiken-trailer/no-hit-wonder-2025