Essay
Die Glücksverwöhnten

Ein Blick auf die Generation der Babyboomer und die 68er
Wer seine Generation "Die Glücksverwöhnten" nennt, muss mit Widerspruch rechnen. Vielleicht darf ich erst einmal die Pro-Argumente vortragen. Es geht um die Generation der Babyboomer, die Achtundsechziger eingeschlossen. Das sind nach gängiger Einordnung die Jahrgänge 1944 bis 1964 (plus/minus). Der Historiker Wolfram Pyta möchte die Verwendung des Generationsbegriffes dann gelten lassen, wenn es einen"generationell gestifteten Zusammenhang" gibt. Er spricht von einer "Erfahrungsverwertungsgemeinschaft", die 10 bis 15 Jahrgänge umfassen sollte. Das sind übrigens kürzere Zeiträume als bei Generationen bis dato gewohnt, wo ein Zeitraum von 25 Jahren für eine Generation die Regel war.
Schaut man sich die Einteilung nach 1964 an, wie sie in der Literatur gängig ist, handelt es sich tatsächlich um Generationen im 15-Jahre-Takt: die Generation X bis 1980, die Generation Y (Millennials) bis 1996, die Generation Z bis 2012, ihr folgend die Generation Alpha der seit 2013 Geborenen. Die Begründung für diese kurzen Etappen liegt in der rasanten technologischen Entwicklung vom ersten Kontakt mit digitalen Technologien über das Aufwachsen mit Smartphones, Social Media und zuletzt mit künstlicher Intelligenz und frühkindlichem Zugang zu Tablets.
Damals, 1945 ff.
Die Kriegsgeneration, als skeptisch oder still (silent) charakterisiert, telefonierte mit der Wählscheibe und die Lokomotiven standen unter Dampf. Viele Wörter, mit denen die Babyboomer aufwuchsen, sind heute Grüße aus der Vergangenheit: Schmöker, Schockschwerenot, grüne Witwe, Ausputzer, Schrapnelle, Kassenschlager, Greenhorn, Blümchenkaffee, primanerhaft, Knallerbse, Eigenbrötler, Zinken, Heißmangel, Atzung, um nur diese zu nennen. Meine Eltern kamen als besitzlose Flüchtlinge im Westen an, der Vater mit einer Kriegsverletzung lebenslänglich gezeichnet. Solche Schicksale gab es zuhauf. Diese Menschen, Täter und Opfer im Nationalsozialismus oft in einer Person, gaben nicht auf, sie rackerten sich ab, waren chancenlos, ihre Traumata unter kundiger Hilfe zu bearbeiten. Denn das vertrug sich nicht mit ihrem Lebensmotto: "Man reißt sich zusammen. Man lässt sich nicht gehen." Sie hatten am Ende ihres Lebens ein Stück vom Wohlstand, den Ludwig Erhard versprochen hatte, abbekommen. Vielleicht ein Häuschen, der Garten mit hoher Mauer oder dichter Hecke: Da war man geschützt und sicher.
Die 68er
Und die Kinder, nach dem Krieg geboren, aber vom Krieg geprägt? Sie begehrten auf, wollten frische Luft für sich und die Gesellschaft: "Unter den Talaren Muff von 1000 Jahren". Mit diesem Spruch war die Stoßrichtung der Bewegung auf einen stimmigen Satz gebracht. Kritisiert wurde der autoritäre, unkritische und konservative Geist an den deutschen Hochschulen und dann in der Gesellschaft insgesamt. Gemeint war die mangelnde Aufarbeitung der NS-Zeit und das Fortbestehen alter Machtstrukturen. Die Anspielung auf die 1000 Jahre ist überzeugend.
Der Bewegung der Achtundsechziger werden viele positive Entwicklungen zugesprochen: Frauenbewegung, Umweltbewegung, Friedensbewegung, Dritte-Welt-Solidarität, sexuelle Befreiung.
In dieser positiven Sicht wird über die kritischen Aspekte gnädig hinweg gesehen.
Kehrseite der 68er Bewegung
Erstens war die Bewegung klein (sechs bis acht Prozent der Jahrgänge studierten, davon waren die wenigsten politisch aktiv) und zweitens spielte man gegenüber seinen Eltern und Großeltern die historisch geschenkte moralische Überlegenheit aus, wofür sich mancher, ich eingeschlossen, später schämte, und drittens konnten diese Überbauaktivitäten sich auf die wirtschaftliche Entwicklung stützen, die nicht Verdienst dieser Generation war. Mit Hohn und Spott wurden ausgerechnet diejenigen übergossen, die vermitteln wollten, darunter Emigranten wie Richard Löwenthal, Theodor W. Adorno, Max Horkheimer, um nur diese Beispiele zu nennen. Adorno und Horkheimer hatten mit ihrer Kritik Hilfestellung geleistet, sich aber von den totalitären Anmaßungen distanziert, Löwenthal sprach von einem romantischen Rückfall. Mein Doktorvater Karl Dietrich Bracher, der sich intensiv mit dem Ende der Weimarer Republik beschäftigt hatte, erschrak allein über die Wortwahl. Begriffe wie Schulung und Kader kamen ihm allzu bekannt vor, Dogmatismus, Gewaltbereitschaft und autoritäre Tendenzen sorgten ihn und mit ihm viele andere. Jahre später hat Götz Aly, selber einer der Aktivisten der Achtundsechziger, mit einem "irritierten Blick zurück" manches gerade gerückt, indem er die Methoden und den Wortschatz, die verwendet wurden, mit der jugendlichen Arroganz der Nationalsozialisten verglichen hat. So nannte er dann sein Buch auch "Unser Kampf".
Warum "glückverwöhnt" berechtigt ist
Wer so aufwuchs, im Frieden, in Sicherheit, in Wohlstand und mit ausreichend Arbeitsmöglichkeiten nach Lehre und Studium, den wird man wohl zu Recht als vom Schicksal glücksverwöhnt bezeichnen. Das gilt mit dem Blick nach hinten in die nahe oder ferne Vergangenheit, aber auch zur Seite in andere Länder, wo zur gleichen Zeit Gleichaltrige zumeist chancenlos aufwuchsen. Vielleicht war es Ausdruck dieses Optimismus' hierzulande, dass die Babyboomer mit Babys boomten. Höhepunkt war 1964 mit 1,36 Millionen. 1946 waren es noch 922.000. 2011 gab es einen Tiefstand von 663.000, 2024 waren es mit 677.000 aber auch nicht viele mehr. Diese Zahlen zeigen an, was demografische Herausforderung ist.
Die Babyboomer werden in manchen Betrachtungen nicht als Überbegriff der Generationen 194 bis 1964 gesehen, sondern von den Achtundsechzigern abgesetzt. Dann gelten die Achtundsechziger als Rollenvorbild und bei den Babyboomern wird darauf verwiesen, dass diese als starke Jahrgänge es schwieriger hatten, sich in die Berufswelt einzufädeln. Der Unterschied bleibt aber gering.
Wenn die Eltern dieser Jahrgänge sich nach der statistischen Lebensdauer ihrer Kinder erkundigten, so lautete die Antwort 61 Jahre aufwärts.
Es war also nicht nur so, dass die Avantgarde der Babyboomer mit den Achtundsechzigern als Teilmenge eine sehr aufregende Jugend hatten, die ihnen Kritikbereitschaft und Engagementwilligkeit einpflanzten, sondern diese Generation war die erste, die in den vollen Genuss der geschenkten Jahre kam.
Im Alter "die geschenkten Jahre"
Damit ist gemeint, dass sich die Lebensdauer um 10 bis 15 Jahre gegenüber den Prognosen verlängert hat. Das Alter ist so lang geworden, dass sich eine Unterteilung in die Lebensabschnitte fittes Alter und Hochaltrigkeit anbietet. Das fitte Alter, also die Jahre, die man die Silberjahre nennt, ist überwiegend eine großartigen Zeit, in der die Betroffenen die Entpflichtung aus dem Arbeitsleben in der Regel rasch und erfolgreich gemeistert haben."Die letzten zehn Jahre waren", schreibt ein befreundeter Landwirt, " die zweitbesten meines Lebens nach der Studienzeit." Und dann? Die ersten Babyboomer der jüngeren Jahrgänge gehen auf die 80 zu oder haben sie überschritten. Hier müssen sie mit der Richtigkeit des Satzes leben lernen: "75 ist das neue 60, aber 90 ist nicht das neue 75".
Die Zweiteilung des Alters ist fragwürdig
Allerdings unterschlägt die grobe Zweiteilung, dass das Leben zumeist differenzierter verläuft. Der holländische Arzt und Autor Rudi Westendorp hat eine Einteilung in Vorsorge, Multimorbidität, Gebrechlichkeit und Abhängigkeit vorgeschlagen, wobei in der Praxis die einzelnen Phasen keineswegs trennscharf sind. Was mir an" dieser neuen Lebenstreppe", von der der Autor spricht, gefällt, ist die Durchlöcherung der Grenzziehungen zur Hochaltrigkeit. Es ist doch wichtig, die gewohnte Zweiteilung des Alters zu kritisieren. Eine aktuelle repräsentative Umfrage 80+ der Universität Köln mit dem Deutschen Zentrum für Altersfragen zeigt den ausgeprägten Wunsch der Alten, weiterhin in die Familie und in die Gesellschaft hineinzuwirken´. Dem Großteil der Befragten sind verschiedene Formen der Sorge um und für die jüngere Generation wichtig. Sie möchten ihnen soziale Werte vermitteln (83 Prozent, ein Vorbild sein: 78 Prozent, ihre Erfahrung weitergeben: 77 Prozent). Und – hier sind die Babyboomer mit den Achtundsechziger gefordert – alle Studien zeigen, wer sich trotz Beeinträchtigungen weiter sozial engagiert, fühlt sich besser. Ein sozial aktives Leben als auch das Verfolgen von sozialen Zielen, heißt es in einer Untersuchung, stehen mit höherem Wohlbefinden in der letzten Lebensphase in Verbindung.
Auch sind tröstliche Fortschritte der Medizin und der Sterbensbetreuung unübersehbar. Wieder im Vergleich mit Vorgenerationen oder Generationsgenossen in weniger reichen Teilen der Welt sind auch die Hochaltrigen glücksverwöhnt.
Die Sache mit dem Pessimismus
Wer jetzt auf Ausnahmen verweist, auf Armut, soziale Ausgrenzung, Krankheit oder in der damaligen DDR auf politische Verfolgung, um nur diese Stichworte zu geben, hat Recht. Generationsbetrachtungen sind notgedrungen Verallgemeinerungen. Aber wenn die Zuschreibung überwiegend zutrifft, ist damit gegen Nörgelei und Zukunftspessimismus ein dickes Fragezeichen gesetzt.
Laut einer Forsa-Erhebung glauben 46 Prozent der Befragten, in zehn Jahren schlechter zu leben als heute, während nur 17 Prozent eine Verbesserung erwarten. Der Pessimismus sei in Deutschland besonders ausgeprägt. Zur Vollständigkeit des Bildes gehört der Blick auf das Optimismus-Paradox. Darunter versteht man die Differenz zwischen der Einschätzung der persönlichen Zukunft und der Zukunft des Landes. Da gibt es zurzeit eine 21-prozentige Differenz. Nur wenn die Entwicklung des Landes weiter negativ verläuft, werden beide Sichten zusammenfließen.
Ein Thema, das im Rahmen dieses Beitrags nur zu streifen ist, ist die demografische Herausforderung, die durch die Babyboomergeneration, die nun verstärkt die Vollbeschäftigung verlässt, wächst. Die dadurch ausgelösten Folgen könnten, darauf weist der Frankfurter Altersmediziner Johannes Pantel hin, Schatten auf das in den letzten Jahren aufgehellte Altersbild werfen. Er nennt sein Buch "Der kalte Krieg der Generationen". Aber im Untertitel öffnet er die Tür zu einer positiven Entwicklung "Wie wir die Solidarität zwischen Jung und Alt erhalten".
Mit dem Optimismus, der Rotarier auszeichnet, sollten wir uns die Aufforderung des Zukunftsforschers Matthias Horx zu Eigen machen: "Stellen Sie sich vor, in der Zukunft würde alles immer besser werden."
Damit ist der Wunsch ausgesprochen, dass auch die folgenden Generationen sich gegen Ende ihres Lebens als glücksverwöhnt bezeichnen möchten.
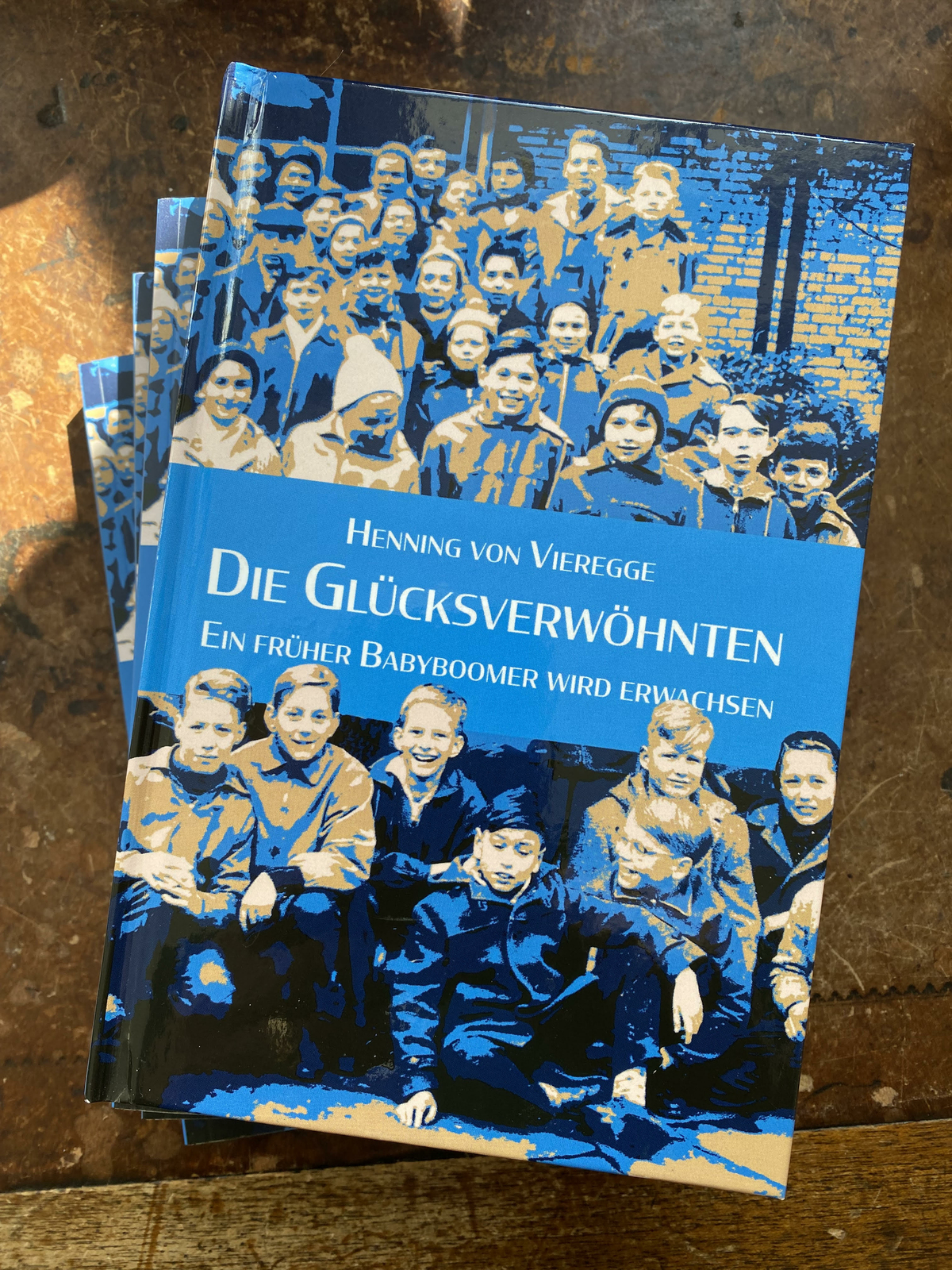
Publikationen:
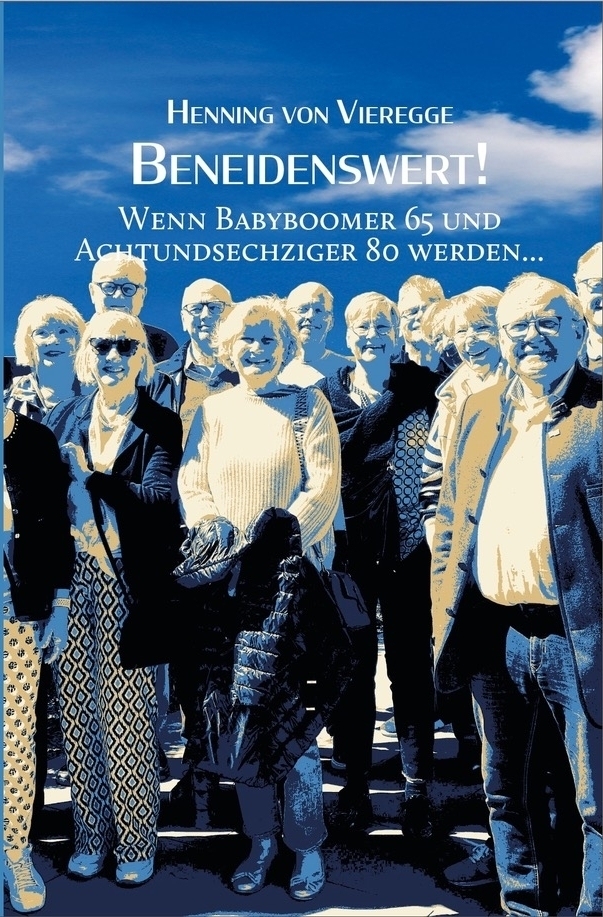
Henning von Vieregge: Die Glücksverwöhnten – Ein Junger Babyboomer wird erwachsen, epubli, Wiesbaden 2025,
Henning von Vieregge: Beneidenswert – Wenn Babyboomer 65 und Achtundsechziger 80 werden, epubli, Wiesbaden 2025
Flyer zu den Büchern: HIER

Copyright: privat vonvieregge.de
Weitere Artikel des Autors
10/2025
Ab auf die Agenda: Rotary im Alter
11/2024
Interne Vorträge schaffen Nähe
1/2024
Meetings im Mix-Modus
8/2023
„Ein eindrucksvolles Zeichen der Versöhnung“
6/2022
Keine Aktion ohne Reflexion
1/2022
Mehr Aufmerksamkeit schafft Relevanz
Immer mal wieder aufbrechen
Was Rotary zusammenhält und relevant macht
1/2021
Rotary ist ein Stück Heimat
RI-Präsident steht Rede und Antwort
Mehr zum Autor







