Forum
Zigaretten unterm Rock
Zu jedem ihrer Nachbarn haben die Österreicher ein bemerkenswertes Verhältnis von Aversion und Sympathie – auch zu Ungarn und Italien. Teil zwei eines Grenzgangs in drei Teilen
Am 27. Juni 1989 trafen unweit des burgenländischen Grenzortes Klingenbach der österreichische Außenminister Alois Mock und sein ungarischer Amtskollege Gyula Horn zusammen. Der katholische Konservative Mock und der reformorientierte Kommunist Horn waren mit großen Drahtscheren ausgestattet und gingen gemeinsam daran, ein Stück dessen zu zerschneiden, was als Eiserner Vorhang bezeichnet wurde. Das Foto, das sie zeigte, wie sie in unwegsamem Gelände Hand an den Stacheldraht legten, ging um die Welt. Es wurde zum Symbol, dass die Grenze, die Europa mehr als vier Jahrzehnte unüberwindbar getrennt hatte, bald überall niedergerissen werden würde.
Wenige Wochen später kam es zum „Paneuropäischen Picknick“, an dem ungarische Friedensaktivisten und österreichische Angehörige der Paneuropa-Bewegung, ungehindert von Grenzwächtern, ein größeres Stück des Zaunes niederrissen und einander als Freunde begrüßten. Die Gelegenheit nutzten damals 700 Bürger der DDR, um über die Grenze nach Österreich zu flüchten. Das war der Anfang vom Ende der DDR und einer der wichtigsten Schritte, die zum Zusammenbruch des Ostblocks führten.
Viele Arbeitskräfte aus Ungarn
Für Österreich und Ungarn war die Öffnung der Grenze so etwas wie die Wiederherstellung der sinnvollen historischen Ordnung. Denn das Reich der Habsburger hatte sich nach dem sogenannten „Ausgleich“ von 1867 staatsrechtlich ja als „österreichisch-ungarische Monarchie“ verstanden, in der die eine Hälfte unter der Verwaltung der ungarischen Magnaten stand. Dass es zu dieser „Doppelmonarchie“ kam, wurde später zur operettenhaften Idylle verklärt, war jedoch Folge langjähriger Auseinandersetzungen. Ungarn hat über seinen Teil der Monarchie, also über Länder und Regionen, die heute zur Slowakei, zu Polen, zur Ukraine, zu Rumänien, Serbien und Kroatien gehören, mit energischem Nationalismus geherrscht. Und somit den Zerfall der Monarchie, die „übernational“ konzipiert war und nur als Union gleichberechtigter Nationen und Nationalitäten eine Zukunft hätte haben können, beschleunigt.
Das Burgenland, das östlichste und einst ärmste Bundesland Österreichs, zählt zu den Regionen, die von der Europäischen Union am meisten profitiert haben. Seitdem 2004 auch Ungarn Mitglied der Union wurde, gibt es im Burgenland vermutlich keine einzige Tankstelle, kein Gasthaus, keinen Handelsbetrieb mehr, die nicht auf ungarische Arbeitskräfte setzen würden. Die österreichischen Kunden und Gäste schätzen es, sich von charmanten Ungarn bedienen zu lassen, und schimpfen dann gerne über sie, weil sie „unseren Leuten“ die Arbeit wegnähmen. Die Ungarn werden freilich noch lange nach Österreich zur Arbeit kommen, denn was Löhne und Gehälter, kurz: den Lebensstandard seiner Staatsbürger betrifft, ist ihr Staat trotz der Milliarden, die die Union für das Wohlwollen des Präsidenten Viktor Orbán springen ließ, in 20 Jahren weit hinter Tschechien, der Slowakei, den baltischen Staaten und Slowenien zurückgeblieben.
Das Schmugglerörtchen Tarvisio
Die Lieblingsgrenze der Österreicher lag lange im Süden des Landes und wurde vom italienischen Ort Tarvisio gebildet. Als in der Ära des Wirtschaftswunders immer mehr Österreicher, Deutsche, Niederländer ihren Urlaub an den Badeorten der Adria verbrachten, wurde dieses Städtchen zur europäischen Metropole des Urlaubsschmuggels. Diese bestand aus einem riesigen, krakenartig sich ausbreitenden Markt, an dem die heimkehrenden Touristen sich mit allem eindeckten, was ihnen für das schöne Italien galt: mit den mit Bast umwickelten bauchigen Flaschen des industriellen Chianti-Weines, mit allerlei Tand und Souvenirs und vor allem mit Waren, die in Italien, als Europa noch keine Zollfreihandelszone war, viel günstiger waren als zu Hause, mit Lederjacken, Taschen und Schuhen.
Die österreichischen Zöllner konnten angesichts der nie abreißenden Kolonne von Autos nur eine Art von symbolischer Repräsentanz zeigen und kontrollierten vielleicht jeden 20. Wagen. In diesem saß meist ein Vater hinter dem Steuer, mit Schweißperlen im Gesicht, weil er bei brütender Hitze drei Lederjacken übereinander trug, die sonst zappeligen Kinder im Fond hielten sich kerzengerade auf Schuhschachteln oder der schicken Ausgehtasche der Mama, die wiederum unter ihrem langen Rock zwei Stangen Zigaretten zwischen ihre Schenkel presste.
Der Halt in Tarvisio war gewissermaßen der krönende Abschluss des Urlaubs, und wer ganz ohne geschmuggelte Kleinigkeit nach Hause kam, der war gar nicht wirklich in Italien gewesen. Heute braucht kein Reisender mehr italienische Schuhe, französischen Wein, belgische Schokolade zu schmuggeln, überall gibt es alles und überall alles fast zum selben Preis. Das hat den alten, auf ihre Weise ehrenwerten Schmugglerorten an der Grenze den schnellen Untergang gebracht.
Streitpunkt Südtirol
Wie vielenorts auf der Welt wurden auch die Grenzen zwischen Österreich und Italien in Kriegen gezogen. Vor allem jene, die Nordtirol seit 1918 von Südtirol trennte, sorgte jahrzehntelang für Konflikte. In Alto Adige, wie er Südtirol nannte, hatte der italienische Faschismus eine brutale Politik der Italienisierung betrieben, die Mussolini übrigens von Hitler ausdrücklich zugestanden wurde. Um Südtirol tat es auch vielen Österreichern leid, die nicht als Chauvinisten gelten konnten, wie es hingegen zweifellos auf jene Rechtsradikalen zutraf, die die Südtiroler „Bumser“, die in den 50er Jahren mit Bombenattentaten die Loslösung von Italien betrieben, unterstützten.
In den Jahrzehnten danach errang Südtirol eine Autonomie, die im Maßstab der europäischen Minderheitenpolitik vorbildlich ist. Diese Autonomie ist weitreichend, aber nicht für alle Zeiten gesichert. Gerade die italienischen Rechtspopulisten, mit denen sich die österreichischen Rechtspopulisten sonst gerne verbrüdern, sind bemüht, die Autonomie einzuschränken. Dass sie den einen zu weit geht und den anderen zu wenig weit, ist fast schon tröstlich: Man erkennt daran, dass Nationalisten, sosehr sie einander weltanschaulich ähneln, nicht fähig sind, längerfristige Allianzen zu bilden, entzweien sie sich doch zuverlässig über jede Region, auf die sie beide glauben, historische Ansprüche erheben zu dürfen.
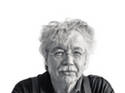
© Kurt Kaindl
Weitere Artikel des Autors
Melange der Völker
9/2025
Hassliebe
8/2025
Treue ohne Grenzen
7/2025
Go west
6/2025
Katamaran statt Theaterzug
4/2025
Europäischer geht’s kaum
3/2025
Und ewig tanzt die Republik
2/2025
Sympathisch unpünktlich
10/2022
Meine moldawische Sehnsucht
Mehr zum Autor







