100 Jahre Rotary Österreich
Go west
Zu jedem ihrer Nachbarn haben die Österreicher ein bemerkenswertes Verhältnis von Aversion und Sympathie – auch zu Deutschland, Liechtenstein und der Schweiz. Letzte Episode eines Grenzgangs in vier Teilen
Von der Stadt Salzburg nach Freilassing sind es nur wenige Kilometer. Als ich hier aufwuchs, fuhr ein städtischer Linienbus bis zur Grenze, wo die Fahrgäste ausstiegen, auf der österreichischen Seite ein Grenzhaus betraten, dem deutschen Beamten den Pass zeigten und das Gebäude auf der anderen Seite verließen. Dort bestiegen sie einen bayrischen Bus, der sie zu den Kaufhäusern Freilassings brachte, die schon auf ihre österreichische Kundschaft warteten. Denn der kleine Grenzverkehr diente ausschließlich dem alltäglichen Schmuggel. Während die Deutschen in Salzburg vornehmlich einen Luxusartikel kauften, der wegen einer 1948 eingeführten Steuer in ihrem Land viermal so teuer war wie in Österreich, nämlich Kaffee, kauften die Österreicher nahezu alles, was sie kriegen konnten. Denn Deutschland war uns im Aufstieg zum Wirtschaftswunderland immer ein paar Schritte voraus, sodass die Salzburger Hausfrauen sich über der Grenze regelmäßig mit Lebensmitteln oder kleineren Haushaltsgeräten eindeckten.
In den 60er Jahren ging der massenweise Schmuggel zurück, mit dem Beitritt Österreichs zur Europäischen Union war es um ihn geschehen. Bei den Studenten meiner Generation, von denen etliche sich billigere Zimmer oder Wohnungen in Freilassing gesucht hatten, waren zwei dortige Wirtshäuser populär, die noch heute viele Salzburger besuchen – und beide haben sie sprechende Namen: „Das Zollhäusl“ und „Der Schmuggler“.
Lange Grenze, lange Staus
Österreich und Deutschland trennt und verbindet eine Grenze von 817 Kilometern. Sie verläuft vornehmlich zwischen dem Freistaat Bayern und den Bundesländern Oberösterreich, Salzburg, Tirol, Vorarlberg; nur ganz im Westen, wo der Bodensee eine nicht eben umkämpfte, aber im Verlauf noch immer strittige Grenze bildet, liegt auf deutscher Seite Baden-Württemberg.
Die geografische Lage bringt es mit sich, dass zwei Autobahnen und Zugstrecken, die von Deutschland nach Österreich – und umgekehrt – führen, zu den wichtigsten Nord-Süd-Verbindungen Europas gehören: Über den Walserberg bei Salzburg geht es zur Adria und auf den Balkan hinunter, über das bayrische Kiefersfelden und Kufstein in Tirol gelangen die Kolonnen von Autos sowie zahlreiche Züge mit Touristen und Frachtgut zum Brenner und über diesen nach Italien. Gibt es hier Verzögerungen, sei es, weil die Anrainer in Tirol gegen die „Transithölle“ protestieren oder die deutsche Regierung beschließt, wieder Grenzkontrollen einzuführen, um die illegale Migration nach Deutschland zu erschweren, dann wird die Situation rasch dramatisch: Kilometerlange Staus, stundenlange Wartezeiten, allgemeiner Unmut bei Urlaubern, Frächtern und nicht zuletzt bei den Berufspendlern.
Weniger betroffen sind davon jene Österreicher, die in Deutschland ihren Wohnsitz haben, und die Deutschen, die in Österreich ansässig sind, von Berufs wegen, zum Studium oder um hier schöne Pensionsjahre zu verbringen. 239.519 Deutsche waren im Januar 2025 amtlich in Österreich gemeldet, das klingt für deutsche Ohren nicht viel, macht sie aber zur größten Gruppe ausländischer Staatsbürger. Umgekehrt leben und arbeiten etwa gleich viele Österreicher in Deutschland, was sie innerhalb der deutschen Statistik nur als marginale Gruppe erscheinen lässt.
Das Fürstentum Liechtenstein
Mit den Deutschen und den Liechtensteinern verbindet die Österreicher die gemeinsame Sprache der Bevölkerungsmehrheit. Die Familie Liechtenstein war mit ihren Gütern in Böhmen und Mähren die reichste aristokratische Dynastie der Donaumonarchie. Im Vergleich zu den notorisch überschuldeten Habsburgern war sie so wohlhabend, dass sie in Wien über eine goldene Kutsche verfügte, die den Wagen des Herrscherhauses an Prunk demonstrativ überbot. Zu ihrem eigenen Staat, dem sie ihren Namen gab, brachte sie es durch Länderkauf im Jahr 1719, sodass sie den Verlust ihrer böhmischen und mährischen Latifundien durch den Zusammenbruch der Donaumonarchie als Herrscherfamilie von Liechtenstein überstand.
Die Grenze zwischen Österreich und Liechtenstein ist nur 35 Kilometer lang, am Übergang zwischen Feldkirch in Vorarlberg und Mauren in Liechtenstein finden keine Personenkontrollen statt, weil das Fürstentum, wiewohl kein Mitglied der EU, dem Schengen-Abkommen beigetreten ist. Liechtenstein liegt mit dem Bruttoinlandsprodukt pro Kopf an erster Stelle der Welt. Aus Vorarlberg pendeln täglich rund 9000 Österreicher zur Arbeit nach Vaduz, Schaan oder Triesen, die ihr Einkommen aber nicht im reichsten Land der Welt, sondern lieber in der Heimat ausgeben.
Neidischer Blick in die Schweiz
Die Grenze zur Schweiz erstreckt sich auf 166 Kilometer zu Land und rund 14, die im Bodensee verlaufen, und wie an den Übergängen zu Liechtenstein finden keine Personenkontrollen statt. Österreich und die Schweiz haben vieles gemeinsam, die Größe, die Einwohnerzahl, das gebirgige Gelände, den Reichtum an Seen – und die zunehmend kontrovers diskutierte „Neutralität“. Aber sie unterscheiden sich auch in manchem: Die Schweiz ist als eine der ältesten Republiken im Kampf gegen die Habsburger entstanden, die hier im 11. Jahrhundert ihre erste Stammburg errichteten. Österreich war bis ins 20. Jahrhundert eine Monarchie, die sich vom Stammland des Herrscherhauses im Westen abwandte und immer weiter in den Osten und Südosten Europas vordrang. Die deutsche Sprache verbindet, aber das gesprochene Schwyzerdütsch ist den Nachbarn unverständlich, abgesehen davon, dass in der Schweiz noch drei weitere Staatssprachen existieren. Mit Bewunderung und Neid sehen viele Österreicher und Österreicherinnen auf die „direkte Demokratie“, die in der Schweiz mittels zahlreicher Abstimmungen und Befragungen praktiziert wird, während diese in Österreich kaum über Traditionen verfügt und Plebiszite häufig weniger aus demokratischen Gründen, denn zu populistischen Zwecken angestrebt werden.
Rund 67.000 Österreicher und Österreicherinnen sind in den letzten Jahrzehnten westwärts gezogen, um in der Schweiz ihr Glück zu suchen. In der gleichen Zeit sind etwa doppelt so viele Menschen aus Ungarn ebenfalls westwärts aufgebrochen, in der Hoffnung, ihr österreichisches Glück zu finden.
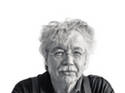
© Kurt Kaindl
Weitere Artikel des Autors
11/2025
Der Roma langer Kampf
Melange der Völker
9/2025
Hassliebe
8/2025
Treue ohne Grenzen
6/2025
Katamaran statt Theaterzug
5/2025
Zigaretten unterm Rock
4/2025
Europäischer geht’s kaum
3/2025
Und ewig tanzt die Republik
2/2025
Sympathisch unpünktlich
10/2022
Meine moldawische Sehnsucht
Mehr zum Autor







