Titelthema
Sympathisch unpünktlich

Als tüchtig, pünktlich und zuverlässig galten die Deutschen einmal. Dass es damit vorbei ist, ist für unser Verhältnis gar nicht einmal schlecht.
Das Jahr 2005 fing gut an in Österreich. Denn auf einmal waren in Stadt und Land überall die Deutschen da. Und nicht etwa nur als Touristen, wie man sie schon seit Jahrzehnten kannte und denen man in den Ski-, Seen- und Wandergebieten sowie kleinen und größeren Städten begegnete. Nein, das Sensationelle war, dass auf einmal Abertausende Deutsche nicht auf Urlaub in Österreich waren, sondern um hier zu arbeiten. Und zwar in Restaurants, Hotels und etlichen Dienstleistungsbranchen, kurz: Sie waren ins Land gekommen, um den Österreichern zu Diensten zu sein. Nie waren die Deutschen in Österreich populärer als damals.

Hören Sie hier den Artikel als Audio!
Einfach anklicken, auswählen und anhören!

In Deutschland war die Arbeitslosigkeit in den ersten Jahren des neuen Jahrtausends so hoch wie schon lange nicht, und von den fast fünf Millionen Arbeitslosen hatte sich ein zwar kleiner, aber in einem kleinen Land wie dem meinen spürbarer Prozentsatz nach Österreich aufgemacht. Ich erinnere mich an eine junge Kellnerin in einem abgelegenen Ort im Salzburger Pinzgau, die sich sprachlich noch schwertat mit ihren österreichischen Gästen. Eine aufgeweckte, selbstbewusste Frau mit grellbunt gefärbtem Haar, hat sie auf meine indiskrete Nachfrage geradezu dankbar zu erzählen begonnen und verraten, dass sie aus der Gegend von Apolda stamme. Was für ein poetischer Name, „Apolda“ klingt doch fast nach einem Märchen! Ich hatte von dieser Stadt in Thüringen noch nie etwas gehört, aber sie war, wie ich jetzt erfuhr, bedeutend genug, sogar eine eigene „Gegend“ rundherum zu haben, also der Mittelpunkt einer kleinen Welt zu sein, aus der es diese tüchtige Frau hierher in eine andere kleine Welt verschlagen hatte.
Manche Österreicher und Österreicherinnen schienen es zu genießen, einmal von Deutschen bedient zu werden, die sonst touristisch beständig als zahlende Gäste umworben und als solche zufriedengestellt werden mussten. Endlich durfte man ihnen sagen: Merkt es, jetzt müsst ihr für uns hackeln! „Hackeln“, sei hier eingefügt, heißt in Österreich umgangssprachlich so viel wie in Deutschland „malochen“. Vielleicht hat, wer malocht, eine etwas schwerere Arbeit zu erledigen als der, der bloß hackelt, aber auch der Hackler arbeitet in einem Job, den er nicht aus Freude an der Tätigkeit angenommen hat, sondern weil er Geld verdienen muss. Übrigens: Das berühmte Aperçu, dass es die gemeinsame Sprache sei, die die Österreicher und die Deutschen voneinander trenne, wird notorisch Karl Kraus zugeschrieben. Es konnte jedoch nirgendwo im vieltausendseitigen Werk des Satirikers aufgefunden werden und dürfte ein Importgut aus England sein, wo das Bonmot, dass Briten und Amerikaner einander wegen ihrer gemeinsamen Sprache nicht verstehen können, ebenfalls sehr populär ist.
Heute haben mehr als 230.000 Deutsche in Österreich ihren Wohnsitz. Die einen, weil sie ihn sich leisten können und es schön finden in meinem Land. Die anderen, weil sie hier ihrem Beruf, Gewerbe, ihrer Arbeit nachgehen. Damit stellen sie die größte migrantische Gruppe, vor den Rumänen, Türken, Serben und Ungarn, sie sind aber die einzigen, die niemand in Österreich je als Migranten bezeichnen würde. Was die Österreicher an den Deutschen bewundern, was sie befremdet und worüber sie staunen, das verändert sich und ist kurzfristigen Schwankungen ausgesetzt, wiewohl sich auch manches alte Klischee zählebig hält.
Als ich in den 60er Jahren des vorigen Jahrhunderts in Salzburg aufwuchs, war es noch üblich, Tugenden und Laster zu nationalisieren. Die Gemütlichkeit wurde als spezifisch „österreichische Gemütlichkeit“ geschätzt, die Lebenskunst galt als italienische Begabung, die Sparsamkeit gehörte den Schweizern, die Liebes- wie die Kochkunst waren in Frankreich zu Hause. Und auf was sonst konnte man in Europa bauen, wenn nicht auf die „deutsche Tüchtigkeit“, „deutsche Pünktlichkeit“, „deutsche Zuverlässigkeit“? In jedem Lob lag hörbar nicht nur Bewunderung, sondern auch ein gewisses Ressentiment.
Die deutsche Tüchtigkeit war jedenfalls nicht nur ein Vorurteil, sondern in bestimmten Feldern eine reale Tatsache, wenn man nur an die Qualität der industriellen Produktion denkt. Auf anderen Feldern, wie dem des Fußballs, wurde sie hingegen beklagt, etwa wenn ein englischer Fußballstar in seiner bekannt gewordenen Definition behauptete, dass Fußball ein einfaches Spiel sei, bei dem am Ende immer Deutschland gewinne. Das heißt, die Deutschen mochten manchmal schlecht spielen, waren aber tüchtig genug, trotzdem zu gewinnen (und zwar nicht nur im Sport). Und heute? Können sie gut spielen und trotzdem verlieren. Der in vielen Sphären evidente Verlust an Tüchtigkeit hat ihnen allenthalben Sympathie eingetragen.
Als Vorbild oder Schreckbild der Effizienz taugen die Deutschen den Österreichern schon lange nicht mehr. Von der zuverlässigen Unpünktlichkeit der Deutschen Bahn brauche ich hier nichts zu sagen, es hieße Eulen nach Berlin oder Düsseldorf zu tragen. Früher galten die Deutschen als ungeduldig, alles sollte schneller gehen, und immer wussten sie, wie sich das bewerkstelligen ließe. Wer heute von einer Reise durch Deutschland heimkommt, weiß hingegen von der unerschütterlichen Geduld der neuen Deutschen zu berichten. Er ist Menschen begegnet, die aller Unbill mit Gleichmut begegnen und auch nicht rebellieren, wenn etwa die U-Bahn in Berlin nicht und nicht kommt und die elektronische Anzeige eine halbe Stunde bei der Ankündigung stehen bleibt, dass der Zug in vier Minuten eintreffe. Sie helfen einander und dem Fremden, der sich nicht zurechtfindet, indem sie alle möglichen Apps auf ihren Smartphones haben und für jeden Katastrophenfall mit einer Erklärung und einem freundlichen Rat aufwarten können.
Manchmal schlägt das deutsch-österreichische Verhältnis überraschend um: Im alten Jahr haben die Medien in Österreich noch gerne über die unprofessionelle Ampel-Koalition gespöttelt; schon nach einer Woche im neuen Jahr hatten sie Anlass, den standhaften Nachbarn zu rühmen, bei dem die Brandmauer gegen rechts außen noch hält, während es in Österreich die politische Kultur der Zweiten Republik gerade zu zerlegen scheint.
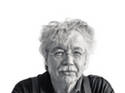
© Kurt Kaindl
Weitere Artikel des Autors
Melange der Völker
9/2025
Hassliebe
8/2025
Treue ohne Grenzen
7/2025
Go west
6/2025
Katamaran statt Theaterzug
5/2025
Zigaretten unterm Rock
4/2025
Europäischer geht’s kaum
3/2025
Und ewig tanzt die Republik
10/2022
Meine moldawische Sehnsucht
Mehr zum Autor







