Forum
Melange der Völker

Sechs nationale Minderheiten genießen in Österreich unveräußerliche Rechte. Doch nur allmählich wächst zusammen, was zusammengehört
Die Volksrepublik China anerkennt in ihrer Verfassung nicht weniger als 56 Volksgruppen. Dass dies für den demokratischen Aufbau des Staates spräche, kann freilich nicht behauptet werden. Denn diese Volksgruppen werden zwar partiell gefördert, aber strukturell unterdrückt. Ob es sich um die Uiguren, Mongolen oder Tibeter handelt – ihre kulturellen oder gar religiösen Eigenheiten werden von der Staatspartei als Hindernis für die fortschrittliche Entwicklung des Landes und als Gefahr für die Einheit des Staates betrachtet; allenfalls in Inszenierungen eines parteikonformen Folklorismus finden sie daher ihren Platz.

Hören Sie hier den Artikel als Audio!
Einfach anklicken, auswählen und anhören!
Dass die Verfassung die Existenz nationaler Minderheiten anerkennt, garantiert diesen also nicht, dass ihre Rechte auf Selbstentfaltung wirklich gewahrt werden. Zweifellos richtig ist jedoch, dass sich Demokratien gerade darin zu bewähren haben, sprachlichen, religiösen, sexuellen und regionalen Minderheiten Schutz und Förderung zu bieten.
Wien und die Ziegelböhmen
Die österreichische Verfassung spricht sechs nationalen Minderheiten unveräußerliche Rechte zu, was eigene Schulen, Amtssprache, zweisprachige Ortstafeln, Medien und mancherlei Ansprüche betrifft. Selbst gebildete und weltoffene Staatsangehörige, die sich politisch jederzeit dafür aussprechen würden, dass Österreich seine Minderheiten schützen solle, tun sich in der Regel schwer, diese ohne längeres Überlegen vollzählig zu benennen: Es handelt sich um die Tschechen, Slowaken, Kroaten, Ungarn, Slowenen und die Roma und Sinti. Sie gelten als „autochthone Volksgruppen“, also als schon lange im Lande lebende Gruppen, deren Geschichte teils weit in die Zeit der Habsburgermonarchie oder gar vor diese zurückreicht. Diesen Volksgruppen wird meist eine regionale Bezeichnung zugesellt, etwa bei den burgenländischen Kroaten und Ungarn, den Kärntner und steirischen Slowenen, den Slowaken und Tschechen von Wien. Das bedeutet, dass sich Schutz und Förderung nicht etwa auf alle Kroaten oder Ungarn beziehen, von denen weit verstreut über Österreich etliche Zehntausend leben, sondern der privilegierte Status der eigenen Volksgruppe jenen vorbehalten bleibt, deren Vorfahren auf einem relativ geschlossenen Territorium sesshaft waren.
Bei den Tschechen und Slowaken handelt es sich überwiegend um Nachfahren jener Arbeiter oder Dienstmädchen, die im 19. Jahrhundert im Zuge der Industrialisierung nach Wien und Niederösterreich zugewandert waren. Weil viele von ihnen in den Ziegeleien im Süden Wiens schufteten, wurden sie summarisch oft als „Ziegelböhmen“ (wienerisch: Ziegelbehm) bezeichnet. Um 1900 war Wien nach Prag die zweitgrößte tschechische Stadt; ohne die wohl 300.000 Ziegelböhmen wäre die Modernisierung Wiens mit ihren städtebaulichen Großprojekten wie der Ringstraße nicht möglich gewesen. Nach dem Zerfall der Monarchie kehrten viele von ihnen in ihre Heimat zurück, wo gerade die „tschechoslowakische Republik“ erstand.
Andere blieben und haben sich gewissermaßen austrifiziert. Die Namen zahlloser österreichischer Politiker verraten bis heute, woher ihre Vorfahren stammten, von den Präsidenten Jonas und Klestil über die Kanzler Kreisky und Vranitzky bis zu vielen Ministern. Nicht nur in der Sozialdemokratie und bei den Konservativen fanden die einstigen Tschechen ihre Heimat, heute glänzt vor allem die ausländerfeindliche FPÖ mit zahlreichen Führungsgestalten, die auf urgermanische Namen wie Vilimsky (Führer der freiheitlichen EU-Delegation) oder Swatzek (stellvertretende Landeshauptfrau von Salzburg) hören und deren Urgroßeltern nach ihrer eigenen Logik eigentlich gar nicht dauerhaft im Land hätten bleiben dürfen.
Sprachliches Erweckungserlebnis
Eine Minderheit der österreichischen Tschechen und Slowaken ist zwar vollständig in die österreichische Gesellschaft integriert, empfindet sich aber weiterhin zugleich der tschechischen oder slowakischen Nationalität zugehörig. Eben aus ihnen bilden sich die beiden staatlich anerkannten Volksgruppen. Sie verfügen in Wien über zweisprachige Kindergärten, Volksschulen, Gymnasien, eigene Zeitungen und Radiosender. Offiziell bekennen sich rund 20.000 Wiener und Wienerinnen zur tschechischen, rund 10.000 zur slowakischen Volksgruppe, die in Wahrheit beide um einiges größer sein dürften.
Bei den burgenländischen Kroaten und Ungarn handelt es sich um zwei Volksgruppen, die jahrhundertelang weit außerhalb ihres einstigen Mutterlandes siedelten. Als die Osmanen im 15. und 16. Jahrhundert den halben Balkan eroberten, flüchteten mehr als 100.000 katholische Kroaten nordwärts, viele von ihnen wurden in durch Seuchen und Kriege entvölkerten Gebieten des heutigen Burgenlands angesiedelt. Ohne Kontakt zum kroatischen Mutterland entwickelten sie eine Sprache, die sich vom heutigen Standard-Kroatisch erheblich unterscheidet: einerseits durch Einflüsse des Deutschen und Ungarischen, andrerseits weil in ihr gleichsam das alte Kroatisch überdauert hat. Ich kenne Schriftsteller aus Zagreb, die davon schwärmen, dass ihnen das fremde Burgenlandkroatisch geradezu ein sprachliches Erweckungserlebnis bescherte, als sie es zum ersten Mal hörten. Auch die Kroaten, denen wohl mehr als die offiziell rund 20.000 Menschen zugehören, klagen freilich, dass ihre Volksgruppe einen langsamen Sprachtod sterbe; einige ihrer bekanntesten Repräsentanten wie der populäre Kabarettist Thomas Stipsits rühmen zwar gerne die Traditionen der burgenländischen Kroaten, geben aber zu, deren Sprache selbst nicht mehr zu sprechen.
All das trifft auch auf die ungarische Volksgruppe zu. Sie lebte, wiewohl heute dem ungarischen Staat benachbart, fast 500 Jahre auf einer isolierten Sprachinsel. Mit der anerkannten Volksgruppe können die Tausenden Ungarn nicht in eins geworfen werden, die 1956 als Flüchtlinge nach Österreich kamen und hier ihre neue Heimat fanden.
Widerspruch und Wahnsinn
Nirgends sind die Rechte einer Volksgruppe so vehement und beständig bekämpft worden wie in Kärnten und der Steiermark, und dies, obwohl schon der Vertrag von Saint-Germain (1919) und neuerlich der Staatsvertrag von 1955 den österreichischen Staat darauf verpflichteten, die Rechte der Slowenen zu beachten. Vielleicht hängt es ja damit zusammen, dass die Slawen in diesem Gebiet schon siedelten, lange bevor die Habsburger hier regierten, ja sogar bevor germanische Stämme ansässig wurden.
Dass Kärnten im heutigen Umfang überhaupt zu Österreich gehört, verdanken die „Deutschkärntner“ ihren slowenischen Nachbarn. Eine ausreichende Zahl von ihnen hat bei der Volksabstimmung von 1920 für die Republik Österreich und nicht für das neu erstandene jugoslawische Königreich gestimmt. Und als im Zweiten Weltkrieg die Alliierten verlangten, dass Österreich seinen eigenen Beitrag zur Befreiung leisten müsse, waren es gerade auch die slowenischen Widerstandskämpfer und Partisanen, auf die das wiedererstandene Österreich nach 1945 in selbstbewusstem Opportunismus verwies.
Es nützte alles nichts. Immer wieder werden in einem engstirnigen wie realitätsfremden „Volkstumskampf“ die Slowenen verdächtigt, Verräter und gar keine zuverlässigen oder echten Österreicher zu sein. Dabei leben gerade in Kärnten und der Steiermark die Menschen schon seit Generationen in einer ethnisch längst unauflöslichen Vermischung. Der berühmteste slowenische Verleger Kärntens trägt den deutschen Namen Wieser, der steirische Landeshauptmann von der FPÖ hingegen den slawischen Namen Kunasek. Wider jede Vernunft wollte Kunasek mit einer seiner ersten Initiativen, die er nach dem Wahlsieg der FPÖ ergriff, die steirische Landeshymne unbedingt in den Verfassungsrang erheben. Und dies, obwohl – oder weil? – schon in der ersten, sprachlich ungelenken Strophe dieser Hymne aus dem Jahr 1844 davon die Rede ist, dass das steirische Heimatland vom Dachstein bis zur Save, von den Alpen bis zur Drava reicht – also große Gebiete der heutigen Republik Slowenien mit drei ihrer wichtigsten Städte, Maribor, Ptuj, Cilli, umfasst. Kinderei? Freude am Zündeln? Dabei hatte man schon fast glauben mögen, dass die Slowenen verspätet endlich so geachtet werden, wie es den Tschechen und Slowaken, Kroaten und Ungarn selbstverständlich ist.
Bleiben die Roma, die 1993 mit einstimmigem Beschluss des Nationalrates als sechste autochthone Volksgruppe anerkannt wurden. Über ihren Sonderfall werde ich ein anderes Mal schreiben.
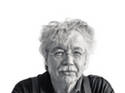
© Kurt Kaindl
Weitere Artikel des Autors
11/2025
Der Roma langer Kampf
9/2025
Hassliebe
8/2025
Treue ohne Grenzen
7/2025
Go west
6/2025
Katamaran statt Theaterzug
5/2025
Zigaretten unterm Rock
4/2025
Europäischer geht’s kaum
3/2025
Und ewig tanzt die Republik
2/2025
Sympathisch unpünktlich
10/2022
Meine moldawische Sehnsucht
Mehr zum Autor







