Aktuell
Die 5. Kolonne Moskaus
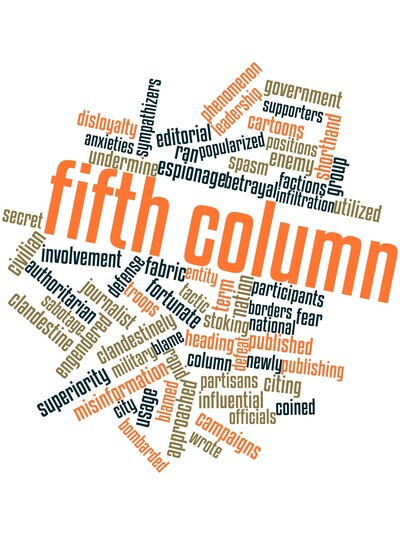
Überlebt die deutsche Russland-Connection die Zeitenwende? Dringend gesucht wird eine neue Russland- und Europapolitik.
Am 8. Mai 2025 meldete die Wochenzeitung Die Zeit: "Unter den Augen des Kreml. Politiker und Lobbyisten treffen sich in Aserbaidschans Hauptstadt Baku mit Kreml-Abgesandten. Mit dabei ist auch ein Geheimdienstaufseher aus dem Bundestag" (Ingo Malcher). An diesem Treffen nahmen folgende Politiker der beiden Regierungsparteien teil: die Sozialdemokraten Ralf Stegner, MdB, der frühere Ministerpräsident Matthias Platzek und auf Seiten der CDU der frühere Kanzleramtsminister Ronald Pofalla, MdB, sowie der frühere nordrhein-westfälische Europaminister Stephan Holthoff-Pförtner. Alle bekräftigen, die Begegnung in Baku habe auf "privater Initiative" beruht und sei "informell organisiert und finanziert" worden. Die Bundesregierung sei in dieser Angelegenheit nicht unterstützend tätig geworden.
In starkem Kontrast zu diesen Beschwichtigungsversuchen stehen jedoch die Namen der Moskauer Teilnehmer dieses Treffens: der frühere russische Ministerpräsident Viktor Subkow und der Vorsitzende des "Menschenrechtsrates" des russischen Präsidenten, Waleriy Fedejew. Beide sind dem russischen Präsidenten Putin und damit auch dem von diesem über viele Jahre politisch und finanziell geförderten deutschen Exkanzler Gerhard Schröder eng verbunden.
Die Verbindungen werfen die Frage nach der Wirkung neuer kremlfreundlicher Netzwerke und moskaufreundlicher Lobbyarbeit in der deutschen Außenpolitik auf. Wie weit reichen die Netzwerke dieser Moskau-Connection und wer sind die Mitglieder dieser "5. Kolonne Moskaus"? Der Begriff wurde 1936 im Spanischen Bürgerkrieg geprägt und bezeichnet der Subversion verdächtige Gruppen, die mit den Interessen einer feindlichen Macht sympathisieren und mit dieser kooperieren. Erinnern wir uns: Der Potsdamer Historiker Bastian Matteo Scianna hat sich in seinem Standardwerk Sonderzug nach Moskau. Geschichte der deutschen Rußlandpolitik seit 1990 auf die Suche nach den politischen Tagträumen und Sehnsüchten der selbsternannten "Russland-Versteher" begeben.
Fehlsteuerung: Die Blindheit der Putin-Versteher
Seit langem hat es in der deutschen Russland-Politik nicht an eindringlichen Warnungen gefehlt: Der damalige deutsche Botschafter in Moskau Klaus Blech hat seine Regierung schon im Jahre 1993 auf die "beunruhigende Bereitschaft (Russlands) zum Einsatz von Gewalt" im "nahen Ausland", also in den Nachfolgestaaten der Sowjetunion, hingewiesen. Dennoch zeigte Putins Werbung um Gerhard Schröder verhängnisvolle Wirkungen: Schröder wurde mit Putins Hilfe Aufsichtsratsvorsitzender des russischen Nordstream-Unternehmens und "ruinierte seinen Ruf" – so der Spiegel.
Bei der Suche nach den Ursachen des außenpolitischen Versagens der politischen Führung stoßen wir rasch auf die von dem französischen Philosophen Bernard-Henry Levy entdeckte 5. Kolonne Moskaus in Deutschland. Schon vor einem Jahrzehnt konnte Levy feststellen, in Europa hätten sich "die Apologeten Russlands zu so etwas wie einer fünften Kolonne formiert. Diese ‚Putin-Partei‘ verkörpere eine gefährliche Entwicklung": Sie verfolge eine Strategie der Destabilisierung und Demütigung Europas. Recht und Gesetz würden in den Dienst von Stärke und Macht gestellt.
Die Russophilie der 5. Kolonne Moskaus reicht im Übrigen weit in die Geschichte des geteilten Deutschlands zurück: So handelt es sich bei dieser Sicht auf Russland in den neuen Bundesländern letztlich um "Echoeffekte" einer jahrzehntelangen politischen Prägung: "Natürlich hat das auch mit 40 Jahren DDR, der Erziehung zu Frieden und Sozialismus unter Führung der großen Sowjetunion" zu tun, so Matthias Brodkorb. Diese Handlungsschranken sind von den verantwortlichen Außen- und Sicherheitspolitikern in den vergangenen zwei Jahrzehnten offensichtlich nur unzulänglich zur Kenntnis genommen und verarbeitet worden. So endete die deutsche Russland-Politik, wie auch der Ukraine-Krieg zeigt, in einem Scherbenhaufen.
Ein Blick gen Osten: Putin-Versteher in der Partei Adenauers
In der CDU wird wieder über die Russland-Sanktionen gestritten. Michael Kretschmer, der sächsische Ministerpräsident, will eine Lockerung der Russland-Sanktionen ins öffentliche Gespräch bringen. Während Putin sich offenbar politische Entlastung von einer Aufhebung der Sanktionen erhofft, bemängeln christdemokratische Politiker in den neuen Bundesländern, über die Lockerung der Sanktionen werde nicht einmal debattiert. Nach Zeitungsberichten haben mehrere CDU-Politiker jüngst wieder über die mögliche Nutzung russischer Pipelines nachgedacht – als ob sie Russlands mörderischen Angriffskrieg gegen die Ukraine völlig verdrängt hätten. In der bequemen Tradition russlandpolitischer Naivität der früheren Regierungen hat der Bundestagsabgeordnete Thomas Bareiß kürzlich verkündet, wenn sich die Lage nach dem Ende des Ukraine-Krieges entspanne, könne "natürlich auch wieder Gas fließen".
Inzwischen rumort es sogar in der Konrad-Adenauer-Stiftung. Der Leiter ihres Moskauer Büros soll geholfen haben, einem Informanten des russischen Geheimdienstes FSB einen Minijob im Bundestag zu vermitteln. Michael Mertes, früherer Mitarbeiter von Bundeskanzler Helmut Kohl, beleuchtet den außenpolitischen Hintergrund solcher Eskapaden: Die Absage Konrad Adenauers an jegliche Schaukelpolitik der Bundesrepublik zwischen Ost und West sei in den ostdeutschen Landesverbänden seiner Partei offensichtlich nicht ausreichend vermittelt worden. Christdemokratische Russlandfreunde scheinen eher Freude an der Tradition deutschnationaler Schaukelpolitik rechter und linker Spielart zu empfinden. Offensichtlich ist es auch den christdemokratischen Regierungschefs in den neuen Bundesländern in den letzten drei Jahrzehnten nicht gelungen, ihren eigenen Wählern die historischen Grundlagen der deutschen Außenpolitik zu verdeutlichen. In dieser Vermittlung liegt daher eine herausfordernde Führungsaufgabe für Friedrich Merz: die Abwicklung der christdemokratischen "Moskau-Connection".
Das Dilemma kollektiver Selbsttäuschung
Man kann das politische Scheitern der deutschen Russlandpolitik auch auf die Eigengesetze einer kollektiven Selbsttäuschung zurückführen. So wiesen außenpolitische Experten in der Regierung und ihren Beratungsinstituten auch in Deutschland schwerwiegende Wahrnehmungsmängel auf, die eine Fehlsteuerung der Russland-Politik begünstigten: Wer zu lange im Amt ist, hört bekanntlich nur noch das, was er ohnehin schon weiß. So entsteht ein Konformitätsdruck, der sich in einer zugespitzten Debatte schließlich zu einem Konformitätszwang auswachsen kann.
Die Bundesregierung jedoch – so ihre parlamentarischen Kritiker –habe von Anfang an Putins aggressive und expansive Drohungen nicht ernst genug genommen und es daher unterlassen, die Armee der Ukraine angemessen auszustatten und wirksam auszubilden. Der Historiker Thomas Speckmann hat diese Malaise der deutschen Verteidigungs- und Russlandpolitik offengelegt, wenn er bemerkt, es sei nicht verwunderlich, dass Deutschland nur schwer dabei in die Gänge gekommen sei, die Ukraine zu unterstützen. Denn Deutschland sei schließlich der einzige westliche Staat, der seine Demokratie niemals gegen eine fremde Macht habe verteidigen müssen. Immerhin haben in der Zwischenzeit einige Außenpolitiker damit begonnen, einen Ausweg aus dieser Malaise zu suchen.
Eine neue Russlandpolitik statt alter Träume
Ausgangspunkt für die Suche nach einer neuen, tragfähigen Positionierung ist die Forderung des früheren Vorsitzenden des Auswärtigen Ausschusses des Deutschen Bundestages Michael Roth: der Aufbau einer europäischen Sicherheitsordnung gegen Russland. In der gegenwärtigen Situation hilft ein Appeasement gegenüber dem russischen Aggressor, der den Westen für verwahrlost und entscheidungsschwach hält, nicht weiter. So scheiterten bisher die deutschen Außenpolitiker auf der Suche nach einer "Modernisierungspartnerschaft mit Russland" krachend. Putin testet Europa und Amerika jedoch mit genau kalkulierten Aktionen der Sabotage und Einschüchterung. Der Westen ist aber nur dann wehrfähig, wenn seine Abschreckung glaubhaft ist.
Die deutsche Russlandpolitik muss zudem nach Jahrzehnten utopischer Irrungen und Wirrungen aus der "Quadratur des Kreises" strategischer Herausforderungen und angemessener Antworten ausbrechen und ihre Interessen in der Verteidigungspolitik genauer festlegen und eine bündnisfähige Allianz mit Frankreich, Großbritannien und Polen eingehen. Nur so wird sich die russische Führung zivilisieren und zu einem kooperativen Verhalten gegenüber ihren Nachbarn bewegen lassen.
Eine neue Vision: die Europäische Verteidigungsunion
Aus der Traumwelt der Russlandversteher ist inzwischen eine Allianz aus pazifistischen Salonsozialisten und russophilen Neofaschisten entstanden, die im politischen Meinungsspektrum Ostdeutschlands sogar die kulturelle Hegemonie erobert hat. In diesem Kulturkampf wird sich die neue Regierungskoalition bewähren müssen.
In dieser Situation hat der frühere Vorsitzende der Münchener Sicherheitskonferenz Wolfgang Ischinger der Europäischen Union einen Ausweg aus der gegenwärtigen weltpolitischen Konfliktlage gewiesen: die Schaffung einer Europäischen Verteidigungsunion (EVU), die Stärkung der europäischen nuklearen Abschreckungskomponente durch die europäischen Nuklearmächte Frankreich und Großbritannien.
Das vom amerikanischen Präsidenten erzwungene Ende der transatlantischen Partnerschaft erfordert erhebliche Umschichtungen im deutschen Staatshaushalt. Für die vordringliche Steigerung der Verteidigungsausgaben sollten daher auch die eingefrorenen russischen Vermögen für die Ukraine verwendet werden. Die strategischen Versäumnisse der letzten Bundesregierungen fallen jetzt der Politik auf die Füße. Die Bundesrepublik Deutschland sollte aber außen- und verteidigungspolitisch wieder politikfähig werden und die Ukraine militärisch so unterstützen, dass Putin unter Druck gerät und in einen Waffenstillstand sowie in Friedenverhandlungen einwilligt.
Die Regierung steht daher vor großen Herausforderungen: Zusammen mit Frankreich, Großbritannien und Polen muss sie im Rahmen des Generationenprojektes der strategischen Autonomie Europas mit den USA als Gegenspieler einen gemeinsamen Abwehrschirm gegen die russische Bedrohung aufbauen und so den autoritären Vormachtansprüchen der Vereinigten Staaten und Russlands entgegentreten. Zu Recht fordert der Abgeordnete Kiesewetter daher gesamtgesellschaftliche Wehrhaftigkeit mit dem Ziel einer integrierten Abschreckung und Verteidigung. Damit müsse ein "Fähigkeitsaufbau in den Streitkräften" und eine Haushaltsplanung einhergehen, die dem Verteidigungshaushalt auf Dauer drei Prozent des Bruttoinlandsproduktes sichere.
Diese Kurskorrektur bietet die Chance, frühere Fehler der Außen- und Verteidigungspolitik zu korrigieren und eine langfristig tragbare Perspektive zu verwirklichen. Dabei geht es um eine umfassende und stimmige Russlandpolitik, den offenen Ausweis von Zielkonflikten sowie ein überzeugendes strategisches Zeichen nach innen und nach außen (Susan Stewart). Nur so kann es Deutschland gelingen, von einer reaktiven zu einer proaktiven Unterstützung der Ukraine überzugehen und in den bevorstehenden Friedensverhandlungen zielführend Vorschläge offensiv zu unterbreiten. Vor allem aber muss es darum gehen, die Bundeswehr so weit personell und materiell auszurüsten, dass diese im Konfliktfall zu wirksamer Verteidigung befähigt ist.
Diese Politik wird gewiss auf beträchtliche Vorbehalte stoßen. Die notwendige strategische Kurskorrektur sollte daher auch im Schulterschluss mit den baltischen Staaten und mit Polen sowie mit den engsten Verbündeten Frankreich und Großbritannien erfolgen. Nur so kann Europa nach dem Ausfall der USA als verlässlicher Partner dem aggressiven, expansiven Russland Einhalt gebieten und auch auf Dauer wirksam begegnen.
Die 5. Kolonne Moskaus ist in den neuen Bundesländern tief verwurzelt. Hier hat die sowjetische Indoktrination in vier Jahrzehnten tiefe Spuren hinterlassen und ist bis heute äußerst wirksam, wie die Einstellung der Meinungsmacher zum russischen Angriffskrieg in der Ukraine zeigt. Dies gilt aber auch für die linke Gruppe der sozialdemokratischen Bundestagsfraktion, deren früherer Vorsitzender Mützenich die sozialdemokratischen Mitglieder der Moskau-Connection beflissen verteidigt: Solche informellen Gespräche könnten spätere offizielle Beratungen "gut vorbereiten". Der Deutsche Bundestag könnte sich daher schon bald vor die Aufgabe gestellt sehen, die Mitgliedschaft des Abgeordneten Stegner im Parlamentarischen Kontrollgremium zur Kontrolle der Nachrichtendienste zu beenden. Zu Recht hat der frühere Vorsitzende des Auswärtigen Ausschusses, Michael Roth, die umstrittene Konferenz in Baku als ein "falsches Treffen zur falschen Zeit am falschen Ort" bezeichnet. Der Bundeskanzler und der Vizekanzler stehen aber vor der Herausforderung personeller Erneuerung und politischer Neuorientierung. Sie tun gut daran, eine Empfehlung aus dem Lehrbuch politischer Strategie und Taktik zu beherzigen: Wer den Sumpf trockenlegen will, sollte nicht als erste die Frösche fragen.
__________________________________________
Der Autor ist Emeritus für Politikwissenschaft der Universität Münster und Verfasser von "Politischer Kurswechsel im Gegenwind. Die Krise politischer Führung in Deutschland", Baden-Baden 2023, sowie "Strategie und Taktik. Ein Leitfaden für das politische Überleben", Baden-Baden 2024 (mit Benjamin Laag).

Paul Kevenhörster (RC Steinfurt) ist Professor emeritus für Politikwissenschaft an der Westfälischen Wilhelms-Universität Münster und Verfasser der Bücher "Strategie und Taktik. Ein Leitfaden für das politische Überleben", Baden-Baden 2024 (mit Benjamin Laag); "Politischer Kurswechsel im Gegenwind. Die Krise politischer Führung in Deutschland", Baden-Baden 2023.
Copyright: Universität Münster
Weitere Artikel des Autors
100 Tage Hoffnung
Nach dem Erwachen: Ein schmerzhafter Kurswechsel
Die Selbstzerstörung der politischen Mitte
Der libertäre Autoritarismus
Neuer Autoritarismus im grünen Gewande?
Von der ewigen Furcht vor autoritärer Bevormundung
Ein neues "Berliner Bündnis"
Der verlegene Vizekanzler: Habeck und seine Hausaufgaben
Nach dem Erwachen
Mehr zum Autor







