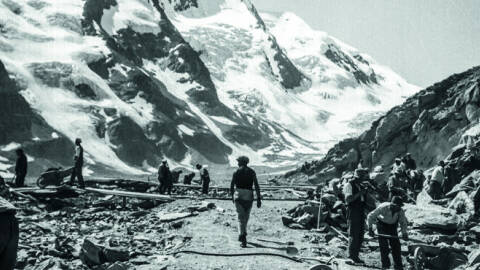Peters Lebensart
Früher gefährlich, heute unentbehrlich
Eine kleine Kulturgeschichte des Apfels
Winterzeit – Bratapfelzeit. Hildegard von Bingen hätte diese Art, Obst zu genießen, sicher gelobt. Frische Früchte hielt sie für gefährlich, nicht nur weil der Apfel der Verführung, den Eva Adam reicht, zur Vertreibung aus dem Paradies führte. Hildegards Rat für die Jahrhunderte: Kocht Apfelmus und Marmeladen, keltert Apfelwein. Und gebt Kindern möglichst wenig rohes Obst. Der Habsburger Kaiser Friedrich III. starb, weil er zu viel Obst mit kaltem Wasser verschlungen hatte. Die gemalten Würmer, die Motten auf barocken Obststillleben belegen es. Die leicht verderblichen Früchte galten als verlockende Symbole des Bösen, die krank machen können!
Andererseits: Frisches Obst schmeckt köstlich, und es entspricht der mittelalterlichen Ernährungstheorie, dass himmelsnahe Speisen wie Vögel oder auf Bäumen Gewachsenes der Hölle am fernsten und somit am reinsten seien. So begannen Klöster und Adlige, Obstgärten und Orangerien anzulegen, in denen seltene Sorten reiften.
Das Apfelparadies Bodensee faszinierte schon Michel de Montaigne. Der weit gereiste französische Philosoph lobte um 1580 gleich dreimal die Äpfel, die er in Lindau vorgesetzt bekam: als Backapfelsuppe, als gekochte Schnitze zum Siedfleisch und als Dessert mit Nüssen. Doch zum Apfelland wurden wir erst im 18. Jahrhundert, als ausgedehnte Streuobstwiesen angelegt wurden. Mit der Erfindung des Rübenzuckers konnte man leichter Kompott und Apfelmus einkochen.
Furchtloser Fan fast frischer Äpfel war bekanntlich Friedrich Schiller, der den säuerlichen Geruch anfaulender Früchte in seiner Schreibtischschublade als inspirierendes Narkotikum schätzte. Doch erst mit der Entdeckung der Vitamine im frühen 20. Jahrhundert kam man wirklich auf den Geschmack rohen Obsts als health food. Heute sind Apfelschnitze zum Müsli Standardfrühstück, Smoothies schaffen den Spagat von Industriesaft und zur Frische. Doch gerade jetzt, wo wir angstfrei den reinen Geschmack frischer Äpfel genießen, dürfen wir nur selten in die köstlichsten, duftendsten beißen.
Bis auf Boskop sind sämtliche gängigen Sorten Neuzüchtungen, ihr wichtigstes Kriterium: Lagerfähigkeit. Nach Äpfeln mit zarter Haut, nach aromatischem Wohlgeschmack muss man lange fahnden. Alte Sorten wie Gravensteiner und Maschanzker, Calville und Reinette, Kronprinz Rudolf oder Steirische Schafsnase sind zu Raritäten geworden, und Landschaftspfleger und Schnapsbrenner, die nicht nur Einheitsobstler destillieren wollen, kämpfen um den Erhalt von Biodiversität, Streuobst- und Hochbaumwiesen. Glücklicherweise gibt es Apfelrebellen wie Eckart Brandt, der für den Erhalt regionaler Klone wie Finkenwerder Herbstprinz kämpft. Doch wie elementar wichtig hierzulande der Apfel wirklich ist, davon können Eltern mit Kleinkind, die ins Ausland reisen, ein Lied singen. Für den Nachwuchs den vertrauten Apfelsaft aufzutreiben, kann sich zur ersten wirklichen Herausforderung des Urlaubs auswachsen.

Peter Peter ist deutscher Journalist und Autor für die Themen Kulinarik und Reise. Er lehrt Gastrosophie an der Universität Salzburg und ist Mitglied der Deutschen Akademie für Kulinaristik. Außerdem schreibt er als Restaurantkritiker der „Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung“ und ist Autor einiger ausgezeichneter Kulturgeschichten der europäischen Küche. Im Rotary Magazin thematisiert er jeden Monat Trends rund um gutes Essen und feine Küche.
pietropietro.deWeitere Artikel des Autors
11/2025
In fast aller Munde – Rote Be(e)te
Kulinarische Polonaisen
9/2025
"Lütt Dirn, kumm man röwer, ick gew’' di 'ne Birn"
8/2025
Wie böhmisch ist die Wiener Küche?
7/2025
Im Takt der Tapas
5/2025
Für Erdbeer-Enthusiasten
4/2025
Die Ästhetik des Essens
3/2025
KI – kulinarische Intelligenz?
2/2025
Neue Lust am Fermentieren
Rein zum Einkehrschwung
Mehr zum Autor