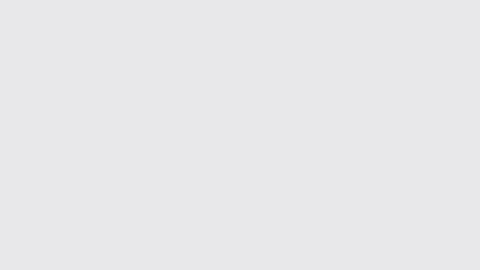Die Rückkehr der Deutschen in den Kreis der zivilisierten Nationen nach 1945 hatte eine wichtige Voraussetzung: sich der jüngeren, schmerzlichen Vergangenheit zu stellen. Das bedeutete nicht, sich leichthin für die Makroverbrechen der NS-Zeit zu entschuldigen. Sondern es kam darauf an, die Realität dieser Verbrechen, ihre Vorbereitung, ideologische Rechtfertigung etc. kritisch zu sehen, sie als Hypothek anzuerkennen und in der nachträglichen Bewusstmachung als Auftrag zu einer „humanen Orientierung“ zu akzeptieren.
In letzter Zeit entsteht der Eindruck, dass diese Fundierung einer wertorientierten Grundhaltung unserer Gesellschaft aus zeitgeschichtlichem Bewusstsein heraus infrage gestellt wird; zum Beispiel, wenn eine „erinnerungspolitische Wende um 180 Grad“ gefordert wird. Dabei war die Aufarbeitung der Vergangenheit niemals unumstritten. Sie war und ist ein Prozess, in dessen Verlauf deutsche Verbrechen ebenso diskutiert wurden wie die an Deutschen begangenen Verbrechen. Die Schwerpunkte lagen mal auf der einen Seite, mal auf der anderen.
Unstrittig war und ist ebenso, dass es eine endgültige Bewältigung der Vergangenheit oder gar einen Schlussstrich nicht geben kann. Nicht zuletzt, weil sich jede Generation aufs Neue fragen muss, welche Lehren aus der jüngeren Geschichte sie ziehen will.
Verschiedene Leidenserfahrungen
Eine große Herausforderung bei der Aufarbeitung der Vergangenheit war die Vielzahl an Opfergruppen der nationalsozialistischen Herrschaft und des von ihr entfachten Krieges. Mit der Wahrnehmung ganz unterschiedlicher Leidenserfahrungen tat sich die Gesellschaft ohne Zweifel in den vergangenen Jahrzehnten oft sehr schwer; schwerer, als es die Rituale des Gedenkens nahezulegen scheinen. Die Sprecher einer jeden Verfolgtengruppe neigten dazu, ihr Leid zu verabsolutieren und zu hierarchisieren. Exklusivitätsansprüche wurden selten zurückgewiesen, sondern vielfach sogar als Voraussetzung für die Herausbildung von Gruppenidentitäten akzeptiert.
Wer hingegen Leidenssituationen verglich, setzte sich schnell dem Vorwurf der Relativierung aus; selbst dann, wenn er nur den Blick auf exemplarische Lebenssituationen lenken wollte. Dabei ist das Leid des einzelnen gar nicht relativierbar. Es steht für sich, so wie das Individuum und seine Würde gerade in der Auseinandersetzung mit dem NS-Staat zum Zentrum des postdiktatorischen, des „freiheitlichen Verfassungsstaates“ geworden ist.
Warum tun wir uns so schwer dabei, uns bewusst zu machen, dass das Elend des Menschen in der Mitte des 20. Jahrhunderts, eines Jahrhunderts der Diktaturen, auf ganz vielfältige Weise kulminierte? Dieses Elend kann durch die Zerstörung Europas, durch die Spaltung des Kontinents, durch die Enthausung und Preisgabe vieler Millionen Menschen charakterisiert werden.
Natürlich stehen all diese Ereignisse im Schatten eines ganz anderen Ereignisses, das wir mit dem Begriff „Auschwitz“ bezeichnen. Aber sie gehen in diesem Ereignis nicht auf. So gesehen stehen seit der Mitte des 20. Jahrhunderts Täter neben Opfern, Verantwortliche neben Mitläufern und Gehorsamen, Angepasste neben Widerständigen. Mehr noch: Täter konnten im Laufe der Zeit zu Opfern werden und Opfer zu Tätern, aus Mitläufern wurden zuweilen Widerständige, und die Verantwortlichen flüchteten sich vielfach in Beteuerungen ihrer Verantwortungslosigkeit. Nicht zuletzt wurden die Gehorsamen, die Befehlsempfänger, oftmals zu Verantwortlichen.
Auch Lebensgeschichten fächern sich breit auf, nach Schichten und politischen Traditionen, nach Konfessionen und Regionen, nach Entwicklungen und Ereignissen, die immer wieder die Struktur der deutschen Gesellschaft verändert haben. Zwei Weltkriege, zwei Niederlagen, zwei Geldentwertungen, Vertreibungen vor und nach 1945, Abtretungen von Landesteilen und Teilungen, schließlich die Spaltung der Nation und ihre keineswegs komplikationslose Vereinigung haben viele Anlässe für eine breite lebensgeschichtliche Erinnerung geschaffen. Es ist einfach nicht zu bestreiten, dass viele Deutsche 1933 die Herrschaft Hitlers begrüßten und manche von ihnen schon wenig später diese Haltung bedauerten. Andere standen nach mehr als zehn Jahren entsetzt vor den Folgen ihrer Illusionen und wurden nun zu Getriebenen, zu Opfern, zu Leidenden. Nur wenn wir im Gedenken auch diese Opfer bewusst machen – ohne demonstratives Selbstmitleid, aber durchaus bewusst im Schmerz über das Verlorene – nur dann werden wir die Grundlagen des Gedenkens sichern.
Geteiltes Gedenken
Unbestreitbar ist, dass gerade die Vielfalt möglicher Erinnerungsbezüge den Deutschen bis heute große Schwierigkeiten macht und die Heftigkeit einer jeden Auseinandersetzung um Denkmale, Museen und Gedenkstätte erklärt. Es stellt sich fast als unmöglich heraus, die Breite der Erinnerungsbezüge zu reflektieren. Der Preis für dieses Unvermögen ist sehr hoch: Er liegt in einer Partialisierung des Gedenkens als Folge einer nur begrenzten Fähigkeit, ganz unterschiedliche Erinnerungsbezüge zu respektieren. Wer sich aber weigert, die Entrechtung und Verfolgung, die Vertreibung und Ermordung von Juden, um ein Beispiel zu nennen, anzuerkennen, weil er stattdessen auf eigene Erfahrungen mit Bombenangriffen und Vertreibung verweist, kann nicht erwarten, dass die Schreckensdimensionen der ganz eigenen Leiden respektiert werden. Wer nur auf das Verbrechen des Völkermords schaut, findet kaum oder nur schwer das Mitempfinden derjenigen, die unter ganz anderen lebensgeschichtlichen Traumatisierungen leiden.
Es ist notwendig, in unserer Gedenkkultur die Partialisierung und Hierarchisierung der Erinnerungen zu überwinden. Wichtiger und angemessener wäre es hingegen, den Blick darauf zu richten, wie wenig in der Mitte des 20. Jahrhunderts dazugehörte, aus dem Mitmenschen den Gegenmenschen werden zu lassen. Ein guter Anlass dazu wäre der 27. Januar, der seit 1996 als Tag des Gedenkens an die Opfer des Nationalsozialismus ein offizieller Gedenktag in unserem Lande ist, in der Öffentlichkeit jedoch zum „Holocaust-Gedenktag“ verkürzt wurde. Warum nehmen wir diesen Tag nicht zum Anlass für ein gemeinsames Gedenken an alle Opfer der ersten deutschen Diktatur?
Gedenktage versöhnen nicht immer. Sie können Konflikte auch zuspitzen, immer neu entbrennen dann Auseinandersetzungen über Grundprobleme einer inszenierten Erinnerung, die man Gedenken nennt und in der sehr leicht die Wirklichkeit der Vergangenheit untergehen kann. Immer wieder beanspruchen dabei die Redner – mehr oder minder engagiert – ein Vermächtnis einzulösen oder gar eine Flamme am Brennen zu halten. Vielleicht nehmen sie wirklich die Hoffnung jener auf, die sich nach 1945 geschworen haben, alles zu tun, um eine Wiederholung dessen, was sich bis dahin in Europa ereignet hatte, zu verhindern. Nicht selten wird das Gedenken aber auch nur als Pflichtveranstaltung zur Erzeugung von Sinnstiftungsangeboten arrangiert. Vielleicht sollten wir uns in der Gedenkpädagogik der Ritualisierung wiedersetzen und häufiger fragen, ob wir in den vergangenen siebzig Jahren die Erwartungen der Überlebenden, die sich ein „Nie wieder!“ geschworen hatten, wirklich in der Weise erfüllt haben, wie wir uns das so gern selbst bestätigen?
Blind für die Gegenwart
Wer sich die großen humanitären Katastrophen der letzten Jahre ansieht, kann diese Frage nur verneinen. So ereigneten sich in den neunziger Jahren der Bürgerkrieg im zerfallenden Jugoslawien, zu Beginn des 21. Jahrhunderts der Darfur-Konflikt im Sudan und zuletzt die Tragödie in Syrien. Vor den Augen der Welt wurden Menschen hunderttausendfach misshandelt, vertrieben und ermordet, ganze Städte und Kulturlandschaften verheert und ausgelöscht. Keiner der Politiker und der Zeitgenossen hatte ein politisches Patentrezept. Viele zerbrachen sich den Kopf, noch mehr zerrissen sich die Münder. Sicher ist nur die Tatsache, dass es unvorstellbare Opfer gibt, die wir nicht verhindern wollten oder nicht verhindern konnten.
Der Balkan-Krieg ist auch heute noch ein eindrucksvolles Beispiel, weil ungefähr zur gleichen Zeit die deutsche Öffentlichkeit über ein zentrales Zeichen der Erinnerung an den Holocaust diskutierte. Doch welchen Wert hat ein Denkmal für die ermordeten Juden Europas, wenn nur wenige hundert Kilometer weiter in Bosnien Mitmenschen vertrieben, vergewaltigt, enthaust, entwürdigt oder gar erschossen werden? Wir, die Zuschauer, sind damals wahrlich tief gesunken, denn alles geschah vor unseren Augen. Die Medien machten uns zu Augenzeugen. Nichts gesehen, nicht gewusst – das ist seitdem keine Entschuldigung.
Gleiches gilt für Darfur und Syrien. Dabei haben wir uns immer wieder eingeredet, aus der Geschichte lernen zu wollen, zu können und zu müssen. Ich beginne zu begreifen, wie der Mechanismus funktioniert, der Menschheitsverbrechen ermöglicht, die Karl Jaspers immer als Verbrechen an der Menschheit beschäftigt haben: Wir sehen das Unrecht zwar, aber wir verdrängen im selben Augenblick das Unbehagen über das Gesehene. Wir machen uns so nicht wirklich betroffen, sondern wir machen vor allem weiter, am liebsten wie bisher. Wir lassen uns gerne in politische Diskussionen über militärische Einsätze und Schutzfunktionen verstricken und akzeptieren zugleich, dass der Begriff des Asylbewerbers aus Kriegsgebieten sehr restriktiv ausgelegt wird. Wie konkret empfinden wir die Not der Vertriebenen? Wer vergleicht ihr Schicksal mit dem der deutschen Vertriebenen, die uns immer wieder durch ihre Demonstrationen an das erlittene Unrecht erinnern?
Haben wir aus der Geschichte gelernt? Wie steht es mit unserer Moral, die angeblich Konsequenz historischer Erfahrung sein soll? Wie steht es mit dem Satz von Camus, es sei eines der größten Verbrechen, Kinder weinen zu lassen; wie mit dem Relativismus von Popper, es sei schon sehr viel, Elend zu verhindern? Haben wir wirklich aus der Geschichte gelernt? Aus Deportationen, aus Vertreibungen, aus der Gewaltanwendung gegenüber der Zivilbevölkerung, die zum Spielball von Militärs wird? Vielleicht ein wenig, mit größerer Sicherheit aber nichts.
Ein kluger Zeitgenosse bemerkte einmal, er verfüge über ein ausgezeichnetes Gedächtnis. Denn er sei in der Lage zu vergessen, was er wolle. Dieser Satz ist witzig gemeint. Und dennoch markiert er einen wichtigen Bezugspunkt jeder Auseinandersetzung mit der Vergangenheit. Denn immer geht es bei der Bemühung um die Vergangenheit nicht allein um zurückliegende Ereignisse, sondern um den aktuellen Willen und die gegenwärtige Bereitschaft, sich der vergangenen Zeiten ungeschönt zu vergegenwärtigen. Nicht selten wird die Erinnerung so zur Herausforderung für die Mitlebenden. Und sie sind es nicht selten, die die Auseinandersetzung mit der Erinnerung erst zum Skandal machen.