Interview
Rummelplatz

Warum ein großer Roman zur Oper wird: Ein Treffen mit Schriftstellerin Jenny Erpenbeck, die das Libretto verfasst hat. Im September feiert das Stück in Chemnitz Premiere.
Einige Risse zeigt der Lack der Stadt Chemnitz in Sachsen schon. Sie hat ihre Berufung zur Kulturhauptstadt Europas in diesem Jahr mit Eifer und Ideen genutzt, um ihre Kratzer loszuwerden. 2018 hatten Rechtsradikale die Stadt durch Hetzjagden gegen Ausländer in die Schlagzeilen gebracht. Mit seinem Kulturhauptstadtprogramm setzt Chemnitz auf positive Überraschungen, will Ungesehenes sichtbar machen. Kultur von Hochkultur bis Alltag, Industriegeschichte und Architektur treten in Hauptrollen auf. Angezogen haben bisher besonders Kunstausstellungen. Zum Beispiel über europäische Realismusbewegungen in der Malerei der 20er und 30er Jahre ("European Realities") im Museum Gunzenhauser und am selben Ort über den legendären Architekten Frei Otto, 1925 in Siegmar bei Chemnitz geboren, der sich mit dem Olympiapark von München ewigen Ruhm erworben hat. Am 20. September ist zur Premiere der für Chemnitz entstandenen Oper "Rummelplatz" von Ludger Vollmer (Musik) und Jenny Erpenbeck (Libretto) geladen. Vorlage ist der gleichnamige Roman von Werner Bräunig. Ein Chemnitzer, Jahrgang 1934.
Stoff des Romans ist die Wismut. Sie war auf DDR-Boden ein Bergbauunternehmen, in dem die Sowjetunion ab 1946 ihren Hunger nach Uran für die Atomwirtschaft gestillt hat. 200.000 Beschäftigte waren es in den Hochzeiten. Sie waren gerade als Nazi-Soldaten aus dem Krieg heimgekehrt oder als Kommunisten aus den Konzentrationslagern. Täter und Opfer also. Sie wollten in der Wismut einen neuen Anfang in einem neuen Staat, suchten Abenteuer und Frauen oder wollten sich einfach verstecken. Die meisten aber sahen das Geld, das man verdienen konnte. Alles andere als leicht verdienen. In diesem Schmelztiegel, wo sich Regeln selbst von russischen Soldaten nur schwer durchsetzen ließen, tat sich etwas. Der Rummelplatz war für den Romanautor Bräunig die große Metapher für ein Wildwest im ostdeutschen Erzgebirge wenige Jahre nach dem Weltkrieg und für die Frage: Wohin geht die Reise?
Bräunigs Figuren waren alles andere als Beispiele für das Bild vom Arbeiter, wie die SED sich ihn ausmalte. Und deshalb wollte sie den Roman nicht. Der Autor wurde um den Erfolg seines Lebens gebracht. Als der Roman 2007 – die DDR gab es nur noch im Rückspiegel – erstmals erschien, hielt man als Literaturkritiker die Luft an, so gut konnte Bräunig schreiben. Da war ein Autor von der Kraft eines Grass, Böll oder Walser um alles gebracht worden. Er schrieb nie wieder einen Roman, begann zu trinken und starb 1976 mit 42 Jahren. Der tragische Tod eines Menschen, der ein außerordentlicher Schriftsteller war.

Aber ist das ein Stoff für eine Oper, Jenny Erpenbeck?
Bräunigs Roman ist zwar Prosa, aber dennoch hochdramatisch. Das fängt schon beim Titel an: Rummelplatz! Wir haben den Rausch, die Betäubung, den Tanz – aber der Rummelplatz steht bei Bräunig auf einem ehemaligen Friedhof. Auf der einen Seite sind da Männer, die einen mörderischen Krieg hinter sich haben, als Täter ebenso wie als Opfer. Die sind an Gewalt gewöhnt und an existenzielle Bedrohung. Auf der anderen Seite gibt es das neue Reglement des frisch gegründeten Staates, und zwar unter verschärften Bedingungen in der Wismut, die ja eine sowjetische Einrichtung war. Da ist noch nichts fertig, da brodelt es. Die ganze Handlung bis hin zum Arbeiteraufstand am 17. Juni, auf den bei Bräunig alles zuläuft, bewegt sich auf dem Grat zwischen Leben und Tod. Die Leute hoffen, und sie sind verzweifelt, sie besaufen sich, sie wollen ein neues Leben und wissen nicht, wie. Also, das ist mehr als genug für eine Oper.
Was ist Ihnen bei der Begegnung mit dem Roman am Text aufgefallen?
Bräunigs Sprache ist ganz und gar außergewöhnlich. Trotz der Härte des Themas ganz poetisch und in die Tiefe gehend. Er macht so Räume auf hinter der Sprache, wie das wenige können, da ist er unglaublich musikalisch. Das merkt man schon auf der ersten Seite, wo er nur beschreibt, wie ein "müder Wind" über das ganze Land hinstreicht. Außerdem hat er damals schon gesehen, dass die Wismut ein Ort ist, an dem man nicht nur persönliche Schicksale erzählen kann, sondern auch Weltgeschichte. Damals drehte sich ja alles darum, ob die Amerikaner oder die Sowjets die Ersten sein würden, die atomwaffenfähiges Uran herstellen können. Und das Uran für die Russen kam aus der Wismut.
Die Kritik am Roman, die schließlich sein Erscheinen verhinderte, bestand im Vorwurf, dass Bräunigs Figuren nicht dem Arbeiterbild in der DDR entsprechen und niemals Vorbilder sein können. War die Trennung von gewünschter Realität und tatsächlicher ein Grundzug der Kunstpolitik in der DDR, soweit sie von der SED gesteuert wurde?
Ich glaube, es ging darum, nach innen ein heiles Weltbild zu erzeugen und nach außen dem sogenannten Klassenfeind keine Angriffsfläche zu bieten. Man setzte große Hoffnung in den positiven Helden als Droge. Und vergaß dabei, dass die Leute doch tagtäglich sehen, was in Wirklichkeit schiefläuft und was für Schwierigkeiten es beim Aufbau dieser neuen Art von Gesellschaft gibt. Ohne die Lügen und die Willkür, die von dieser staatlich verordneten Verdrängung hervorgebracht wurden, hätten die Probleme, die es gab, angegangen werden können. Und angegangen werden müssen.
Für die Arbeit am Libretto war es vermutlich wichtig, die Intentionen des Autors nachzubilden, aber sicher ging es auch darum, den Roman nach seiner möglichen Wirkung für ein heutiges Publikum zu befragen. Welche Gedanken haben Sie zu beidem?
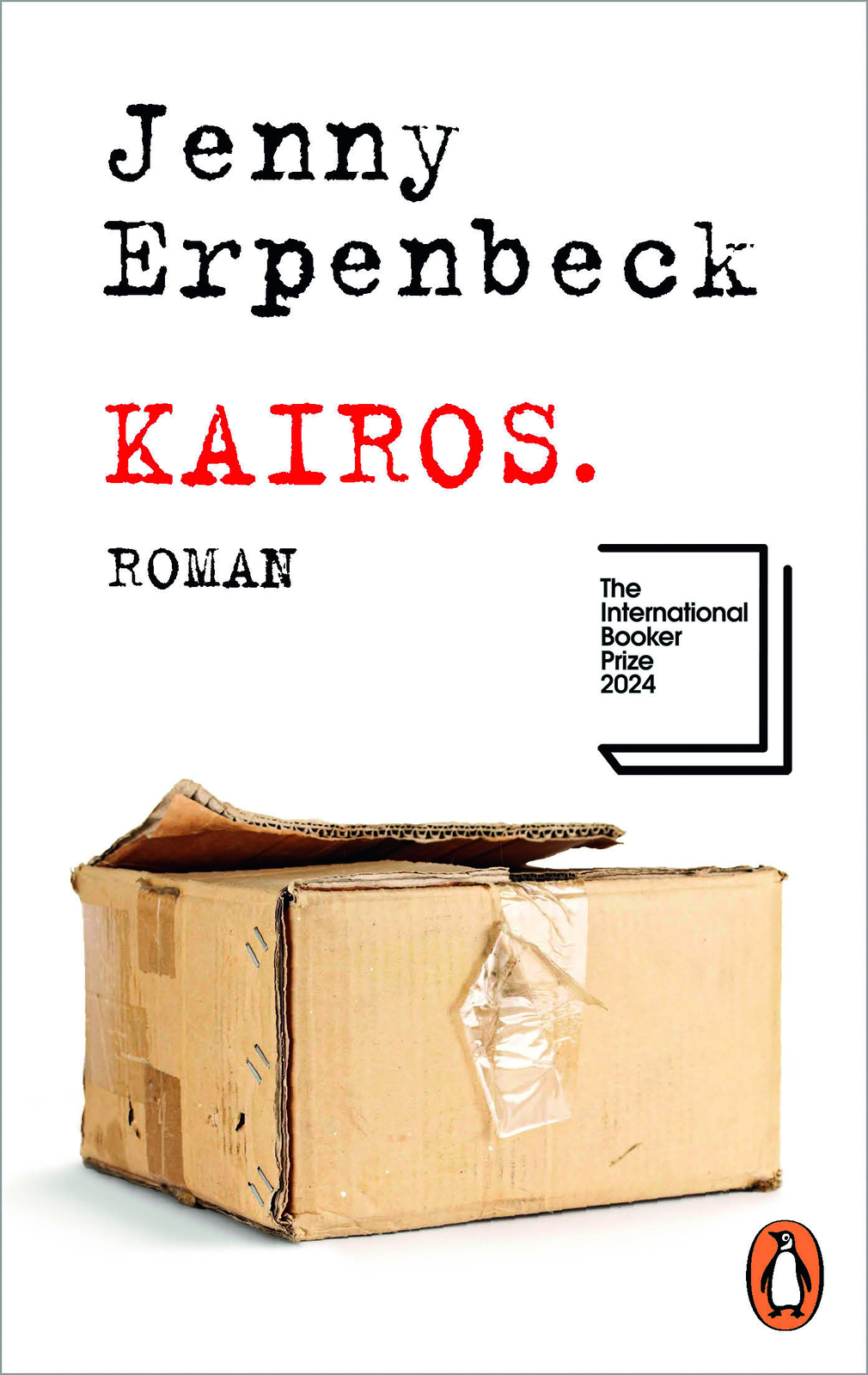
Natürlich muss man Dinge verknappen und enger führen, wenn man 800 Seiten Roman auf 60 Seiten Libretto reduzieren will. Wir haben uns in Hinsicht auf den Spielort Chemnitz dafür entschieden, die Teile, die im Westen Deutschlands spielen, vollkommen draußen zu lassen. Allerdings hat man beim Lesen des Romans auch das Gefühl, dass der ganze Wismut-Komplex Bräunig näher war. Jugend in einer Umbruchszeit, das ist heute genauso aktuell wie damals. Es knirscht auch heute wieder in der Welt, die Lager verschieben sich. Es geht um politische Heimatsuche, wenn man so will. Nicht zuletzt ist auch die Atom-Aufrüstung im Hintergrund etwas, was wir heute erneut als Bedrohung erleben. Und es war mir wichtig, ganz am Ende, im Epilog, über das Buch hinaus zu erzählen und einen Bogen zu spannen bis zur Abwicklung der Wismut 1992. Denn auch das hat die Menschen in dieser Gegend tief geprägt, bedeutete einen Einschnitt für unzählige Familien. Auflösen müssen, was man einmal mit aufgebaut hat, das ist eine bittere Erfahrung.
Das Gespräch führte Michael Hametner.

Weitere Artikel des Autors
9/2025
Der Schatz im Kamin
6/2025
Am Rande der Stadt mittendrin
5/2025
Achtung, Geiselnahme!
3/2025
Mit jedem war er bekannt
2/2025
Wiener Wunder
1/2025
Eleganz vergangener Tage
11/2024
Farbe, Linie, Rhythmus
10/2024
Der Bücherretter
9/2024
Eine Geschichte ohne Happy End
8/2024
Länger, lauter, Meyer
Mehr zum Autor







