100 Jahre Rotary Österreich
Wiener Wunder
Die moderne Welt hat einen Geburtsort: Wien. Richard Cockett behauptet das in seinem Buch „Stadt der Ideen“ – und hat recht.
Wer Richard Cocketts Buch Stadt der Ideen zu lesen beginnt, könnte wie ich mit Skepsis der Grundthese des Buches gegenüberstehen. Er gibt der Moderne einen Geburtsort, und der heißt für ihn Wien. Aber der britische Historiker und Journalist Richard Cockett schreibt so suggestiv von Wien als Entstehungsort der Moderne, dass meine Skepsis Seite für Seite schwand und ich nicht anders konnte, als zu ihm und seiner These überzulaufen. Nach mehr als 400 Seiten bin ich überzeugt und fühle mich mit viel neuem Wissen beschenkt.
Cockett führt zahlreiche Gründe an, warum Wien ein idealer Ort für das Projekt Moderne war. Er nennt die Größe der Stadt. Mit zwei Millionen Einwohnern war sie nicht klein, aber auch nicht so groß, dass man sich nie begegnete. Die Innere Stadt durchquert man in einer halben Stunde Fußweg. Und 600 Kaffeehäuser, die es um 1900 in der Stadt gab, schufen eine Öffentlichkeit und wurden nicht ohne Grund „demokratische Klubs“ genannt. Die größte Rolle aber spielte die Universität. Sie entwickelte sich dank vieler ihrer Professoren schon Ende des 19. Jahrhunderts zu einer Schule des liberalen Denkens. Die Voraussetzung dafür war die Vertreibung der Metaphysik des deutschen Idealismus und die Etablierung eines rationalen Denkens. So kam es, dass die Wissenschaften einen zentralen Platz in der intellektuellen Produktion der Stadt einnahmen. Hauptvertreter dieser wissenschaftlichen Kultur war der Physiker Ernst Mach, der sich zunächst in Prag und ab 1895 als Philosophieprofessor in Wien als Begründer eines wissenschaftlichen Weltbilds verdient machte. Die Wiener Erziehung zum Rationalen ließ eine liberale Mittelschicht entstehen, zu der auch ein überproportional großer jüdischer Bevölkerungsanteil gehörte.
Café Central als Postadresse
Auch die Musik spielte in Wien eine besondere Rolle. Man kannte die Werke seiner Komponisten aus Dutzenden Besuchen der Oper. Viele waren der Musik Gustav Mahlers regelrecht verfallen. Aber nicht nur Musik förderte die Gemeinschaftserfahrung der Wiener Bürger, auch die Literatur. Man liebte die Literaten, kannte die Cafés, in denen Peter Altenberg, Arthur Schnitzler, Stefan Zweig und die vielen anderen anzutreffen waren. Altenberg gab als seine Postadresse das Café Central an, wo er sich häufiger aufhielt als in seiner Junggesellenwohnung.
Richard Cockett zieht eine große Kurve durch die Kulturgeschichte Wiens in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts, ehe er den Boden betritt, auf dem die Männer und Frauen für die Moderne des 20. Jahrhunderts wirkten. Auf der einen Seite ist für ihn die konservative Figur des Kaisers über ihre lange Regierungszeit hinweg der wichtige Stabilitätsanker für alle, die nach Neuem suchen. Dabei handelt es sich nur um ein scheinbares Paradox, denn erst das Konservative treibt die Erneuerer nach vorn zu einer Gegenkultur. Cockett stellt auch klar, dass das Ende des Kaiserreichs mit dem Ende des Ersten Weltkriegs den Rumpfstaat nicht in eine große Depression führte, sondern viele Energien freisetzte.
Aufstieg und Fall des Roten Wien
Das zweite Kapitel beschäftigt sich dann ausführlich mit dem die Zwischenkriegszeit so prägenden Roten Wien. Diese Zeit zwischen 1919 und 1934 hat ebenfalls viele Protagonisten, Männer, aber mehr und mehr auch Frauen. Dazu zählt Freuds Tochter Anna Freud, die zur zweiten Generation der Psychoanalytiker gehört und die viel für die gesunde Entwicklung der Kinder geleistet hat. Mit dem Roten Wien war die Vision vom „Neuen Menschen“ in den Blick genommen worden, und das Buch zeigt auf, wie radikal und wie nah an Vorstellungen eines demokratischen Sozialismus sich das Rote Wien entwickelte. Nach den Jahren um die Jahrhundertwende, als der Bürgermeister Karl Lueger seinen Judenhass auslebte, wurde Wien 1919 plötzlich sozialdemokratisch geführt. Innerhalb eines Jahrzehnts gelang es den Sozialisten, die Stadt zu verwandeln. Mit dem Geld aus einer Wohnbausteuer, die vor allem eine Luxussteuer war, entstanden allein in den 20er Jahren 382 Gemeindebauten mit beinahe 65.000 Wohnungen. Daran wirkten die ersten Architekten der Stadt mit: Schüler des 1918 verstorbenen Otto Wagner. Das ganze Konzept war ein Konzept der Moderne. In Frankreich und der Schweiz war Le Corbusier der Kopf, in Deutschland Walter Gropius und das Bauhaus. Wobei Wien – darauf weist der Autor hin – sich vom asketischen Kubus-Bauhaus mit viel weicheren und dem Schönheitsbedürfnis der Bewohner folgenden Lösungen absetzte. Auch die Moderne des Roten Wien selbst blieb auf Dauer nicht unwidersprochen. Hauptangriffspunkt war, dass die Lösungen von oben kamen und nach dem Konzept des Neuen Menschen eine Gleichbehandlung durchsetzen wollten. Dieser Konflikt zwischen Freiheit der Individualität und gemeinschaftsstiftender Norm sollte ein Grundkonflikt des 20. Jahrhunderts werden. Im Kapitel „Aufstieg und Fall des Roten Wien“ wird mit vielen Namen und ihren Geschichten dargestellt, wie eine Utopie aufblüht, schließlich zur Illusion schrumpft und stirbt.
Exil und Emigration
Das letzte Kapitel verfolgt die Spuren der Wiener in Exil und Emigration, vor allem in den USA und in Großbritannien. Der schon seit den späten 20er Jahren latente Austrofaschismus, mit Bundeskanzler Engelbert Dollfuß an die Macht gekommen, machte noch vor dem sogenannten „Anschluss“ 1938 deutlich, dass es in Wien keinen Boden mehr für die Moderne gab. Auch für die, die ihre Heimat verließen und in der Diaspora an dem Projekt der Moderne weiterwirkten, weiß Richard Cockett viele Zeugen aufzurufen. Die Reihe reicht von Billy Wilder und dem fünffachen Oscargewinner Fred Zinnemann über den Philosophen Karl Popper bis zu politischen Ökonomen wie Ludwig von Mises, dem Theoretiker des Neoliberalismus Friedrich August von Hayek und seinem Gegenspieler, dem Kapitalismusanalytiker Joseph Schumpeter.
Richard Cockett lässt in seinem Buch nicht nur Tatsachen nüchtern sprechen, sondern weiß den Biografien seiner Kronzeugen für die Moderne fast immer eine Skizze ihres Charakters beizugeben. Das ist die Kunst des Sachbuchs in der anglophilen Tradition: Der Text ist mit 560 Anmerkungen gespickt, aber wechselt deshalb nicht in einen akademischen Stil. So wie mir meine Skepsis zu Wien als Quelle der Moderne genommen wurde, hat Cockett für sich auch etwas korrigiert. Er hatte sich in vorangegangenen Forschungen auf die Quellen der politischen Ökonomie beschränkt. Jetzt, schreibt er am Schluss, sind sie ein Tor zu einem Gesamtbild der Wiener Moderne.
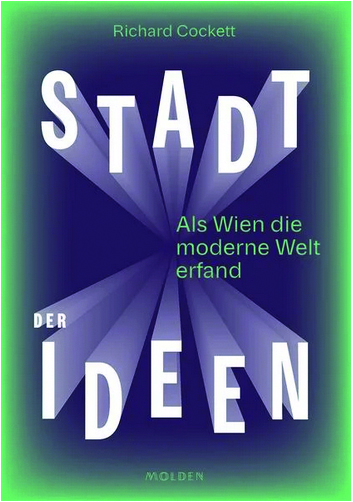
Richard Cockett
Stadt der Ideen. Als Wien die moderne Welt erfand
Molden Verlag 2024,
432 Seiten, 40 Euro

Weitere Artikel des Autors
9/2025
Der Schatz im Kamin
8/2025
Rummelplatz
6/2025
Am Rande der Stadt mittendrin
5/2025
Achtung, Geiselnahme!
3/2025
Mit jedem war er bekannt
1/2025
Eleganz vergangener Tage
11/2024
Farbe, Linie, Rhythmus
10/2024
Der Bücherretter
9/2024
Eine Geschichte ohne Happy End
8/2024
Länger, lauter, Meyer
Mehr zum Autor







