Titelthema
Das Selbstverständnis der Republik
Warum der Kampf um den Begriff „bürgerlich“ auch ein Kampf um die politische Mitte unserer Gesellschaft ist
Es kann kaum überraschen, dass in einer Situation der politisch-kulturellen Polarisierung und des Ringens um den sozialen Zusammenhalt unserer Gesellschaft der Begriff des Bürgerlichen und all das, was ihm wesensmäßig zugehört, zum Zentrum der politischen Auseinandersetzung geworden ist. Das kann in einem auf die gesellschaftliche und politische Mitte ausgerichteten Land, wie es die Bundesrepublik nun einmal ist, auch gar nicht anders sein: War es in den Ländern des realexistierenden Sozialismus einst die Zurechenbarkeit zu den Werktätigen, mit der man Anspruch auf allerhand Bevorzugungen erhob, so ist in der Bundesrepublik das Bürgerliche zu Maß und Mitte der Republik geworden. Dementsprechend wurde seit den 1950er Jahren um das politische Selbstverständnis und die Zukunftsvorstellungen der Republik gekämpft, indem man den Bürger mitsamt all dem, was ihn habituell ausmachte, ein wenig nach links oder nach rechts zu verrücken suchte und damit den Ort der politischen Mitte neu definierte.
Eine derartige Neufestlegung der politischen Mitte kann offen und explizit angestrebt werden, wie das mit Gerhard Schröders Formel von der „neuen Mitte“ Ende der 1990er Jahre der Fall war; sie kann jedoch auch das Ergebnis eines Wandels der politischen Kultur sein, wie nach 1968, als die Aktivisten der neuen Linken dezidiert antibürgerlich auftraten und den Habitus des Bürgerlichen ins Lächerliche zogen. Im Ergebnis sorgten sie damals auf diese Weise jedoch dafür, dass das Bürgerliche neu definiert und konturiert wurde: Es wurde aus dem Korsett des Ständischen befreit und den Anforderungen der Konsumgesellschaft angepasst. Keiner der Vor- und Nachdenker der neuen Linken hatte das damals intendiert, vielmehr war es die Schwerkraft der gesellschaftlichen Konventionen, die zu diesem Ergebnis geführt hat.
In diesem Sinne waren alle relevanten politischen Auseinandersetzungen in der Bundesrepublik Kämpfe um die Mitte der Gesellschaft, ihre Kultur und ihr Selbstverständnis. Das gilt auch für die jüngst in der FAZ zwischen Bernhard Schlink und Peter Altmaier ausgetragene Kontroverse um die Bandbreite dessen, was als „bürgerlich“ bezeichnet werden soll: Unmittelbar geht es um den Begriff des „Bürgerlichen“ – in einem tieferen Sinn aber um das Selbstverständnis der Republik.
Lässt sich über solche Kontroversen mehr sagen, als dass sie Bestandteil politischer Kämpfe um die Definitionshoheit über die Mitte der Republik sind? An denen man sich beteiligen kann oder denen gegenüber man auf Abstand bleibt? Wäre die Beschreibung dieser Debatten als Kampf um die kulturelle Hegemonie erschöpfend, so wäre jede Stellungnahme Bestandteil dieses Kampfes. Wer in diesen Kampf nicht eingreifen will, muss schweigen. Oder gibt es womöglich doch so etwas wie eine Schiedsrichterrolle, die einer objektivierenden Beobachtung zufällt?
Bürgertum und Bürgerschaft
Die Bemühungen um einen solchen „Blick von außen“ auf Bürgerlichkeit und deren Bedeutung beginnt mit zwei Unterscheidungen: der zwischen Bürgertum und Bürgerschaft und der zwischen einer deskriptiven und einer präskriptiven – d.h. zwischen einer beschreibenden oder einer von Thesen geleiteten, zuschreibenden – Begriffsverwendung. Dabei konzentriert erstere sich auf das, was augenscheinlich der Fall ist und obendrein empirisch gemessen werden kann, während letztere sich um die Frage dreht, inwieweit die Zuschreibung von Bürgerlichkeit auch eine bestimmte Verhaltenserwartung einschließt, also einen Maßstab darstellt, dem man genügen muss, wenn man dazugehören will. Doch wer verfügt über diesen Maßstab, der ja immerhin auch die Macht des Ausschlusses einschließt? Eigentlich ist das eine Sache der bürgerlichen Mitte selbst, die aber ist zur Zeit ausgesprochen zurückhaltend und leise. Ihre Repräsentanten tun so, als könnten sie in der Beobachterrolle bleiben. Das aber ist ein Missverständnis, das schwerwiegende Folgen haben kann.
Beginnen wir bei der Unterscheidung zwischen Bürgerschaft und Bürgertum, citoyen und bourgeois, wie man das im 19. Jahrhundert unter dem Einfluss der Französischen Revolution genannt hat. Der citoyen ist ein wesentlich politischer Begriff, der sich um Teilhabe und Mitentscheidungsrechte im jeweiligen Gemeinwesen dreht. Die Bürgerschaft ist danach ein privilegierter Teil der Einwohnerschaft, die lange Zeit ausschließlich als männlich und sozial arriviert definiert war, was in der Bindung an Grundbesitz oder eine höhere Steuerzahlung seinen Ausdruck fand. Dass die Bürgerschaft weniger als die Hälfte der Einwohnerschaft stellte, änderte sich erst zu Beginn des 20. Jahrhunderts, als mit der Ausweitung des Wahlrechts auch Frauen zu Vollbürgern wurden. Das war nicht zuletzt eine Folge des Ersten Weltkriegs, an dessen Ende die Koppelung der Bürgerschaft ans Bürgertum aufgelöst wurde.
Bis heute hat jedoch jedes Land mehr Einwohner als Bürger, weil nur Staatsbürger in vollem Umfang über die Bürgerrechte verfügen, ausländische Staatsangehörige, aber auch Kinder und Jugendliche dagegen nicht. Diese Differenz ist rechtlich geregelt; sie zu markieren liegt nicht im beliebigen Ermessen der Betroffenen.
Abgrenzungen
Das heißt indes nicht, dass es keine präskriptive Dimension des Bürgerschaftsbegriffs gibt – nur ist diese schwach und auf eine bloße Erwartung beschränkt. Sie besteht darin, dass ein Bürger über politische Urteilskraft verfügt bzw. sich darum bemüht, diese zu schärfen, um seine Teilhaberechte an der Gesellschaft auch kompetent ausüben zu können. Die Zumutung, sich um die Schärfung der politischen Urteilskraft zu bemühen, ist gewissermaßen die Kehrseite der Bürgerrechte. Soziale und politische Mitte der Republik zu sein ist nicht nur ein Privileg, sondern auch eine Herausforderung. Das gerät in Zeiten politischer Stabilität und wirtschaftlicher Prosperität oftmals in Vergessenheit.
Im Unterschied zu Bürgerschaft ist Bürgertum ein sozio-kultureller Begriff, bei dem die Zuschreibung bestimmter Merkmale sehr viel stärker ausgebildet ist. Sie reicht von Tischsitten und einer gepflegten Sprache über Bekleidung bis hin zu Bildungsvoraussetzungen – auch wenn diese bei dem bereits erwähnten Übergang von der ständischen zur konsumistischen Gesellschaft an Bedeutung verloren haben. Beim Geltend-Machen dieser Erwartungen spielt Bürgerlichkeit eine zentrale, prägende Rolle. Von allen hier aufgeführten Begriffen hat sie die am stärksten ausgeprägte präskriptive Komponente. Sie ist das semantische Instrument, mit dem sich das Bürgertum selbst definiert und dabei gegen diejenigen abgrenzt, von denen es nicht will, dass sie dazu gezählt werden sollen: Parvenüs und Neureiche, Spekulanten und Bankrotteure, aber auch Arbeiter und Bauern. Bürgerlichkeit grenzt sozial nach oben und unten ab – aber tut sie das auch politisch nach rechts und links, worum es in der jüngsten Debatte ja geht?
Auf jeden Fall ist es ein Kategorienfehler, wenn eine bestimmte Partei behauptet, sie sei bürgerlich, weil sie auch von dem Bürgertum zugehörigen Wählern Stimmen bekommen habe, wie es der AfD-Vorsitzende Gauland kürzlich im Nachgang zu den Landtagswahlen in Sachsen und Brandenburg erklärt hat. Mit dieser Argumentation hat er schlichtweg die präskriptive – also zuschreibende – Dimension gegen die deskriptive – also beschreibende – und habituelle ausgetauscht. Bürgerlichkeit schließt nämlich die Teilnahme an bestimmten Kundgebungen und Demonstrationen ebenso aus wie den Gebrauch einer mit Unterschichtbegriffen versetzten, herabsetzenden Sprache. Bürgerlichkeit bedient sich reflektierender Argumentation und wahrt Abstand gegenüber hasserfüllten Parolen. Wo die Grenze dazwischen verschwimmt, hat Bürgerlichkeit ihre Konturen eingebüßt. Sie ist dann nur noch pure Selbstetikettierung.
Schutz des Begriffs
Es gibt also gute Gründe dafür, den Begriff der Bürgerlichkeit gegen sein Beliebig-Machen zu schützen; und das tut man, indem man ihn wieder stärker an seine klassischen Merkmale bindet. Das läuft darauf hinaus, dass alle diejenigen sich vom Attribut der Bürgerlichkeit selbst ausschließen, die den damit verbundenen Erwartungen nicht genügen. Nur so kann der Begriff seine politisch orientierende und sozial integrierende Kraft bewahren. Peter Altmaier hat das besser begriffen als Bernhard Schlink. Und Alexander Gauland hat ein erkennbar instrumentelles Verhältnis zum Begriff des Bürgerlichen, auch wenn er demonstrativ den zugehörigen Habitus pflegt. Er versucht damit lediglich, von ganz rechts in den Kampf um die Mitte einzugreifen. Dabei geht es ihm um eine Entleerung des Begriffs bürgerlich.
Einem solchen Angriff sollte man nicht nachgeben und inhaltliche Merkmale nicht mit dem äußerlichen Habitus verwechseln. Oder mit Odo Marquard gesprochen: „Die liberale Bürgerwelt bevorzugt das Mittlere gegenüber den Extremen, die kleinen Verbesserungen gegenüber der großen Infragestellung, das Alltägliche gegenüber dem Moratorium des Alltags, das Geregelte gegenüber dem Erhabenen, die Ironie gegenüber dem Radikalismus, die Geschäftsordnung gegenüber dem Charisma, das Normale gegenüber dem Enormen.“
Rück- und Ausblicke
Unsere Welt ist geprägt durch die rechtlichen, ideellen, ökonomischen und nicht zuletzt kulturellen Traditionen und Parameter der „bürgerlichen Gesellschaft“. Seit dem 18. Jahrhundert trat diese sukzessive an die Stelle der überlieferten feudal-ständischen Ordnung der Vormoderne und hat seitdem diverse ideologische Herausforderungen von rechts und links überdauert. Dennoch entspricht das öffentliche Bewusstsein über dieses grundlegende Fundament unserer politisch-sozialen Ordnung keineswegs seiner ungebrochenen Bedeutung.
Vor diesem Hintergrund beleuchtet der Sammelband „Bürgertum. Bilanzen, Perspektiven, Begriffe“ die Entwicklung des Bürgertums seit dem 19. Jahrhundert. Der Band beginnt mit einem Blick auf die sozialgeschichtliche Forschung in der alten Bundesrepublik „nach 68“ und widmet sich dann den
(bildungs-)bürgerlichen Lebensführungen im langen 19. Jahrhundert. Anschließend folgen einige aufschlussreiche Studien zu den Brüchen, Transformationen und Kontinuitäten bürgerlicher Lebensweisen im 20. Jahrhundert, angesichts der Herausforderungen durch den Sozialstaat, die politischen Gegenutopien, die Pluralisierungszumutungen der Moderne. Abschließend widmen sich vier Beiträge der Begrifflichkeit und
Lebenswelt von Mittelklassen außerhalb Europas – in der Erwartung, dass das Wissen über europäische Traditionen „bürgerlicher Gesellschaft“ die weitere Diskussion über global middle classes befruchten wird.
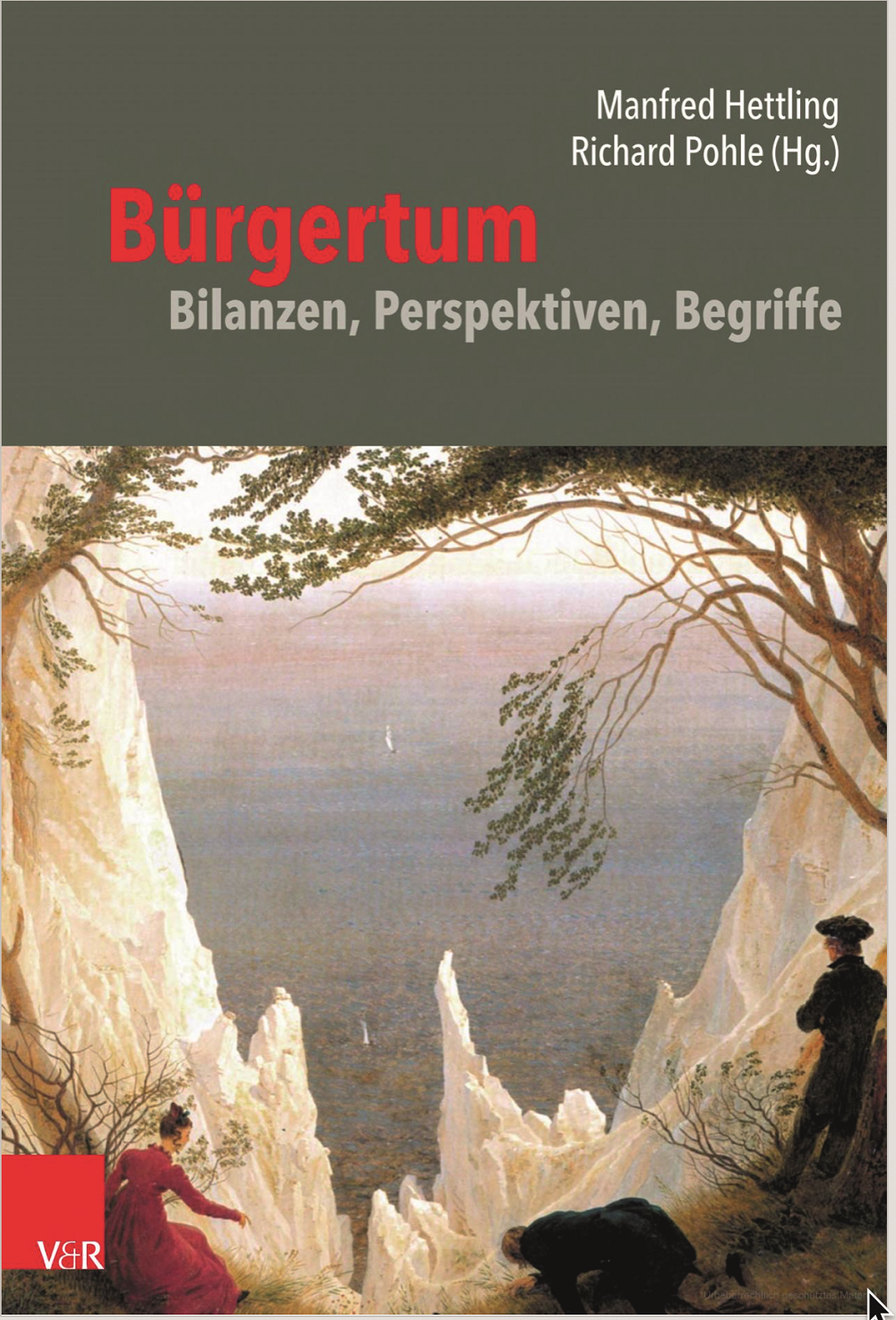
Manfred Hettling / Richard Pohle (Hg.)
Bürgertum.
Bilanzen, Perspektiven, Begriffe
Vandenhoeck & Ruprecht,
489 Seiten,
59,99 Euro

© Ralf und Heinrich
Weitere Artikel des Autors
4/2022
Putins postimperialer Phantomschmerz
11/2017
Zerfallende Ordnung
9/2017
Kommt das demokratische Zeitalter an sein Ende?
6/2016
Formiert sich die politische Mitte neu?
12/2015
Krieg oder nicht Krieg?
7/2015
Die Erosion der Mitte
1/2015
Steht Europa an der Schwelle zu einem neuen Kalten Krieg?
7/2014
Die Macht der Ideen
3/2014
Vom Sonderweg zur Extrawurst
1/2014
Lernen im Krieg, lernen aus dem Krieg
Mehr zum Autor







