Forum
Räudig, versifft – und dennoch grandios
 Fotostrecke: Brutalismus
Fotostrecke: BrutalismusEine Ausstellung im Deutschen Architekturmuseum Frankfurt erinnert an die fast verdrängte Bauepoche des „Brutalismus“.
Es kommt drauf an, was man draus macht“, hieß jahrzehntelang der Slogan der deutschen Betonindustrie. Diese versuchte damit, gegen ein tiefsitzendes Vorurteil anzukämpfen, dass Beton ein hässlicher, unwirtlicher Baustoff sei, mit dem man Städte verschandelt und Landschaften zerstört; „zubetoniert“, wie die gängige Wortschöpfung hieß. Grundlos war dieses Vorurteil nicht. Mit keinem anderen Material verbinden sich die Bausünden der sechziger und der siebziger Jahre schmerzhafter als mit Beton. Die grauen, unförmigen Kolosse stehen da und sind kaum wegzukriegen. Betonmonster ist ein geläufiges Wort für sie geworden, auch wo es durchaus liebevoll verwendet wird.
Vielleicht ist eines der am wenigsten bekannten und doch typischsten Exemplare dieser Art das „Haus der Sowjets“ in Königsberg, das in den 1970er Jahren anstelle des alten Stadtschlosses errichtet und wegen gravierender Baumängel nie bezogen wurde. So steht es da ohne Funktion und ohne Leben, aber auch ohne die Chance, sterben zu dürfen. Denn niemand weiß, wie man den Koloss wieder abreißen kann. So wie die Bunkeranlagen und Flaktürme der Nazis, die sich kaum mehr sprengen ließen und als gruselige Relikte ihre Zeit überdauern. Trotzdem geht von diesen Betonbunkern am ehemaligen Atlantikwall eine sonderbare Faszination aus, was nicht zuletzt an jenem Stahlbeton liegt, mit dem sich kühnere, expressivere und brutalere Formen realisieren ließen, als mit jedem anderen Baustoff zuvor.
Dinosaurier der Postmoderne
Seit den fünfziger Jahren hat sich für diese Art von Betonarchitektur der Begriff „Brutalismus“ eingebürgert, was im Deutschen aber zu einem Missverständnis führt. Denn eigentlich meint das französische Attribut „brut“ im Zusammenhang mit béton brut eher das rohe Material, die sichtbare Oberfläche, die ehrliche Haut und rüde Anmutung dieser Gebäude, die seit den fünfziger Jahren auf der ganzen Welt gebaut und schnell zum Inbegriff einer fortschrittsradikalen Nachkriegsmoderne wurden. Sie haben die Physiognomie vieler Städte dramatisch verändert und sind mittlerweile selbst vom Aussterben bedroht. Keine Zeugnisse einer anderen Stilepoche sind heute so sehr von Sprengkommandos und Abrissbirne betroffen, wie die gebauten Betonskulpturen des Brutalismus. In einer postmodernen Zeit der ökologischen Zweifel und der historischen Rekonstruktion scheint kein Platz zu sein für solche architektonischen Saurier – weder ästhetisch noch funktional. Ihre Masse, Schwere und Festigkeit stört.
Die derzeit im Frankfurter Architekturmuseum gezeigte große Ausstellung zur Epoche des Brutalismus hat deshalb etwas Vor- und Frühgeschichtliches an sich; sie mutet an wie ein architektonischer Jurassic Park aus gigantischen Knochen und Gebeinen einer längst ausgestorbenen Spezies. Es sind oft tote, menschenleere Gebirge und Gerippe aus Beton, in denen sich ein rekultiviertes postmodernes Leben nicht aufzuhalten vermag, und durch die immer noch die Wüstenwinde eines Jahrhunderts der Katastrophen blasen.
Aber genau das macht auch ihren heutigen Reiz aus. Es ist keine gepflegte Latte-Macchiato-Architektur, sondern eine, die von Katastrophen, Umbrüchen und Abrissen erzählt, aber auch vom Pathos des technischen Aufbruchs in eine progressive Welt. Darin liegt vielleicht auch der Grund, warum sich junge Architekten heute wieder für diesen Brutalismus begeistern. Er verkörpert selbst in der räudigsten Form seiner versifften Beton- oberflächen noch etwas Grandioses und Grundehrliches dazu. Es war das Gesicht einer Zeit, die noch an die emanzipatorische Kraft des Fortschritts glaubte und an eine Gesellschaft der Chancen für Jeden.
Architektur der Überwältigung
Die Innenseite dieser neuen Welt entsprach ihrem Äußeren: Alles schien machbar, alles konnte man modellieren, und Beton war dafür das adäquate Material. Es ist kein Wunder, dass die stärksten Zeugnisse dieser Architektur auch die großen Solitäre waren; Bauten, die ihren urbanen Rahmen sprengten und keinen historischen Kontext mehr duldeten. Sie waren Stadtkronen ohne die Stadt. Seine wohl schönste und bis heute gültige Ausprägung hat dieser brutalistische Stil, der nie ein Stil sein wollte, im Kirchenbau seiner Zeit gefunden. In kaum einer anderen Zeit des vorigen Jahrhunderts sind prosaischere und rauere Gotteshäuser entstanden als in den fünfziger und sechziger Jahren. Man hat sie gelegentlich als Seelenabschussrampen verspottet, aber sie wollten gerade in der nivellierten Mittelstandsgesellschaft jener Zeit immer noch aufragen und einen Glauben repräsentieren, der auf keine Tradition und auf kein Ornat mehr zurückgreifen wollte. Beton und Licht, das implizierte eine sentimentalitätslose Gegenwart, die sich wohl noch eine Zukunft vorstellen wollte, aber keine Vergangenheit mehr.
Im Sakralbau, so der Architekturhistoriker Wolfgang Pehnt, fand der brutalistische Stil daher zu Emotionen, die „breiter und tiefer“ ausfielen als in der nüchternen Nutzarchitektur. Und trotzdem gaben diese oft katakombenartigen Kirchenräume schon eine Vorahnung von einer säkularen Entwicklung, die bald darauf mit Macht kommen sollte. In diesen Kirchengrotten fand man Schutz; sie gaben Obdach, aber vielmehr noch das Gefühl von Geborgenheit für Gemeinden, die nicht mehr selbstverständlich wie früher das öffentliche Leben bestimmten. Der Glaube ging in die Höhlen zurück.
Überhaupt zeigt diese brutalistische Architektur oft etwas unheimlich Verschlossenes. Fensterlose Wandflächen ohne Schleusen zur Außenwelt; tageslichtfreie Laborräume für das soziale Experiment. „Mäusebunker“ heißt eine Tierversuchsanstalt aus jener Zeit in Berlin, den auch die Frankfurter Ausstellung für den „unheimlichsten Bau der deutschen Nachkriegsmoderne“ hält. Hohlräume, die sich gegenüber der Außenwelt abkapseln – das ist auch eine Absage an das Hauptanliegen der klassisch modernen Reformarchitektur, Luft und Licht in die Gebäude zu lassen. Die typischen Ausbildungsbunker wurden damals gebaut und Wohnsilos, wie sie bald im Volksmund hießen, die schon am Tage künstliches Licht brauchten. Der Brutalismus erzeugte keine funktionierende und keine auf Grundbedürfnisse konzentrierte Architektur, sondern eine hochideologische mit einer erschreckenden Faszination am Seriellen, dem sie alles wuchernde Leben einpressen wollte. Es war eine Architektur der Überwältigung und eine der Norm. Die Form, schrieb Christian Thomas in der Frankfurter Rundschau, wurde übergriffig, auch gegenüber der Funktion.
Notruf einer verdrängten Zeit
Kein Wunder also, dass die formierten Gesellschaften im Osten eine besondere Neigung zu dieser Art von Komplexbau entwickelten. Der bleiernen Zeit der Breschnew-Jahre gab der Brutalismus das gebaute Gesicht. Aus postsowjetischer Sicht ist Beton deshalb das „böse Vergangene“, so der Architekturhistoriker Wolfgang Kil. Die moderne globale Bankenwelt erscheint heute aus Stahl und aus Glas.
Trotzdem funken diese Monster, wie es in dem Katalog zur Frankfurter Ausstellung heißt, heute SOS. Die Ausstellung will dokumentieren und retten und sieht sich bei diesem Unterfangen ganz „kämpferisch“. Es geht um den Denkmalswert dieser Gebäude, und es geht um deren Erhalt. Denn nicht nur die gesellschaftliche Ablehnung macht ihnen zu schaffen. Auch der ganz normale Verfall. Der angeblich so robuste Baustoff Beton zeigt überall seine Schwächen. Er kann nicht in Würde altern; er wird schäbig und korrodiert vor sich hin.
Die neue Liebe zum Brutalismus und dem Baustoff Beton kommt deshalb vehement und war schon auf einem internationalen Symposion vor Jahren zu spüren. Sie wird vor allem von einer jungen Generation artikuliert, die sich offenbar satt gesehen hat an der patinafreien Rekonstruktion von Geschichte. Das alte Versprechen von brutaler Ehrlichkeit, die proletarische Kraft und ikonische Einprägsamkeit dieser Monster entfalten ihre Wirkung noch immer. Für den Städtebau waren sie vielerorts tödlich. Aber als Zeugen ihrer Zeit sollte man sie erhalten. Wer das 20. Jahrhundert verstehen will, muss auch um seine ästhetischen Katastrophen wissen.
Das Architekturmuseum in Frankfurt trägt dem in einer beeindruckenden Ausstellung Rechnung. Sie ist historische Aufklärungsarbeit vom Feinsten.
Ausstellung
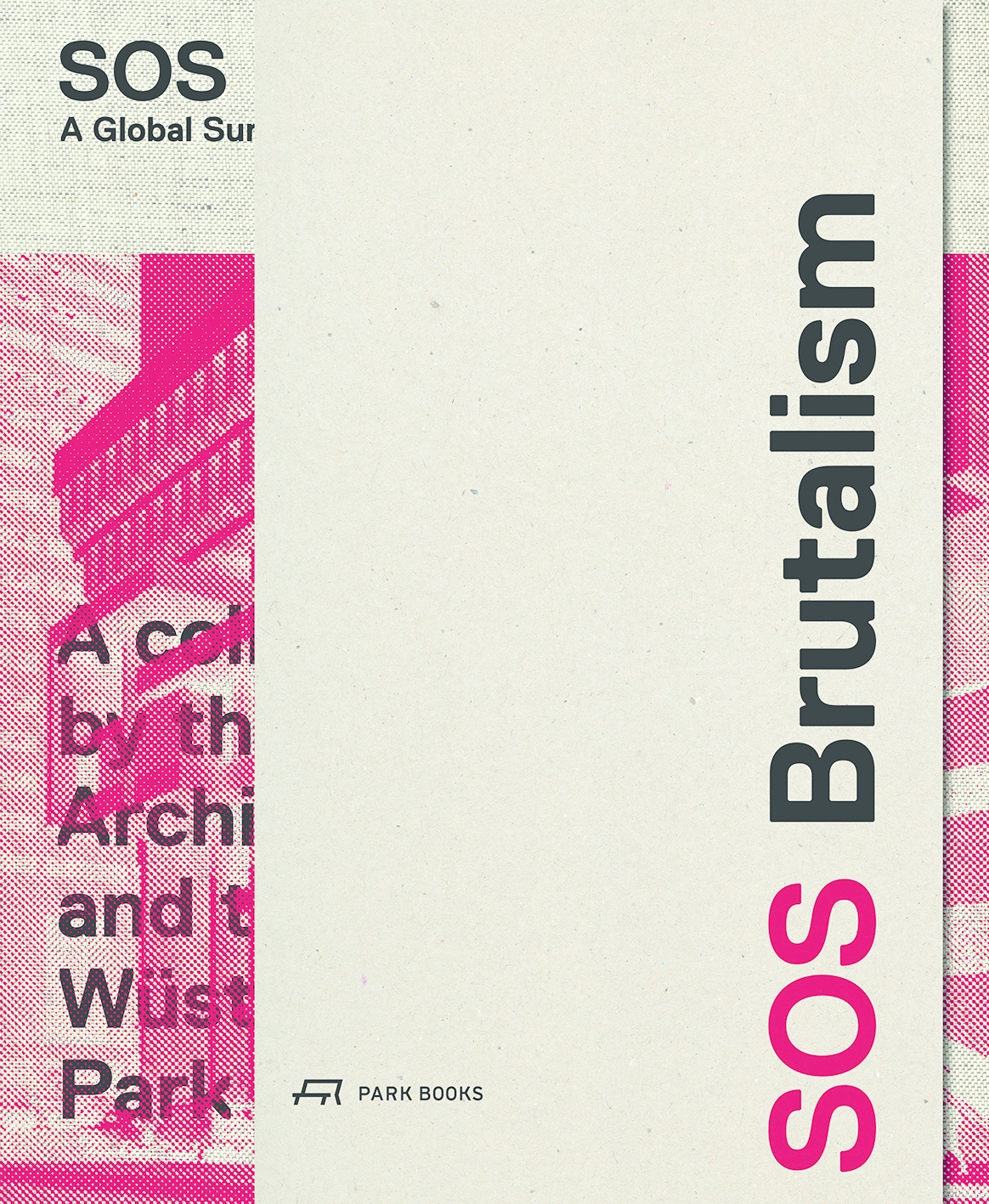
SOS BRUTALISMUS – Rettet die Betonmonster ist noch bis zum 2. April 2018 im Deutschen Architekturmuseum Frankfurt zu sehen. Der Begleitkatalog ist bei Park Books erschienen.
Link: dam-online.de

© Antje Berghäuser rotarymagazin.de
Weitere Artikel des Autors
Wundt neu entdeckt
9/2025
Weimarer Malerschule
8/2025
Die Bronzen von San Casciano
7/2025
Moderne, Merz, Memorial
5/2025
Chemnitz neu entdecken
4/2025
Vaterfigur des modernen Japan
4/2025
Wien verneigt sich
3/2025
Thoma neu entdecken
2/2025
Urbane Revolution
1/2025
Das Heilige sehen
Mehr zum Autor






